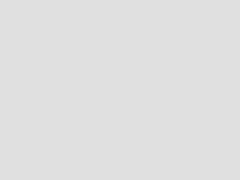Dörfer, in denen es keinen Arzt, keine Grundschule, keinen Laden, keinen Bus mehr gibt. Werdende Mütter, die eine Dreiviertelstunde bis in den nächsten Kreißsaal brauchen - wenn sie nicht gerade auf einer Insel wohnen und sowieso einige Wochen vor der Geburt ihre Heimat verlassen müssen. Häuser, die leer stehen, weil die Jungen, Gutausgebildeten ihre Heimat verlassen. Und schnelles Internet gibt es auf dem Land auch nicht!
"Abgehängte Regionen" ist das politische Schlagwort, unter dem diese Probleme verhandelt werden - und von denen zuletzt viel die Rede war, weil dort bei der Bundestagswahl die AfD gute Ergebnisse erzielen konnte. Bald soll sich ein eigens eingerichtetes Heimatministerium unter Führung der CSU um die Probleme dieser Regionen kümmern.
Abgehängt sind viele Dörfer aber nicht nur, weil ihnen Ärzte, Schulen, Läden und Krankenhäuser fehlen. Ihnen fehlt häufig auch die politische Repräsentation. Das legt eine Umfrage der Süddeutschen Zeitung unter Bundestagsabgeordneten nahe. Demnach sind die Bewohner von Klein- und Mittelstädten sowie der Vororte in etwa so stark unter den befragten Abgeordneten vertreten wie in der Bevölkerung. Eine Diskrepanz tut sich an anderer Stelle auf. So lebt zwar eine Mehrheit der Deutschen, nämlich 34,9 Prozent, "auf dem Dorf" - aber nur 17,4 Prozent der befragten Bundestagsabgeordneten haben dort ihren Erstwohnsitz. Überrepräsentiert sind hingegen die Großstadtbewohner: 19,7 Prozent aller Deutschen leben dieser Kategorisierung des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften zufolge in einer Großstadt, aber 38,6 Prozent der befragten Abgeordneten.
Warum sind so viele Großstadtakademiker im Bundestag?
Woran das liegt, erklärt Claudia Neu, Inhaberin des Lehrstuhls Soziologie ländlicher Räume an den Universitäten Göttingen und Kassel. "Zunächst einmal muss man unterscheiden, wer über ein Direktmandat und wer über die Landesliste in den Bundestag kommt", sagt sie.
Während die Direktkandidaten auf ihre Wahlkreise in ganz Deutschland verteilt sind und häufig auch in ihrem Wahlkreis leben, werden die Listenkandidaten auf Landesebene bestimmt. "Auf den Listen sind Akademiker aus der Großstadt häufig überrepräsentiert." Das passt auf den ersten Blick dazu, dass in Befragungen das allgemeine politische Interesse in Großstädten am größten sei, sagt Neu. "Das hat auch mit einem höheren Bildungsniveau zu tun."
Allerdings sage das politische Interesse allein noch nichts darüber aus, ob jemand sich auch politisch engagiere. Und politisch aktiver als die Dorfbewohner sind die Großstädter nicht automatisch, das unterscheide sich von Region zu Region. "Menschen auf dem Dorf haben häufiger politische Ämter inne und zeigen ein starkes Engagement vor Ort", sagt sie. Während Großstädter vielleicht eher zu Demonstrationen gingen, sich mit Themen beschäftigten, die nicht unmittelbar die Nachbarschaft beträfen.
Der Inhalt konnte nicht geladen werden.
Repräsentanten des Staates fehlen
Doch das gelte nicht für alle Regionen. "In Ostdeutschland ist der ländliche Raum in der Tat deutlich weniger aktiv", sagt sie. Parteien seien dort häufig nicht gut vertreten. Damit fehle den Dorfbewohnern der Zugang zur Politik - und den Parteien Zugang zu Kandidaten aus dem ländlichen Raum.
Das füge sich ein in ein größeres Bild. "In Teilen des ländlichen Deutschlands treffen die Menschen im Alltag nur noch selten auf Repräsentanten des Staates", sagt Neu. Das gelte für etliche entlegene ländliche Räume etwa in Mecklenburg-Vorpommern. Es gebe dort Dörfer ohne Polizeiposten, ohne Verwaltungsstelle vor Ort, ohne Lehrer oder eigenen Postboten. In anderen ländlichen Regionen sei das ganz anders. "In der Eifel oder im Schwarzwald zum Beispiel haben Dörfer noch Ortsvorsteher", sagt Neu. "Das macht Politik erfahrbar."
Damit ist Neu an einem Punkt, der ihr wichtig ist: "Einen homogenen ländlichen Raum gibt es nicht. Wir haben in Deutschland viele unterschiedliche Kulturen und Regionen", sagt sie, "das ist einerseits schön - aber auch eine Herausforderung für die Politik." Denn jede Region habe ihre eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen. Bedürfnisse und Vorstellungen, die in ihrer Vielfalt erst einmal in den politischen Prozess Eingang finden müssen. Neu berät die Bundesregierung in diesen Fragen, sie ist stellvertretende Vorsitzende des "Sachverständigenrates Ländliche Entwicklung".
"In den goldenen Zeiten des Wohlfahrtsstaates war es kein Problem, Infrastruktur in die Fläche zu bringen", sagt Neu. "Da war genug Geld für alle da." Zudem ließen sich damals noch allgemeingültige Ziele formulieren: "Zum Beispiel, dass die Landbevölkerung einen ebenso guten Zugang zu Bildung bekommt wie die Stadtbevölkerung." Bis in die 1980er Jahre galt der Soziologin zufolge: jede Kleinstadt ein Krankenhaus, ein Gymnasium, eine Sparkasse. Doch das gelte heute nicht mehr. "In Zeiten leerer öffentlicher Kassen und des demografischen Wandels wird der Erhalt der Infrastruktur zunehmend allein unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet." Da würden Schulen geschlossen, Krankenhäuser und Kirchengemeinden zusammengelegt, Gebäude rückgebaut. "Das trifft viele Gemeinden hart."
"Heimat ist ein rückwärtsgewandter Begriff"
Einige Dörfer haben Glück: Sie liegen in der Nähe großer Städte, die über ausreichend Arbeitsplätze und gute Infrastrukturen wie den öffentlichen Nahverkehr verfügen. Die Menschen bleiben oder ziehen sogar zu. "Außerdem findet man in Deutschland viele Weltmarktführer auch im zutiefst ländlichen Raum", sagt Neu. "Sogar dort müssen wir aber von den drei großen D sprechen", sagt Neu: "Demografie, Daseinsvorsorge, Digitalisierung."

Die CSU lernte aus ihren Fehlern und schuf ein eigenes Ministerium, das sich um die abgehängten Regionen in Bayern kümmert. Funktioniert das auch bundesweit?
Herausforderungen, die unter anderem der neue "Heimatminister" in Berlin angehen soll. Eine Bezeichnung, der Neu skeptisch gegenübersteht: "Heimat ist ein politisch riskanter Begriff, der im schlimmsten Fall rechte Homogenitätsphantasien bedient." Dabei seien Offenheit und Bereitschaft zur Veränderung die einzige Chance für abgehängte Regionen.
Offenheit - und Aktivität. "Wir brauchen neue Formen der Partizipation", sagt Neu. Im ersten Schritt müsse die Politik die Verwaltungsstruktur auf dem Land überdenken: "Ja, wir haben gerade eine günstige, schlanke Verwaltung mit wenigen Mitarbeitern - aber damit auch wenig Möglichkeiten für die Menschen, mit funktionierenden Strukturen unserer Demokratie in Kontakt zu kommen", sagt sie. Staat und Verwaltungshandeln müssten erfahrbar bleiben.
Politik braucht soziale Orte
Und dazu: Orte, an denen sie über Politik ins Gespräch kommen können. "Es gibt häufig auf Dörfern keine Schule mehr, keinen Lebensmittelladen, keinen Gottesdienst und somit immer weniger Möglichkeit, sich im täglichen Leben auszutauschen", sagt sie. Eine zentrale Gemeinderatssitzung allein könne das nicht ersetzen: "Das ist für viele Menschen eine zu große Hürde." Es brauche auch weiterhin soziale Orte, an denen Menschen sich im öffentlichen Raum begegnen können.
Nur so könne Zusammenhalt entstehen, sagt die Soziologin. Das sei ja auch so ein beliebtes politisches Schlagwort: "Die AfD gestaltet es im Moment so: Wir sind das Volk - und die anderen gehören nicht dazu." Um dem etwas entgegenzusetzen, müsse man erkennen: "Zusammenhalt kann man nicht von oben verordnen." Den müsse man demokratisch gestalten und gemeinsam schaffen. In reichen Regionen, armen Regionen, auf dem Land und in der Stadt.