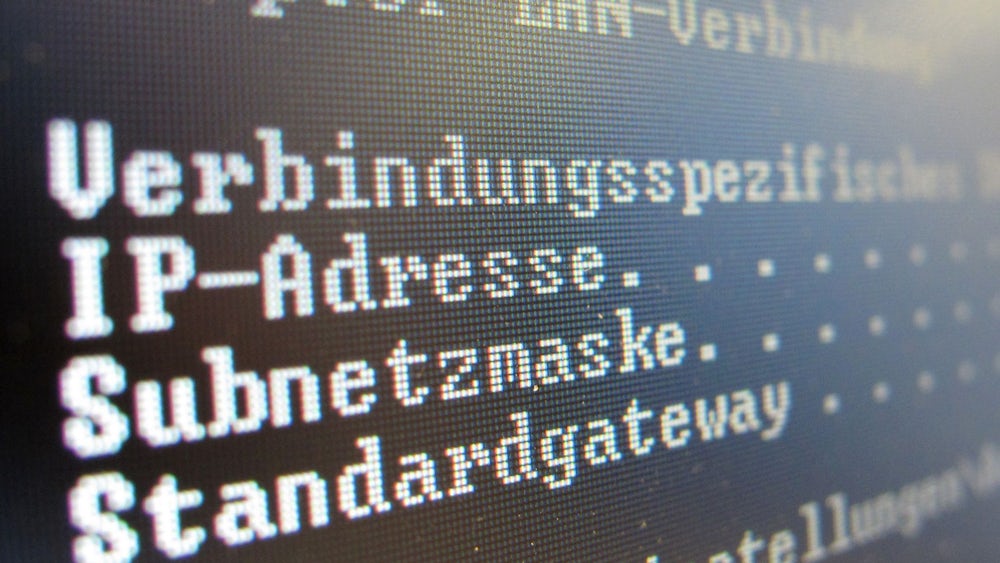Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Über den Bundesrat will Hessen die einmonatige Speicherung von Internetdaten zur Kriminalitätsbekämpfung erreichen. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) stellte das Vorhaben am Freitag in Frankfurt vor. Angestrebt wird die anlasslose Speicherung von IP-Adressen, ohne die laut Rhein zahlreiche schwerste Straftaten nicht aufgeklärt werden könnten. Das von der Ampel-Koalition in Berlin angestrebte „Quick Freeze“-Verfahren sei dazu völlig ungeeignet.
Hessen will die Initiative kommenden Freitag in den Bundesrat einbringen. Rhein sagte, er sehe gute Chancen, dass sich weitere Länder anschließen. So könne Druck entstehen, um auch im Bundestag Zustimmung aus den Reihen der Ampel zu erreichen.
In einem Kompromiss zur Speicherung von Kommunikationsdaten zu Ermittlungszwecken hatte sich die Ampel vor wenigen Tagen auf das „Quick Freeze“-Verfahren geeinigt. Dabei werden die Daten erst dann gespeichert, wenn ein Verdacht auf eine Straftat von erheblicher Bedeutung besteht.
Der Europäische Gerichtshof hatte in einem Urteil im September 2022 der Speicherung von Telekommunikationsdaten zur Aufklärung von Straftaten in Deutschland enge Grenzen gesetzt. Die Richter urteilten, die derzeit ausgesetzte Regelung zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland sei mit EU-Recht unvereinbar. Sie erklärten aber zugleich, dass zur Bekämpfung schwerer Kriminalität eine Vorratsspeicherung der IP-Adressen unter bestimmten Bedingungen möglich sei.
Aufklärung von sexueller Gewalt gegen Kinder
Dieser Rahmen müsse ausgenutzt werden, sagte Rhein. Mit der IP-Adresse lässt sich ermitteln, von welchem Anschluss Täter ihre Internetverbindung aufgebaut haben. Eine einmonatige Speicherung wäre rechtssicher, verhältnismäßig und wirksam, sagte Rhein. Es gehe auch darum, andauernde Fälle von sexueller Gewalt an Kindern aufzuklären und zu beenden. Das „Quick Freeze“-Verfahren nannte Rhein einen „Hauch von nichts“ und einen „einzigartigen Etikettenschwindel“.
Justizminister Christian Heinz (CDU) ergänzte, die angestrebte Regelung befinde sich am unteren Rand dessen, was aus der Praxis der Strafverfolgungsbehörden gefordert werde. Zudem sollen keine Standortdaten gespeichert werden. Bewegungsprofile könnten also nicht erstellt werden. Ziel sei allein, eine IP-Adresse einem Nutzer zuordnen zu können. Ein unbescholtener Internetnutzer habe nichts zu befürchten.
Eine solche Regelung sei aus Sicht der Praxis eindeutig zu begrüßen, sagte Generalstaatsanwalt Torsten Kunze. Sie würde nicht hinnehmbare Lücken schließen. Digitale Straftaten hätten in den vergangenen Jahren stark zugenommen. „Es ist wichtig, dass wir handlungsfähig bleiben“, sagte Kunze. Neben sexueller Gewalt gegen Kindern gehe es auch um die Aufklärung anderer schwerer und schwerster Straftaten wie etwa Tötungsdelikte.
Höhere Aufklärungsquote als Ziel
Benjamin Krause von der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität (ZIT) erläuterte das bisherige Vorgehen am Beispiel von Verdachtsfällen auf sexuelle Gewalt gegen Kinder, die aus den USA gemeldet würden. Hier ist das „Nationale Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder (NCMEC)“ aktiv, das weltweit strafbare, insbesondere kinderpornografische Inhalte im Internet weitergibt.
Die Meldung beinhalte neben dem verdächtigen Inhalt auch die IP-Adresse des Verdächtigen, sagte Krause. Dann müsse bisher in Deutschland sehr schnell gehandelt werden, denn die IP-Adressen würden teilweise von Telekommunikationsunternehmen auf freiwilliger Basis maximal sieben Tage lang gespeichert.
So könnten derzeit 40 Prozent der Verdächtigen ausfindig gemacht werden, sagte Krause. Durch weitere, aufwendige Ermittlungen komme man schließlich auf maximal 75 Prozent. In 25 Prozent der Fälle gelinge die Strafverfolgung dementsprechend bisher nicht. Mit der angestrebten Regelung könnten mehr als 90 Prozent der Verdachtsfälle aufgeklärt werden, sagte Justizminister Heinz.
© dpa-infocom, dpa:240418-99-725949/4