Zweieinhalb Frauen und ein Embryo - das ist die Figurenkonstellation von Torrey Peters Debütroman "Detransition, Baby". Für den hat die amerikanische Schriftstellerin, von der es bislang erst zwei Erzählungen im Selbstverlag gab, viel Aufmerksamkeit bekommen. Ihr Buch sei eine "Soap Opera", erklärte sie in einem Interview, und tatsächlich bietet die Geschichte die dramatischen Wendungen, komplizierten Verflechtungen und tragischen Biografien einer Telenovela: Reese, eine New Yorker trans Frau in ihren Dreißigern, wünscht sich ein Kind. Ames, eine ehemalige trans Frau und Ex-Partner von Reese, lebt mittlerweile wieder als Mann, seine aktuelle, cisgeschlechtliche Freundin Katrina ist schwanger. Er freut sich auf das Kind, aber fürchtet die "Schwerkaft der Kernfamilie", die Vaterrolle und die damit einhergehende eindeutige Männlichkeit, mit der er nach wie vor hadert. Deshalb fasst er den Plan, zusammen mit Katrina und Reese eine Dreiecks-Elternschaft einzugehen - im besten Falle eine Win-Win-Win-Konstellation, die Kinderwunsch, queeres Familienleben und geteilte Sorgearbeit vereinbaren soll.
Was nach einem konstruierten Plot klingt, lebt durch Peters unverblümten Stil und ihre widersprüchlichen und komplexen Charaktere. Reese gibt sich auf liebenswürdig-selbstbezogene Art ihrem Traum von der Hausfrauen-Idylle hin und schaut sich spöttisch selbst dabei zu. Ihr ist voll bewusst, wie problematisch die tradierte Gleichsetzung von Frau und Mutter ist, und doch besteht sie auf ihr Recht, genau diesem Weiblichkeits-Ideal nachzueifern. "Ich will dieselbe Bestätigung, die andere Mütter haben. Das Gefühl, eine Frau zu sein, die ihren Platz in einer Familie hat. Diese Bestätigung ist bei Cis-Frauen okay, bei mir wird so getan, als wäre es pervers." Katrina wiederum zweifelt nach einer früheren Fehlgeburt, nach der die Trauer irgendwie ausblieb, ob sie überhaupt "muttertauglich" ist.

Interessante Bücher, dazu Interviews und ausgewählte Debatten-Beiträge aus dem Feuilleton - jeden zweiten Mittwoch in Ihrem Postfach. Kostenlos anmelden.
Peters traut sich aber auch die kritische Beobachtung der New Yorker trans Community
Die Frage nach dem Verhältnis von Mutterschaft und Geschlecht hat eine lange feministische Tradition: Während essentialistische Feministinnen eine biologisch bedingte und mystisch aufgeladene Gaia-Weiblichkeit als Gegenpol zum männlichen Individualismus vertreten, betonen Vertreterinnen eines materialistischen und queeren Feminismus die unterdrückerische Funktion des Mutter-Ideals. Die Philosophin Silvia Federici schreibt in ihrem Buch "Aufstand aus der Küche" darüber, wie die Naturalisierung von Fürsorge als dezidiert weibliche Qualität die tatsächliche Arbeit im Haushalt verschleiert. Andere Theoretikerinnen wie Eve Kosofsky Sedgwick betonen dabei die existenzielle Notwendigkeit, füreinander zu sorgen - gerade für queere Menschen, die, oftmals von ihren Herkunftsfamilien verstoßen, ganz neue familiäre Bande knüpfen müssen. Torrey Peters erzählt zum Beispiel von Reese als bereits mehrfacher "Mutter" für "trans Babys", wie sie frisch geoutete Freundinnen liebevoll nennt. Auch ihre Beziehung zu Ames, damals noch Amy, schwankt zwischen romantischer und elterlicher Liebe.
Peters beschreibt die queer-familiären Verflechtungen, ohne sie zu idealisieren. Sie lässt Ames darüber sinnieren, wie trans Frauen frühe Verletzungen in ihre aktuellen Beziehungen tragen, wie verwaiste Jung-Elefanten, deren Mütter von Wilderern brutal getötet wurden: "Am neuen Ort angekommen, in einer Savanne ohne ältere Tiere, taten sich die drei traumatisierten Elefanten in ihrem gemeinsamen Kummer und ihrer Trauer zusammen und übten Rache aneinander und an der Welt." Auch das Dreiergespann aus Ames, Reese und Katrina verfängt sich in emotionalen Fallstricken. Obwohl Katrina sich nach und nach für die Unkonventionalität des Eltern-Trios begeistert und sich davon einen Ausweg aus verkrusteten Hetero-Dynamiken verspricht, stolpern die drei über Ängste, Wunden und das Fehlen vorgelebter Lebensmodelle.
So wie sich Peters zum Thema queerer Wahlverwandtschaft keinen Illusionen hingibt, schreckt sie auch nicht vor einer kritischen Beobachtung der New Yorker trans Community zurück. Sie hat kein Twitter-Einmaleins zu befolgen, das für ein Cis-Publikum Do's und Don'ts gegenüber trans Menschen auflistet, sondern schreibt ausgehend von ihrer eigenen Erfahrung als trans Frau für eine queere Leserschaft - und für alle anderen, die keine pädagogische Heranführung erwarten. Diese Ehrlichkeit tut mitunter weh: Reese erkennt beispielsweise, wie ihr der gewalttätige Besitzanspruch eines männlichen Partners das Gefühl gibt, eine richtige Frau zu sein. Man kann aber auch darüber lachen, wenn etwa Ames beziehungsweise Amy sich am Anfang der Östrogen-Behandlung gegen die Aufbewahrung ihrer Spermien in einer Samenbank entscheidet, um mit dem Geld stattdessen ihr HBO-Abo zu bezahlen.
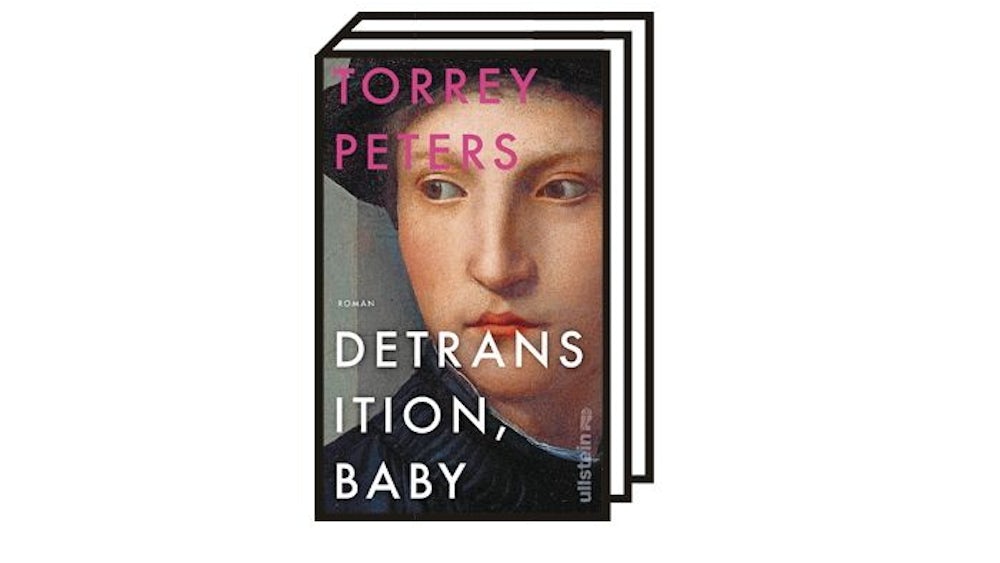
Dass Peters sich auch an unangenehme Themen wagt, zeigt sich besonders am Thema der Detransition, das schon den Titel stellt. Auf Deutsch so etwas wie "Rück-Transitionierung" bezeichnet der Begriff eine Gender-Biografie, in der auf die erste Geschlechtsangleichung eine zweite folgt, die die erste rückgängig macht. So wie bei Ames: Nach seinem Coming-Out als trans Frau mit Mitte Zwanzig bricht er ein paar Jahre später die Hormonbehandlung ab, ändert Namen, Pronomen und Garderobe wieder und lebt als Mann. Solche Geschichten werden von transfeindlichen Akteuren oft als Argument genutzt, um das Existenzrecht von trans Menschen in Frage zu stellen - offenbar bereuten sie ihre Transition ja früher oder später selbst.
Es sind allerdings nur wenige trans Menschen, die ihre Transition rückgängig machen. Und dass es für eine solche Entscheidung nachvollziehbare Gründe gibt, macht Peters durch ihren Protagonisten Ames verständlich. Er spricht von Verletzungen, Unsicherheiten und einer einschneidenden Diskriminierungserfahrung: "Danach fand ich es einfach beschissen zu hart, als trans Frau zu leben." Indem Peters das Zusammenspiel von Geschlechtsidentität, Gender-Performance und gesellschaftlicher Realität in seine verschiedenen Dimensionen auflöst, greift sie jeder polemischen Instrumentalisierung vorweg.
Und doch gab es hasserfüllten Reaktionen, als Torrey Peters für den Women's Prize for Fiction 2021 nominiert worden war. Ein offener Brief, unterschrieben von lebenden Schriftstellerinnen (und kurioserweise ein paar toten wie Emily Dickinson), misgenderte Peters konsequent und unterstellte ihr, die Institution für Frauenliteratur zu infiltrieren. Da war wieder der transfeindliche Mythos am Werk, als Frauen verkleidete Männer arbeiteten an der Unterdrückung "echter" Frauen. Wie diese Angstmache jeglichen Verständnisses für die Lebensrealitäten echter trans Frauen entbehrt, auch das zeigt Peters Buch.

