Wie alle begnadeten Dichter hat auch Manuel Vilas ein schwieriges Verhältnis zu den Wörtern. Einmal ist die Sprache alles, ein anderes Mal ist sie nichts. "Wenn man doch nur konkrete Zahlen statt ungenauer Worte hätte, um den menschlichen Schmerz zu beschreiben", so der seufzende Auftakt seiner "Reise nach Ordesa", des Buchs, das Vilas in Spanien über Nacht vom geschätzten Lyriker in einen international exportierfähigen Erfolgsautor verwandelte.
Dort tut Vilas das, was in der Weltliteraturproduktion der vergangenen Jahre beinahe zum guten, in jedem Fall aber zum gut verkäuflichen Ton gehört: Er erzählt stark autobiografisch vom Aufwachsen in der Provinz und Abstammen von "einfachen Leuten", von Entbehrungen und verspätetem Klassenbewusstsein, von funktionalem Analphabetismus und Engstirnigkeit.
Doch anders als vielen Kollegen geht es Vilas nicht darum, dem alten Leben den Rücken zu kehren oder die schambehaftete Vergangenheit mit der heutigen Existenz als Künstler zu versöhnen. In konzentrierten Kapiteln und aphoristischem Stil gerät ihm vielmehr noch das unscheinbarste Detail seiner Erinnerung zum Anlass für die poetische Wiederherbeizauberung einer verlorenen Welt. In deren Zentrum stehen fantastisch verzerrte, mit viel hintergründigem Humor und dabei glaubwürdiger Inbrunst ausgemalte Porträts der längst verstorbenen Eltern.
In der lyrischen Ersatzwelt, in der alles aus Sprache besteht, ergibt fast alles Sinn
Der Vater: ein disziplinierter Mann, der als Handelsvertreter in Aragonien Stoffe aus Barcelona vertreibt, immerzu gut gekleidet, asketisch und stolz, mit ausgeprägter Ader zum schlichten Genuss - "ein Dandy der Arbeiterklasse". Die Mutter: einfallsreich, couragiert, dramatisch, nicht weniger stolz als der Vater, die erste Frau, die im konservativen Heimatdorf der Familie ein Sonnenbad nimmt. Im Innern dieser lyrischen Ersatzwelt "Ordesa", in der alles aus Sprache besteht, ergibt fast alles Sinn. Außerhalb ihrer fast nichts.
Weil nun all das weit mehr mit Musik als mit der Prosa des Alltags zu tun hat und weil schon die Mutter mit größter Freude den Menschen und Dingen ihrer Umgebung neue Namen gab, leiht Vilas den Protagonisten seiner Erinnerungsoper die Namen berühmter Komponisten. Der Vater wird Bach, die Mutter zu Wagner. Der charismatische Onkel heißt Rachmaninow, "ein Wunderkind im Rückblick auf die Geschichte der Musik", die Söhne des Autors gemäß ihrer gegensätzlichen Temperamente Vivaldi und Brahms. Der Schmerz ist, dass Wagner, Bach und Rachmaninow nicht mehr leben. Die Hoffnung, dass sich das, was nicht mehr ist, in Gesang und melancholische Schönheit verwandeln lässt.
Mit "Was bleibt, ist die Freude" erscheint nun rechtzeitig zum Spanienschwerpunkt der Frankfurter Buchmesse ein zweiter Vilas-Titel in der hervorragenden deutschen Übersetzung von Astrid Roth. Wie sein Vorgänger ist auch der neue Roman ein Meisterstück der Verklärung des Gewöhnlichen. Er beginnt als das undatierte Tagebuch einer Lesereise: Mit dem Ordesa-Erfolg im Gepäck zieht Vilas von Lesung zu Lesung, trifft auf uralte Freunde des Vaters, die zu begeisterten Ordesa-Fanboys geworden sind, schreibt und schläft in Hotelzimmern, deren gestärkte Decken und Laken er so sehr liebt, wie er unter dem Rattern ihrer Heizungs- und Kühlapparate leidet.
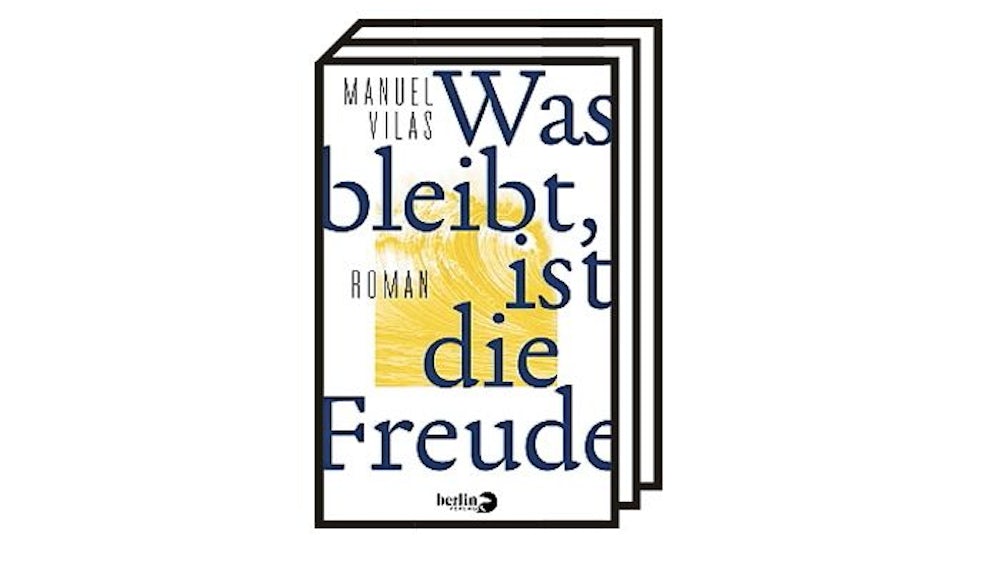
Sein ständiger Begleiter ist ein weiterer Gigant der Musikgeschichte: Arnold Schönberg, "der Erfinder des zeitgenössischen Lärms". Arnold ist offenkundig der Name für Vilas' Depression, "der Meister meiner Verwirrung, der Herr meiner emotionalen Instabilität", und doch auch viel mehr als das. Arnold ist der Geist der Mutlosigkeit, der hinter jedem menschlichen Unterfangen lauert und eine Wette auf dessen Scheitern abschließt. Arnold ist der große Gegenspieler der Freude, und er ist überall. Auch die Freude ist überall, aber niemals von Dauer. Die Freude ist das, was bleibt, wenn Arnold verschwindet. "Arnold verschwinden zu lassen, ist das einzige Ziel meines Lebens."
Ein Roman ist all das nur deshalb, weil man sich nie ganz sicher sein kann, was Erlebtes und was Fiktion, Fantasie oder Delirium ist. Ansonsten hat das Buch, das sich nach und nach als Ordesa-Fortsetzung entpuppt, nur wenig mit den aus Herkunftserzählung und Erinnerungsepos vertrauten Routinen zu tun. Bevor man daher Vergleiche mit Proust, Knausgård oder Édouard Louis anstellt, sollte man daher an Baltasar Gracián und Teresa von Ávila denken.
Im Bannkreis von Moralismus und Mystik formt Vilas aus winzigen Erinnerungsversatzstücken und Alltagsbeobachtungen eine verschrobene Klugheitslehre, deren Grundsätze allerdings keinem zur Nachahmung zu empfehlen sind. Vilas selbst greift, um das Gattungsrätsel zu lösen, auf den Begriff der Liturgie zurück, und tatsächlich beschreibt dieser verblüffend genau das Betriebsgeheimnis dieser Trost- und Reflexionsliteratur, die aus den Liturgien des "verzweifelten Geistes" ihres Autors einen Rosenkranz für die Gefühls- und Vorstellungswelten der Arbeiterklasse knüpft.
Was bleibt, ist die mikroskopische Freude an der flüchtigen Erinnerung
Zu dessen Perlen gehört die folgende Szene: Als Kind, erzählt Vilas, habe er nur zwei Dinge wirklich gekonnt: Schwimmen und Skifahren. Dementsprechend guten Mutes tritt er bei einem Kraulwettbewerb an, zu dem ihn der Vater angemeldet hat. Die ersten 50 Meter liegt er vorne, doch dann bricht er ein und wird am Ende nur Vierter. Die ersten drei kriegen Medaillen, der kleine Manuel geht leer aus.
Mit dem soziologischen Blick, auf den uns die autofiktionale Gemeinde eingeschworen hat, könnte man nun von vielem weitererzählen: vom toxischen Einfluss des Konkurrenzkampfes auf die Seelen der Kinder, von Bachs Neid auf die Väter der Sieger, vom vererblichen Schweigen zwischen Vätern und Söhnen. In gewisser Weise tut Vilas das auch, aber er tut es nur nebenbei.
Wichtiger ist ihm eine andere Entdeckung: "Das Unerhörte oder Ironische war, dass jene gleichaltrigen Kinder, die eine Medaille bekommen hatten, bei ihren Eltern keine Begeisterung auslösten, das fiel mir auf. Ihre Eltern waren einfach gleichgültig. Ich bemerkte, dass mein Vater anders war. Und dass diese Eigentümlichkeit uns sehr schaden konnte, etwas, das schließlich passierte und genau in diesem Moment passiert, wo ich diese Worte schreibe." Was bleibt, ist die mikroskopische Freude an der flüchtigen Erinnerung. Und der Trost der Entdeckung beim Schreiben, auch wenn diese Entdeckung in der Rückschau als Vorzeichen einer lyrischen Grundstimmung erscheint, mit der man es in der Welt, wie sie ist, wohl zu nichts bringen wird.
Bewältigen lässt sich dieses Programm nicht ohne den Mut zur Melodramatik
Das endlos variierte Thema dieses störrischen "Romans" ist die Suche nach jenem unwahrscheinlichen Rest an Freude, der bleibt, wenn Arnold einmal mehr besiegt worden ist, auch wenn es sich dabei nie um einen endgültigen, sondern immer nur um einen Pyrrhussieg handeln kann. Literarisch bewältigen lässt sich ein solches Programm nicht ohne den Mut, auch über längere Strecken in melodramatischem Marschland zu waten.
So ist es von einer bestechenden Folgerichtigkeit, wenn der Autor ausgerechnet während eines Venedig-Aufenthalts seine heiter-melancholische Welt der Komponistenseelen mit den Namen legendärer Hollywood-Schauspieler neu besetzt: Der geliebte Vater Bach wird im Handumdrehen zu Cary Grant, die Mutter Wagner zu Ava Gardner, die Söhne heißen nicht mehr Vivaldi und Brahms, sondern Marlon Brando und Montgomery Clift. Dazu kommt ein den Lesern noch unbekannter Gary Cooper, und auch die junge Gina Lollobrigida hat einen flirrenden Cameo-Auftritt. Musik- wird zu Kinogeschichte, das Tragische melodramatisch.
Natürlich darf da auch der gute Arnold nicht fehlen, der von nun an in die Rolle von Nosferatu schlüpft. "Eine denkwürdige Besetzung", wie Vilas sich mit geradezu überbordender Freude selbst zuruft, "ein Luxus der Kinogeschichte". In Wahrheit natürlich ein Luxus der Literatur, der im Innern der Vilas-Welt mit ihren schrulligen Gesetzen noch immer unendlich viel Sinn erzeugt und außerhalb ihrer fast keinen. Doch auch wenn es stimmt, dass einem der Sinn gegen Ende - im Leben wie in der Literatur - immer weiter entschwindet, muss niemand verzagen. Man weiß ja schließlich, was bleibt.

