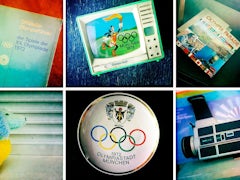Von Karl Clauss Dietel weiß man, dass er lieber Gestalter genannt werden wollte als Designer. Vielleicht weil ihm "Design" zu sehr nach Mode und Marketing roch. Vielleicht auch weil in der Begriffsfamilie von Gestalt und Gestaltung immer Dimensionen mit anklingen, die bis ins Philosophische und Psychoanalytische reichen. Höchstwahrscheinlich aber ganz einfach, weil es sachlicher klang.
Zu den vielen Dingen, die Dietel also nicht designt, sondern vielmehr gestaltet beziehungsweise, da oft ja Kollektivarbeit, mitgestaltet hat, gehörten tatsächlich viele aus der eher prosaischen Sphäre von Arbeit und Alltag: von Aufschnitt- über Schreib- bis zu Flachrundstrickmaschinen. Noch mehr geprägt haben seine Arbeiten lange Zeit das Gesicht des Straßenverkehrs. Das reichte von der Front des verbreitetsten Lkw bis zu Äußerem und Innerem des zweitverbreitetsten Pkw - jedenfalls in dem einen Teil dieses Landes. Denn dass es sich bei dem ersten um den sogenannten W50 handelte und bei dem zweiten um den Wartburg 353, wird vor allem denen etwas sagen und die entsprechenden Fahrzeuge vor Augen rufen, die noch die DDR erlebt haben.
Es gibt in dem weiten Werk dieses Mannes aber eine Arbeit, die hier vielleicht einmal besonders hervorgehoben werden darf, weil sie sich bis heute im Straßenbild auffällig vital behauptet, weil sie nicht nur die DDR überdauert, sondern nun auch seinen Gestalter. Denn das ist am Ende nicht nur eine Frage der Äußerlichkeiten, sondern auch eine des Prinzips. Nicht zufällig steht sie zurzeit nämlich auch in der großen Ausstellung "Deutsches Design 1949-1989 - Zwei Länder, eine Geschichte", die noch bis zum 20. Februar von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gezeigt wird, beinahe so feierlich als programmatische Zentralschönheit im Lipsiusbau auf der Brühlschen Terrasse wie die Nike von Samothrake im Louvre: eine Simson S 51 - die lackierten Teile hellblau wie ein Sommerhimmel.
Die Simson S 51 war eine Adoleszenz-Maschine, ein Wunsch- und Glücksapparat für den sechzehnten Geburtstag
Dieses Mokick aus dem VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk "Ernst Thälmann" in Suhl war faktisch eine von Anfang der Achtziger an produzierte Verfeinerung der Simson S 50, die Dietel schon Mitte der Siebziger gestaltet hatte. Aber inhaltlich war es unfassbar viel mehr als das, nämlich eine Adoleszenz-Maschine, ein Wunsch- und Glücksapparat für den sechzehnten Geburtstag.
Das lag natürlich auch daran, dass hier mit 50 Kubikzentimetern Hubraum schon 60 km/h zu haben waren. Und auf dem Umstand, dass ein Mokick mit so einer Motorisierung auch in zügigem Stadtverkehr mitschwimmen kann, ohne zu behindern, beruht ganz wesentlich auch die anhaltende Beliebtheit der DDR-Mokicks bis heute, nun selbst im Westen. Wo nämlich in der Bundesrepublik bei eher alltagsunpraktischen 50 km/h stur abgeregelt wurde, erging hier für die Altbestände eine Ausnahmeregelung - einer der wenigen Triumphe des Ostens im Einigungsvertrag. Neben dem grünen Pfeil und mancherorts auch dem Ampelmännchen mit dem Honecker-Hut waren diese Mokicks eigentlich die einzigen Übernahmen ins Stadtbild des gemeinsamen Landes. Dass dabei vor allem der Kleinroller 51, genannt "Schwalbe", aus den Sechzigerjahren besonders geschätzt wurde und wird, traf sich mit der Freude am Retro-Design seit den Neunzigern.
Aber als damals Dietels Simson S 50 auf die Straßen gerollt kam, blickten die Augen noch begeistert nach vorn. Die alten Schwalben galten damals als Vehikel von Landpostbotinnen oder Rentnern (zwei zusammengeschraubt ergaben nicht zufällig den "Krankenfahrstuhl Duo".) Der revolutionäre Unterschied glich dem zwischen einem altmodischen Badeanzug und einem Bikini - und zwar auch ganz formal: Wo vorher eine barock geschwungene Karosserie, meist in Ockerbraun, alles Technische üppig umhüllte, gab es bei Dietel nur noch zwei Dinge unter knappem Blechkleid, den Tank und ein bisschen weiteres Innenleben. Der wesentliche Rest, vor allem der Motor, lag frei zwischen diesen beiden stets in knallbunten Popfarben lackierten Amöbenformen, die wahlweise an Skulpturen von Arp oder Calder (kinetische Kunst!) denken lassen oder an Marshmallows oder halt an physischere Formen. Die "Simmi" galt nicht so sehr als "cool", sie galt, wie man damals in allen Bedeutungsschattierungen gern sagte, als "geil" - und das wurde einem Produkt aus heimischer Produktion (damaliger, durchweg mauliger Sprachgebrauch: "von uns") nun wirklich nur sehr, sehr selten mal attestiert.

Zwar sprachen Ältere wohl gelegentlich herablassend von "Zwiebacksägen", aber deren Motorräder, zum Beispiel die MZ 150 (die sogenannte "Hundertfuffziger" bzw. "Hu-Fu") waren ja von demselben Karl Clauss Dietel gestaltet und formal eigentlich eine Simson auf Steroiden: breiter, bulliger, stärker. Die brauchten aber einen Motorradführerschein und rochen vom Sitz einer jugendlichen S 51 aus schon verdächtig nach Armeedienst, Berufsstart, Heirat, also Grab.
Es war aber nicht nur pubertäre Ding-Erotik, die heranwachsende Mädchen und Jungen in Ostdeutschland an die Formen der Simson fesselten, dieser geschlechtsfluiden Maschinerie mit dem männlichen Heroennamen und dem weiblichen Artikel davor. Der andere wichtige Grund, warum die Simson S 51 am Ende sogar die tschechischen Jawas verdrängte (also doch auch Design als Marketingwaffe, sogar unter den Bedingungen des Ostblocks), der andere wichtige Grund also war die Basteltauglichkeit: Man konnte fast alles selbst reparieren. Man musste im Grunde nicht mal absteigen, um hier die Zündkerze zu reinigen.
Was unter den Bedingungen einer Mangelwirtschaft das Vernünftigste war, wäre es heute erst recht
Damit zu der Prinzipienfrage, die das alles aus den Gefilden kollektiver Jugenderinnerungen ins Heute hebt und zu einem immer noch dringend bedenkenswerten Modell für die Zukunft macht. Denn Dietel hat hier von "offenem Prinzip" gesprochen. Die gestalterische Trennung der einzelnen Baugruppen dient nicht nur ästhetischen Zwecken, sondern viel wesentlicher: praktischen und nicht zuletzt ökologischen. Man soll reparieren, anbauen, umbauen können, weitermachen - nicht wegwerfen müssen. Das war unter den Bedingungen einer Mangelwirtschaft damals ganz einfach das Vernünftigste, und das wäre es unter den Bedingungen, in denen sich die Welt heute befindet, eigentlich erst recht. Wer also etwa den diabolischen Service-Ferengis im Apple-Store 1000 Jahre Fronarbeit in einer zentralafrikanischen Coltan-Mine an den Hals wünscht, wenn sie einem weismachen wollen, dass ein erst zwei oder drei Jahre altes Gerät leider keinesfalls repariert werden könne, die Batterie nun einmal fest verleimt sei, alles auf der Stelle gegen ein nagelneues ausgetauscht werden müsse ..., der kann stattdessen in Zukunft auch beim Gedenken an Karl Clauss Dietel Trost suchen: Es ginge anders, man muss es nur wollen.
Am 2. Januar ist der Mann aus der Gegend von Zwickau, der noch viel mehr Fahrzeuge entworfen hat, die es nicht auf die Straße geschafft haben, darunter allein sieben oder acht Kleinwagen-Nachfolger für den Trabbi, im Alter von 87 Jahren daheim in Chemnitz gestorben.