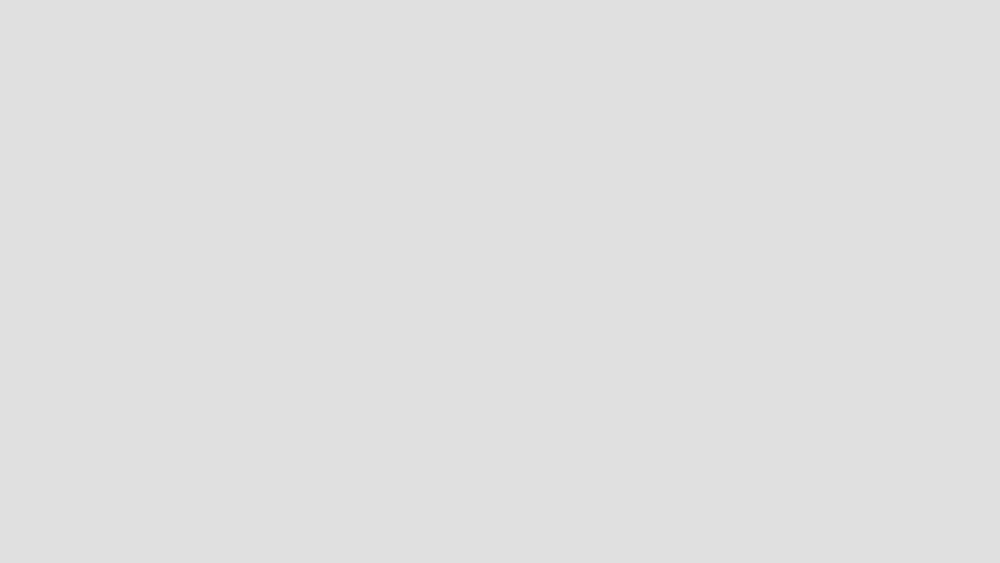Es ist eine bizarre Situation. Während draußen vor dem Kunstmuseum Wolfsburg zwei Schreihälse der NPD vor ihrem roten Wahlkampfwagen stehen und ins Mikrofon brüllen, dass Deutschland keine Fremdarbeiter braucht, sitzt innen ein kleiner bescheidener Mann mit einem lahmen rechten Arm und spricht vom Respekt der Kulturen. Dieser Mann hat 1979 verkleidet als Afghane den Widerstand gegen die russische Invasionsarmee dokumentiert und der Welt die ersten Bilder vom Beginn einer bis heute andauernden Kriegstragödie geliefert.
Eingenäht in seine Wäsche, schmuggelte Steve McCurry die Filme über die Grenze, um der Welt vom Kampf der Mudschaheddin gegen die sowjetische Besatzung zu erzählen. Seine Schwarzweißbilder von den eigentümlich gekleideten schönen Männern im Hinterhalt oder beim Vergnügen auf einer Schaukel im Lager verschafften den islamischen Kämpfern große Sympathien und machten McCurry zu einem der bekanntesten Fotoreporter der Welt.
Mehr als dreißig Jahre und viele weitere Besuche später versucht McCurry, die verfahrene Situation in Afghanistan gerecht zu beurteilen. Er erzählt von seiner Wut, als er am 11. September 2001 nach einem langen Aufenthalt in einem tibetischen Kloster vom Dach seines Apartmenthauses am New Yorker Washington Square Zeuge des Anschlags auf das World Trade Center wurde. Wenig später erlebte er in Kabul eine Armee netter Greenhorns aus Kansas mit Hightech-Waffen, die glaubten, man könne den Terrorismus "wie einen Käfer zertreten".
Als Kriegsfotograf hat er sich nie verstanden
Er kann sich als intimer Kenner der afghanischen Kultur das Urteil erlauben, dass die Vorstellung amerikanischer und europäischer Politiker, aus Afghanistan eine Demokratie nach westlichem Vorbild zu formen, genauso zum Scheitern verurteilt ist, wie die Idee der Russen, aus dem Land einen kommunistischen Vasallenstaat zu machen. Afghanistan sei "unkontrollierbar" und zwar erst recht, wenn man sich darin nur in gepanzerten Wagen mit aufgesetztem Maschinengewehr bewegt.
Für McCurry gab es eine exemplarische Situation, die er in einem berühmten Bild festgehalten hat, um das Dilemma der gut gemeinten westlichen Hilfe zur Freiheit zu belegen. In einem Ausbildungslager der afghanischen Armee steht ein amerikanischer Drill Sergeant und lässt einen Rekruten mitten im Winter durch den Schlamm robben. Für uns, so McCurry, ist diese Form der Disziplinierung bekannt und legitim, für einen afghanischen Bauernsohn, der sich von dem Job in der Armee eine respekteinflößende Uniform und etwas Geld erhofft, sei diese Prozedur eine unfassbare Ehrverletzung. Beim Anblick dieser Demütigung, so McCurry, habe er sich nur gewundert, dass der Junge "nicht sofort aufgestanden ist, um den Sergeant zu töten".
In der großen Retrospektive in Wolfsburg fehlt dieses Motiv. Obwohl die Bilder aus Afghanistan ein Drittel der rund 100 Prints umfassenden Rückschau liefern, konzentriert sich die Auswahl auf andere Aspekte in McCurrys riesiger Bildproduktion als die Konfliktfotografie.
Im Zentrum steht hier die außergewöhnlich farbenprächtige Ästhetik, für die vor allem McCurrys Asienfotos berühmt sind. Seine Fotoreportagen aus Krisengebieten wie Irak, Jugoslawien, Libanon oder Afghanistan werden zwar nicht unterschlagen, aber gesammelt in einer Schreckenskammer. Bildern verkohlter Soldaten, Öl trinkende Kamele vor den brennenden Anlagen Kuwaits nach dem irakischen Überfall oder jugendliche Landminenopfer an Krücken wirken in dieser Präsentation doch ein wenig marginalisiert.
Tatsächlich hat sich Steve McCurry nie als Kriegsfotograf verstanden, selbst wenn er für amerikanische Medien oder im Auftrag der Fotoagentur Magnum, deren Mitglied er seit 1992 ist, an Orte gereist war, die gerade von bewaffneten Konflikten verheert wurden. Aber als "Kriegsrandfotograf", wie er sich selbst bezeichnet, hat er sein Augenmerk doch lange Zeit auf die Folgen, die Agonie und die Traumata gerichtet, die Gewalt hinterlässt.
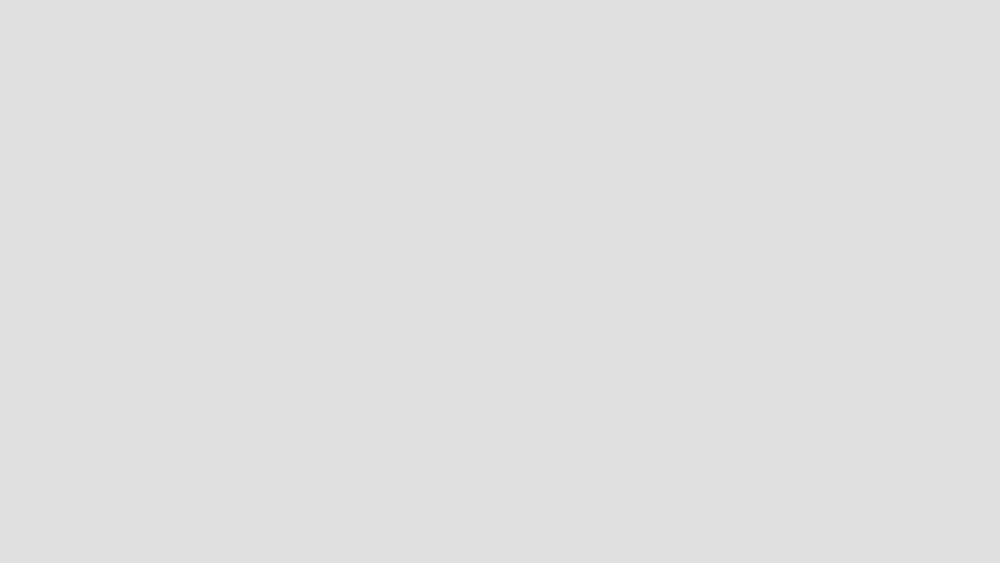
Aus dieser Haltung entstand auch das eine Foto, das mit McCurrys Namen mehr verbunden ist als sein gesamtes restliches Werk. Das Porträt der zwölfjährigen Sharbat Gula mit den strahlend grünen Augen und dem weinroten Umhang, das er 1984 in einem Flüchtlingslager in Peschawar aufgenommen hat. 1985 als Titelbild von National Geographic verwendet, wurde dieses Bild der Verletzlichkeit schnell zu einem der ikonografischen Porträts des 20. Jahrhunderts. Der misstrauische bis ängstliche Blick dieses schönen Mädchens entwickelte sich bald zu einem millionenfach publizierten Symbol für die Schrecken des Krieges, vergleichbar Picassos "Guernica" oder Goyas Stichen.
Wenn dieses Bild heute immer wieder als "Mona Lisa des 20. Jahrhunderts" verklärt wird, dann handelt es sich dabei natürlich um eine ästhetische Entschärfung des Motivs mangels Kontext. Doch den Zusammenhang hat McCurry selbst wieder hergestellt, als er Sharbat Gula als erwachsene Frau noch einmal aufspürte. Das Porträt der 30-jährigen Afghanin, die von ihrem Ruhm nichts wusste und die McCurry tatsächlich noch einmal unverschleiert fotografieren durfte, ist so verhärmt von Angst, Schmerz und Entbehrung, dass sie eher als eine Ikone der Gewalterfahrung Mitleid erregt. Besonders wenn beide Porträts nebeneinander hängen wie in Wolfsburg, wird die Geschichte Afghanistans zur mimischen Landkarte einer einzelnen Schmerzbiografie.
Die Hand des toten Soldaten ist ebenso malerisch dargestellt wie das tibetische Mädchen
Doch für McCurry, für den Reisen eine Art Sucht ist, die er neun Monate im Jahr vor allem in Asien befriedigt, war die Suche nach Schönheit stets ein mindestens ebenso wichtiges Bildprogramm. Vor allem in Indien, das 1978 McCurrys Asienliebe entfachte, ist er unentwegt auf der Suche nach Motiven, die das Klischee vom farbenprächtigen Halbkontinent bekräftigen. Unter Aussparung der schockierenden Motive, die der krasse Gegensatz von Reich und Arm in Indien jedem Besucher sofort offenbart, hat sich McCurry darauf verlegt, den gnädigen Schleier fröhlicher Buntheit über das Land zu legen.
Er fotografierte skurrile Schäfer mit kunstvoll frisierten hennaroten Bärten oder hüpfende Kinder in den blauen Gassen Jodhpurs, das strahlend weiße Taj Mahal mit qualmender Dampflok im Vordergrund oder einen ernsten Jungen, der sich zum Holi-Fest knallrot angemalt hat. Diese Dokumentation von Signalfarben, die für die Kuratoren in Wolfsburg den Anlass lieferte, McCurrys Reisefotos als Kunst zu präsentieren, nähert sich in ihrer Perfektion dann leider doch atmosphärisch jener Scheinheiligkeit, die opulente Prospektfotos in Reisekatalogen besitzen.
Natürlich würde sich der pittoreske Eindruck dieser Präsentation verändern, wenn die Balance in Steve McCurrys Arbeitsfeldern besser gewahrt wäre. Aber die Liebe zur klassischen Bildkomposition, sein Faible für Porträts, die verblüffend den Prinzipien der Renaissance-Malerei folgen, seine Konzentration auf Harmonie und Starkfarbigkeit verleihen tatsächlich auch seinen erschreckendsten Bildern den Eindruck des Arrangements. Die aus einem Ölfeld ragende Hand eines toten Soldaten ist ebenso malerisch im Bildrahmen proportioniert wie das rotbäckige tibetische Mädchen in der chinesischen Jacke. Hässliche Dinge werden von Steve McCurry nicht hässlich aufgenommen, sondern hochästhetisch. Die prägnante Schönheit seiner Bilder wirkt manchmal stark irritierend.
Dennoch kann man Steve McCurrys Suche nach einem würdevollen Abbild die Aufrichtigkeit nicht absprechen. Egal ob er den letzten Pirelli-Kalender mit sozial engagierten Fotomodels in den Favelas von Rio fotografierte oder einen schlafenden alten Mann im Bahnhof von Mumbai, man glaubt diesem zurückhaltenden Mann, der über sich selbst sagt, er sei eher schüchtern, sein Bemühen, den Menschen gerecht zu werden. Auf die Frage, ob er sich bei seiner Arbeit auch als Botschafter eines rücksichtsvollen Westens verstehe, wehrt er deshalb empört ab. Er wolle den Leuten als Gleicher begegnen, nicht als Botschafter. Aber ob er nicht doch ein Botschafter des gegenseitigen Respekts in beiden Welten sei, das bejaht er dann. Jedoch nur als "eine kleine Stimme".
Vielleicht liegt in dieser Bescheidenheit eines der namhaftesten Fotografen der Gegenwart die Ursache verborgen, warum Steve McCurry die Welt schöner dastellt, als sie ist. Denn wohin es führt, wenn man sie hässlicher darstellt, das konnte man in Wolfsburg in dem stumpfen Gegröle der NPD-Funktionäre hören, das Steve McCurrys Weltenbummler-Weisheit wie ein dauernder Misston untermalte. In der Verklärung verbirgt sich ein Respekt, der in der Verächtlichmachung völlig erstirbt.
Steve McCurry: Im Fluss der Zeit. Bis 16. Juni, Kunstmuseum Wolfsburg.