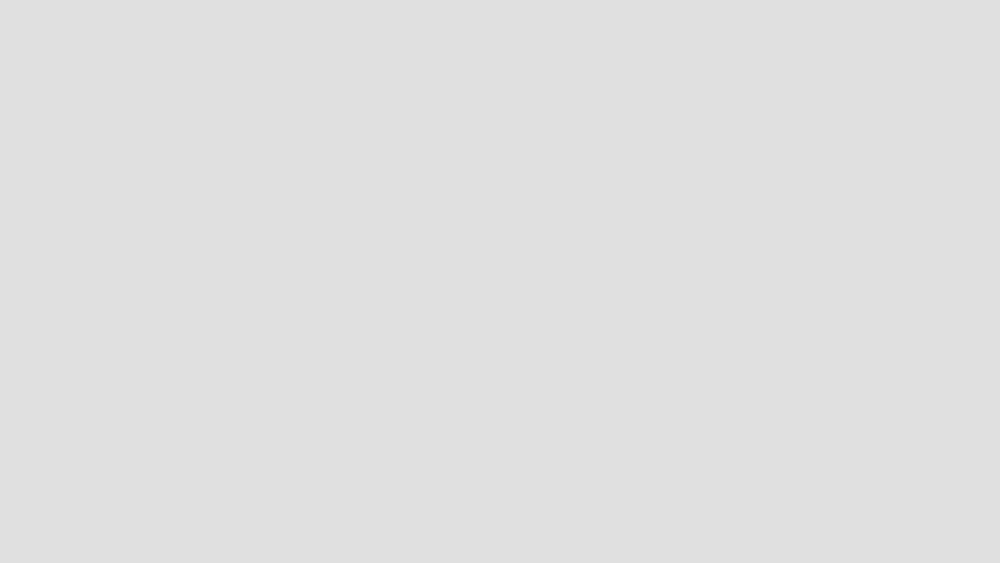In der mathematischen Welt der Zwanzigerjahre des vorigen Jahrhunderts wurde bewiesen, dass die Vorgänge in der physikalischen ebenso wie der biologischen Welt nur in eng definierten Ausnahmefällen mit Rechenmaschinen, auch Turingmaschinen genannt, berechnet werden können; es wurden die sogenannten "unberechenbaren mathematischen Funktionen entdeckt", die offenbar in unermesslicher Vielfalt existieren.
Herausragende Mathematiker wie Kurt Gödel haben damals der heutigen Erkenntnis eine Bahn gebrochen, dass Rechenmaschinen genau das nicht leisten können, was Menschen tagtäglich leisten; gemeint ist die kreative Bewältigung, Formulierung und Lösung von prinzipiell unberechenbaren Problemen und Erscheinungen, für deren Lösung beziehungsweise Verstehen es also keinerlei algorithmische, das heißt rezeptartige Regeln gibt. Wir erinnern auch an Joseph Beuys, der die Kreativität in jeder menschlichen Handlung erkannte und darauf seinen Kunstbegriff gründete.
Rechenmaschinen dagegen sind nicht kreativ, sie sind nicht fähig, intuitiv schöpferisch zu denken, sie können die Welt nicht in begrifflicher Sprache beziehungsweise begrifflichem Text beschreiben und keine Wissenschaft entwickeln. Rechner können menschliches Verhalten durchaus beobachten, kopieren und eventuell statistisch nachahmen bis hin zur Bildung von vernünftig erscheinenden sprachlichen Sätzen. Die Annahme aber, dass androide Roboter eines Tages den Menschen ersetzen oder gar die Macht ergreifen könnten, ist heute so unbegründet wie vor 100 Jahren.

Geistiger Rohstoff
Die Ursprünge menschlicher Kreativität liegen unbestreitbar in jenem intimsten Bereich der seelischen und geistigen Existenz eines Menschen, den man Privatsphäre nennt. Das Wesen der Privatheit erschließt sich, wenn man feststellt, wozu Maschinen nicht fähig sind und was allein der Mensch zu produzieren in der Lage ist. Der Mensch produziert private Entscheidungsdaten, die in kreativer Weise mit seinem Verhalten neu erschaffen werden. Der Mensch setzt damit geistigen Rohstoff in die Welt, der nicht von noch so leistungsfähigen Robotern produziert werden kann. Dieser geistige Rohstoff ist die größte und unversiegbare Quelle von Reichtum, des einzigen und wirklichen Reichtums, der allen Menschen von Natur aus als natürliches Eigentum mitgegeben ist.
Um die Nutzung dieses Rohstoffes ist ein Kampf entbrannt. Man ist an koloniale Zeiten erinnert, in denen der unerschöpflich scheinende Reichtum an Rohstoffen Afrikas mit Zustimmung der dortigen Landesfürsten von fremden Mächten ausgebeutet wurde, ohne dass die dortige Bevölkerung an den Erträgen teilhaben konnte. Europa ist bei der Nutzung des Rohstoffes der privaten Daten dabei, das Afrika des Informationszeitalters zu werden. Es wurde eine Enteignung in Gang gesetzt, die medial und ernst zu nehmend als Ende der Privatheit prognostiziert wird. Experten der Informationsindustrie diskreditieren das Recht auf individuelle Privatsphäre als "Auslaufmodell" mit dem Ziel, den geistigen Rohstoff, der von Menschen produziert wird, wenigen global agierenden Konzernen zu übereignen.
Die politisch unterstützte Strategie der IT-Industrie ist es, im gesamten Umfeld jedes Menschen Datenaufnahmegeräte zu installieren, die sein gesamtes Verhalten digitalisieren und die Daten in Richtung Datensammelzentren ins Internet einspeisen. Selbst die harmlosesten Gebrauchsgegenstände etwa zur Morgentoilette, in der Küche oder im Kinderzimmer werden mit einem Anschluss ans Internet ausgestattet. Wir befinden uns in der Phase des flächendeckenden Aufbaues der sogenannten "Welt der Dinge", in der Big-Data-Unternehmen die von Menschen produzierten Werte massenhaft abschöpfen. Die Kontrolle über Gebrauchsgegenstände bis hin zu Privatautos wird dem Besitzer entzogen. Er lebt zunehmend in einer geliehenen Umgebung, deren Funktionalität fremdbestimmt bleibt.
Tatsächlich aber ist zumindest ein "Ende des Privaten" nicht in Sicht. Im Gegenteil. Riesige Mengen des "geistigen Rohstoffes" werden durch massenhafte Abschöpfung von Verhaltens- und Entscheidungsdaten privatisiert. Andererseits setzt bekanntlich die neoliberale Ideologie auf die Privatisierung bislang öffentlichen Eigentums und will öffentliche Dienstleistungen auch im universitären Bereich privatisieren. Insbesondere ist das durch freie Wissenschaften entwickelte öffentliche Wissen Ziel von Privatisierung, wie Colin Crouch in seinem im Jahr 2015 erschienenen Buch gezeigt hat.
Die Behauptung, dass Privatheit ein Auslaufmodell wäre, ist eine absichtliche Täuschung. Sie besteht darin, dass das eingesammelte fremde Eigentum an privaten Daten nicht etwa der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt, sondern neuen Eignern zugeordnet wird. In Wahrheit wird Privateigentum massiv zentralisiert und schon gar nicht abgeschafft. Die neuen Besitzer schützen ihre Besitzstände vor Öffentlichkeit. Die Privatsphäre hochvermögender Kreise und Konzerne wird sehr wohl verteidigt. Unter den Augen maßgeblicher Politiker geschieht eine Umverteilung von Ressourcen, die der Bevölkerung nicht bewusst ist. Und die Bayerische Staatsministerin Ilse Aigner ist der Ansicht, dass die Leute ihre privaten Daten sowieso freiwillig abliefern würden, und fragt sich, was das Problematische beim Abgreifen der Daten sei. Alles in Ordnung?
Nein, keineswegs! Die Privatsphäre ist der Raum, in dem Kreativität und der Wille zur wirtschaftlichen Entfaltung produktiv werden kann. Der Schutz dieses Raumes ist die Voraussetzung der Teilhabe einer breiten Bevölkerungsschicht an einer funktionierenden sozialen Marktwirtschaft. Falls die Privatsphäre von Personen aufgelöst wird, gibt es keine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung mehr. Ein Gemeinwesen wird so in der Wurzel zerstört.
Die Privatsphäre ist nicht nur der Raum privater wirtschaftlicher Entfaltung, sondern auch der Raum einer seelischen und sozialen Entfaltung und Gesunderhaltung. Das Bewusstsein, ständig von unbekannten Institutionen beobachtet zu werden und gleichsam in einem Panoptikum zu leben, verändert die Verhaltensweisen von Menschen so gravierend, dass man das Ende der sozialen und kooperativen Gesellschaft voraussagen kann. Der exzessive Zugriff auf die komplette Privatsphäre einer großen Mehrheit von Staatsbürgern einerseits und die Verwundbarkeit unserer staatlichen Einrichtungen durch Spionage, Sabotage und Kriminalität andererseits sind Seiten ein und derselben Medaille. Unser Grundgesetz verpflichtet uns, die individuelle Privatsphäre und mithin die wichtigste Außengrenze, die es gibt, zu schützen.