Jüngst fragten die Macher eines Kurzfilms die Bewohner einer Einrichtung der Behindertenhilfe in Westfalen: "Wissen Sie, was Inklusion bedeutet?" In ihren Antworten variiert die Ratlosigkeit: "Weiß ich nicht, kenne ich nicht, nie gehört." Eine Umfrage unter der Laufkundschaft auf den Marktplätzen dieser Republik würde kein anderes Ergebnis haben. Mit anderen Worten: Kaum einer weiß, was Inklusion bedeutet.
Es gibt einen erlesenen Zirkel von sozial- und bildungspolitischen Akteuren der Parteien, Universitäten und Sozialverbände, für die klar zu sein scheint, was gemeint ist. Sie kennen die Behindertenrechtskonvention (BRK) der Vereinten Nationen von 2006, in deren Präambel steht, es gehe darum, "den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern". Die Konvention wurde im März 2009 auch von Deutschland feierlich in Kraft gesetzt; sie ist nun als Bundesgesetz in Geltung.
Wie merkt aber nun das Volk etwas von diesem Völkerrecht? Diese Frage hat einerseits eine juristische Dimension: So ist es zum Beispiel nach der Ansicht des Präsidenten des Bundessozialgerichts, Peter Masuch, völlig offen, ob aus dem geltenden Gesetz auch irgendeine Anwendbarkeit folgt, zum Beispiel ein einklagbares Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung.
Knappe Kassenlage
Die nationale Umsetzungspraxis leidet aber auch an der Kassenlage der öffentlichen Haushalte. Fast alle Landesparlamente haben Sparpakete beschlossen. Allein in diesem Jahr sollen in Nordrhein-Westfalen 150 Millionen Euro gekürzt werden. Die Politik aber macht sich unglaubwürdig, wenn sie zwar inklusionspolitischen Gestaltungswillen zur Schau stellt, für die Umsetzung aber die notwendigen Ressourcen nicht bereitstellt.
In Berlin meint der Inklusionsbeirat, es genügten drei zusätzliche Wochenstunden sonderpädagogischer Begleitung an Regelschulen - und schon können Kinder mit und ohne Behinderung dauerhaft gemeinsam lernen. Das ist ein beredtes Beispiel für diese Diskrepanz zwischen einer fulminanten Programmatik und ihrer fachlich desolaten, geradezu experimentellen Umsetzung.
Um von der finanziellen Ohnmacht abzulenken, greift die Politik zur rhetorischen Figur des Appells. Die zivilgesellschaftlichen Akteure, die Bürgerinnen und Bürger also, sollen sich einsetzen für eine Kultur der Anerkennung und der Gastfreundschaft. Es soll also der Bürger richten, was er erstens vermutlich noch gar nicht verstanden hat und was zweitens rechtlich reichlich unbestimmt bleibt.
Es geht, wie der Landesaktionsplan in NRW formuliert, um eine "Verinnerlichung des Inklusionsprinzips im Denken und Handeln sowie in den Einstellungen der verantwortlichen Menschen" - und um deren "Haltung". Das ist natürlich nie verkehrt. Das alltägliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung ist in Deutschland keine Normalität. Aber der Appell ans allgemein Menschliche genügt nicht, wenn die Inklusion eine Realität der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse werden soll.
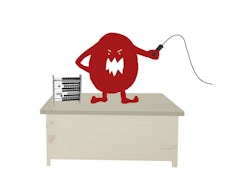
Durch deutsche Schulen geistern nicht nur hochmotivierte Fachkräfte, sondern auch viele anstrengende Lehrer-Typen. Autor Malte Pieper hat die zehn häufigsten ausgemacht.
Der Appell ans Gewissen als Ersatz für zusätzliche Lehrer, Erzieher, Psychologen, Schulräume - das ist, was der Jenaer Soziologe Stephan Lessenich die "Neuerfindung des Sozialen" genannt hat. Statt in Strukturen zu investieren, wird moralisierend an die Bürger appelliert: Sie sollen sich aktivieren lassen und mehr Verantwortung übernehmen. Ob das Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderung gelingt oder nicht, das wird in falsch verstandener Subsidiarität nach unten delegiert: Die Eltern, und Lehrer, die Einrichtungen der Behindertenhilfe und die Kommunen sollen es richten.
Dort haben sich die Beteiligten aber eher mit Exklusionstendenzen herumzuschlagen, beispielsweise im Umgang mit schulmüden Jugendlichen, die nicht selten aus dem Schulbetrieb entfernt werden. Viele, die jetzt das Inklusionsgesetz kritisieren, wollen sehr wohl eine inklusive Gesellschaft. Allerdings soll diese Gesellschaft auch eine klare Vorstellung davon haben, was das bedeutet - und was nicht.
Es dient zum Beispiel nicht jede Auflösung einer stationären Einrichtung zugunsten von ambulanten Wohn- und Betreuungssystemen per se der Inklusion, insbesondere dann nicht, wenn der Raum, in dem dann ambulant versorgt und betreut wird, marode ist oder die Kommune kaum in der Lage, die Erfordernisse der öffentlichen Daseinsvorsorge zu erfüllen. Es ist auch die Schließung einer Förderschule längst noch kein Akt der Inklusion, wenn anschließend die Regelschule den Kindern mit und ohne Behinderung nicht die Bedingungen für individuell erfolgreiches Lernen bietet.
Inklusion heißt nicht, Menschen mit Behinderung in ein ansonsten gleichbleibendes System des Bestehenden einzubinden. Inklusion ist der kritische Maßstab, der das bestehende System darauf hin befragt, wie es sich ändern muss, damit behinderte und nicht behinderte Kinder zusammen lernen können. Es genügt nicht, den Duft der Inklusion auf alle politischen Handlungsfelder zu wedeln. Glaubwürdig wäre es hingegen, einen Bereich inklusionspolitisch durchzugestalten, zum Beispiel die Schulpolitik.
Personenzentrierte Pädagogik versus Effizienz-Anspruch
Inklusion hieße dann: deutlich kleinere Klassen, ein höherer Personalschlüssel, mehr sonderpädagogisches Fachpersonal, Fort- und Weiterbildung für das Lehrpersonal der Regelschule, eine grundsätzliche Überarbeitung der Curricula an den Hochschulen, schließlich erhebliche Investitionen in Schulgebäude und didaktisches Know-how.
In den Schulen muss dann der Widerspruch aufgelöst werden zwischen der eher personenzentrierten Pädagogik der Förderschulen und der auf Effizienz und Disziplin ausgerichteten Pädagogik der Regelschulen, sonst werden die Schülerinnen und Schüler, um deren Inklusion es besonders geht, die eigentlichen Verlierer. Bisher sind Schulen auf Leistung, Konkurrenz und Erfolg hin orientiert, die schulische Laufbahn ist die erste Etappe auf dem Weg zum Erfolg. Hier wäre eine grundlegende Schulreform nötig. Doch Kosten und Mühe wären lohnend, denn hier geht es um die Zukunft unserer Gesellschaft.
Der französische Historiker Robert Castel hat davor gewarnt, sich um die Folgen der Exklusion nur in technischer Weise zu kümmern - also auf einen Trick, eine Methode zu hoffen, um die Ausgeschlossenen wieder in die Gesellschaft zu holen. Dabei sei die Beseitigung von Exklusion eine politische Angelegenheit. Ja, Inklusion ist ein politisches Thema. Der Appell an die Herzen, die Gemüter und das Repertoire sozialpädagogischer Techniken wird den Herausforderungen nicht gerecht.
Der Pfarrer und studierte Philosoph Uwe Becker, 53, ist Vorstand der Diakonie Rheinland-Westfalen Lippe, dem größten evangelischen Sozialverband mit 4900 Einrichtungen und 130.000 Mitarbeitern.
