Am Morgen des 24. Juni 2016 verschläft eine Niederbayerin ihre eigene Revolution. Gisela Stuart - so erzählt sie es - steigt völlig übermüdet in den Zug nach London und nickt ein. Als sie aufwacht, hat sie auf dem Handy eine SMS ihres Sohns. Er klingt fassungslos. "Holy shit, mother! Du hast uns aus der EU geführt, den Premierminister gestürzt und Milliarden an der Börse vernichtet. Was hast du morgen vor?"
Fast zwei Jahre später sitzt die Revolutionärin in einem Café in München-Schwabing, vor sich eine Tasse Kaffee; wer eine lautstarke Populistin erwartet, wird enttäuscht. Stuart spricht leise, beinah zurückhaltend. Ihr Deutsch hat einen britischen Einschlag, wenn ihr ein Wort fehlt, wechselt sie ins Englische. Das Bairische allerdings geht ihr flüssig von den Lippen. Stuart verweigert sich klassischem Schubladendenken. Sie ist Bayerin und Britin, Buchhändlerin und Politikerin, Migrantin und Zuwanderungsskeptikerin. Einst arbeitete sie an der EU-Verfassung mit, dann organisierte sie die sogenannte Leave-Kampagne mit, die für einen Austritt Großbritanniens aus der EU warb. Sie war die einzige hochrangige Labour-Parlamentarierin, die die Initiative unterstützte - und maßgeblich daran beteiligt, dass die Brexit-Befürworter bei der Abstimmung den Sieg davontrugen.
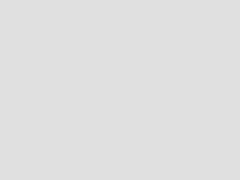
Höfliche Reaktionäre, eine Hinwendung zur Ästhetik der 30er und 40er und Kochbücher, die sich am Weltkriegs-Warenangebot orientieren: Wie die Briten im Brexitrausch dem eigenen Mythos verfallen.
Stuart hat einen weiten Weg hinter sich, von Velden, Landkreis Landshut, nach Westminster Abbey und zurück. Geboren 1955 als Gisela Gschaider, wächst sie im Ortsteil Stockham auf. Ein typischer Weiler, so klein, dass es weder Kirche noch Wirtshaus gibt. Später macht sie eine Ausbildung zur Buchhändlerin. 1974 zieht es sie nach Großbritannien, sie will ihr Englisch verbessern; in Niederbayern denken alle, sie käme in ein paar Monaten wieder.
Doch Gschaider heiratet, wird Stuart, Mutter, Britin und 1997 die erste gebürtige Deutsche im Parlament. Den Wahlkreis Birmingham Edgbaston nimmt sie den konservativen Torys ab, die seit 1898 das Direktmandat halten. Anfang der 2000er schickt Parteichef Tony Blair sie in einen Konvent, welcher einen europäischen Verfassungsvertrag ausarbeiten soll. Der Beginn ihrer politischen Karriere. Und ihrer EU-Skepsis. Im Parlament sitzt sie inzwischen nicht mehr, bei den Wahlen 2017 trat sie nicht an.
Stuarts Kritik speist sich aus dem, was die Politikwissenschaft mit dem Terminus "Demokratiedefizit" versehen hat. Dazu zählt zum Beispiel, dass sich das Prinzip einer Opposition in den EU-Institutionen nur eingeschränkt wiederfindet; das System ist konsensorientiert angelegt. Auch Stuart sagt, dass sie die "Checks und Balances" vermisse, wie sie etwa der britische Parlamentarismus hervorgebracht habe. Viele Jahre habe sie vergebens versucht, die EU zu reformieren. In der Leave-Kampagne aber habe sie sich vor allem aus einem Grund engagiert: "Ich wollte nicht, dass es eine Volksbefragung gibt, bei der Ukip die führende Kraft ist." Ukip steht in der britischen Parteienlandschaft weit bis sehr weit rechts.
Stuart muss los, sie ist zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Das Thema, klar: Brexit. Es ist ein kurzer Fußmarsch zur Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Unterwegs kehrt sich das Frage-Antwort-Spiel um, Stuart ist neugierig: Wie viele Menschen inzwischen in München lebten? Wie hoch die Mieten seien? Wie viele Schüler in Bayern jedes Jahr an die Uni gingen? Stuart kommt, anders als die meisten EU-Skeptiker, weder von politisch ganz links noch rechts; sich selbst bezeichnet sie als Sozialdemokratin.
Im Saal der Akademie steht die Luft, die Diskussion auch. Die Meinungen liegen teils weit auseinander. Stuart wiederholt ihre Position zum Zustand der EU. Als Teilnehmerin des Verfassungskonvents habe sie sich für eine Demokratisierung des Systems ausgesprochen - unter anderem für einen Mechanismus, mit dem Macht nach Brüssel nicht nur zu-, sondern auch abwandern könne. Auch wenn Stuart es nicht so sagt, ergibt sich für sie daraus ein einfacher Umkehrschluss: Wenn sich das System nicht reformieren lässt, ist es besser, das System zu verlassen.
Nicht alle in der Runde schauen überzeugt. Ob es nicht besser sei, die Probleme von innen heraus zu lösen? Das Gespräch dreht sich in Richtung Migration weiter. Ein Aufregerthema. Dass sich durch einen EU-Austritt der Zuzug nach Großbritannien begrenzen lassen könnte, spielte im Referendum eine große Rolle. Stuart wehrt sich. Es gehe nicht um Begrenzung, sondern um Kontrolle. Außerdem halte sie es für fragwürdig, junge Menschen aus anderen Ländern zu holen, damit sie in der Pflege oder im Kindergarten zu Niedriglöhnen Jobs verrichteten, die Briten selbst nicht machen wollten. Wieder schauen nicht alle überzeugt.
Zeit für Publikumsfragen. Ein Brite meldet sich. Seit 40 Jahren lebe er in Bayern, "in der Zeit habe ich einiges für die britisch-deutsche Freundschaft getan, hoffentlich". Beim Brexit-Referendum habe er nicht mit abstimmen dürfen - das sahen die Wahlbedingungen nicht vor. Unter Exil-Briten wie ihm gehe seitdem "eine große Wut" um, sagt er: "Ich akzeptiere das nicht!" Vom mehrheitlich deutschen Publikum erhält er großen Applaus. Bald darauf ist die Veranstaltung zu Ende.
Am nächsten Tag geht es für Stuart zurück nach Birmingham. Als was fühle sie sich denn, die Frage kam beim Kaffee auf: als Europäerin, Bayerin, Britin? "Was ist das für eine Frage", sagt sie. "Die Schweizer sind auch Europäer." Alles andere hänge vom Kontext ab. Stuart erzählt, wie sie mal mit einer Delegation Papst Benedikt im Vatikan besuchte. Angekündigt waren sie als Briten, Stuart grüßte als Bayerin: "Also, des gfreit mi, dass mir heut da sind." Benedikt stutzte: "Ja, gibt's denn so was?" Stuart: "Ja, so was gibt's."

