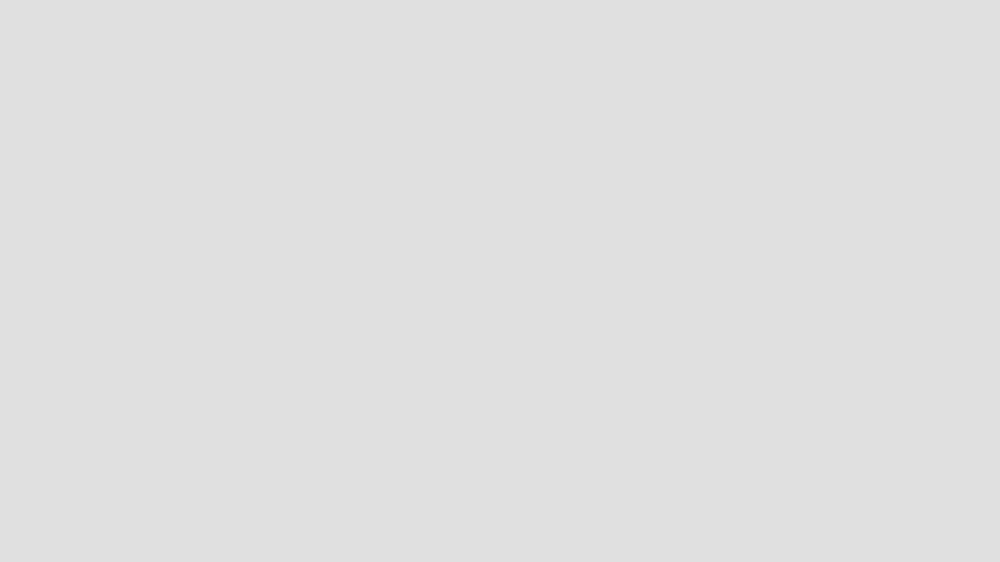Die seltsamen Dinger lagen schon vor Spitzbergen und Hawaii, vor Gran Canaria und Tvärminne in Finnland. Wer sich ihnen mit dem Boot nähert, könnte sie für Rettungsinseln auf Stelzen halten: Sechs orangefarbene Säulen ragen aus dem Wasser und tragen ein halbrundes Kunststoffdach. Darunter hängt eine milchige Folie. Sie bildet einen Schlauch von 2,5 Metern Durchmesser, der im Wasser verschwindet.
"Mesokosmos" haben die Wissenschaftler vom Helmholtz-Forschungszentrum Geomar in Kiel ihre Konstruktion genannt. Sie studieren darin die Effekte der Ozeanversauerung auf Plankton und Fischlarven. "Wir lassen den Folienschlauch 20 Meter tief ins Wasser fallen, und schneiden so quasi 55 Kubikmeter Meerwasser aus", sagt Geomar-Forscher Ulf Riebesell. "Fische oder Quallen werden beim Befüllen von einem feinen Netz am Boden zurück gehalten. Danach verschließen wir den Schlauch dort und isolieren den Inhalt."
Riebesell hat in den vergangenen acht Jahren das Verbundprojekt "Bioacid" koordiniert, an dem insgesamt 20 Universitäten und Institute beteiligt waren. In ihren neun Mesokosmen haben die Wissenschaftler die eingeschlossenen Lebewesen nicht nur beobachtet, sondern auch manipuliert. Der Kohlendioxid-Gehalt des Wassers wurde auf verschiedene Werte zwischen dem heutigen und dem möglichen Stand am Ende des Jahrhunderts eingestellt. In einigen Schläuchen war das Milieu damit so angesäuert, wie es wohl künftig im Ozean sein wird.

Den Ozeanen geht der Sauerstoff aus, warnen Forscher. Im Meer gibt es regelrechte Todeszonen.
Meeresversauerung wird gelegentlich verschämt "das andere CO₂-Problem" genannt, oft steht es im Schatten der Erwärmung. Durch den Klimawandel ist der pH-Wert des Ozeanwassers von 8,2 auf 8,1 gesunken. Das klingt nach wenig und ist noch deutlich im alkalischen Bereich, doch der Säuregehalt des Wasser ist um 30 Prozent angewachsen. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte der pH-Wert 7,7 erreichen, dann bekämen die Hälfte aller Muscheln, Schnecken und Korallen sowie viele kalkbildende Algen große Probleme, Schalen, Panzer und Skelette aufzubauen.
Andererseits profitieren manche Arten des Planktons, wenn mehr CO₂ im Wasser ist, das sie für die Photosynthese brauchen. Das kann die Futterversorgung anderer Lebewesen verbessern. Welche Folgen die widersprüchlichen Einflüsse auf die globalen Nahrungsnetze haben, ist noch nicht im Detail abzusehen. Sie dürften aber deutlich zu spüren und in der Summe negativ sein.
Die Menge an Kabeljau im Nordatlantik könnte um drei Viertel zurückgehen
"Die Artenvielfalt wird deutlich abnehmen, wir verlieren Schlüsselarten vieler Ökosysteme", warnt Riebesell. Das Tempo der Veränderung lasse Lebewesen kaum eine Chance, sich evolutionär anzupassen. "Die künftigen Ozeane erbringen auch uns nicht mehr die gewohnten Dienstleistungen", sagt der Kieler Forscher. "Vor allem Nahrung im selben Umfang zu liefern und ein Drittel des ausgestoßenen Kohlendioxids zu absorbieren."
Oder einfach nach Meer zu riechen. Dafür ist eine Substanz namens Dimethlysulfid verantwortlich, die unter anderem von der nur unter dem Mikroskop sichtbaren Alge Emiliania huxleyi gebildet wird. Ehux, wie viele Forscher sie nennen, lebt als Einzeller überall im Ozean, betreibt Photosynthese und umgibt sich mit Kalkplättchen. Regelmäßig im Frühjahr beherrscht sie das Meer. Vom Satelliten aus sind dann Tausende Quadratkilometer milchig-türkisen Wassers zu sehen, wo Myriaden von Ehux alle Nährstoffe verzehren, bis die Blüte nach eine paar Wochen endet.
"Laborexperimenten zufolge braucht die Alge im sauren Wasser mehr Energie für den Panzer und wächst zehn Prozent langsamer", sagt Riebesell. "So schlimm ist das nicht, dachten wir uns. Aber im Mesokosmos vor Bergen in Norwegen zeigte sich, dass Emiliania huxleyi so nicht mehr mithalten kann: Die Blüte fiel sogar aus." Verliert die Alge ihre Stellung im Nahrungsnetz, gerät vieles ins Rutschen. Bisher nimmt sie bei ihrem Tod viel Kohlenstoff mit in die Tiefe, außerdem dient sie anderen Lebewesen als Nahrung.
Ähnliche Geschichten erzählen die Forscher über Fischlarven. Für Kabeljau-Nachwuchs zum Beispiel halbiert sich die Überlebensrate bei einem pH-Wert von etwa 7,7, sagt Catriona Clemmesen von Geomar. Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse und Augen zeigen Schäden, im ganzen Körper greifen Enzyme nicht mehr richtig ineinander. Überleben die Fische diese Phase, müssen sie zusätzlich höhere Temperaturen, Sauerstoffarmut, Verschmutzung und Rückgang ihrer Nahrung bewältigen. Die Probleme, sagen Forscher, addieren sich nicht nur, sie multiplizieren sich. Am Ende könnten die Kabeljau-Bestände im Nordatlantik auf ein Viertel heutiger Zahlen zurückgehen; in der westlichen Ostsee, wo der Fisch als Dorsch bekannt ist, bliebe vielleicht ein Zwölftel übrig.
Probleme bekommen auch Arten, die für andere den Lebensraum vorbereiten. Ein Beispiel ist der Blasentang in der Ostsee, der Steine und Felsen an der Küste besiedelt und zum Heim für Krebse, Muscheln und Algen wird. Versauerung und Erwärmung des Wassers schwächen sein Immunsystem, auf ihm siedeln sich vermehrt Algen an. Die Tiere, die sie abgrasen, kommen wegen der erhöhten Temperaturen nicht nach, so dass der Tang schließlich erstickt.
Die Hälfte der Korallenriffe droht zu verschwinden, geht die Erderwärmung so weiter
Bei den Korallen gibt es ein gemischtes Bild. Bei Kaltwasserkorallen kompensieren wärmere Temperaturen zunächst die Probleme mit dem saureren Wasser. Ihre tropischen Verwandten sind schlechter dran: Viele der Polypen, die ihr Skelett auf einem Riff verankern, stoßen bei Stress die Algen aus, mit denen sie in Symbiose leben. Sie verlieren damit ihre Farbe und 90 Prozent ihrer Nährstoffe. "Dieses ,Bleaching' wird durch eine Kombination von Erwärmung und Versauerung gefördert", sagt Hans-Otto Pörtner von Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, der ebenfalls am Bioacid-Projekt beteiligt war. Um auch nur die Hälfte der tropischen Riffe zu erhalten, stellen seine Kollegen und er fest, müsste die Erwärmung der Erde auf 1,2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzt werden. Das ist vermutlich illusorisch: Etwa ein Grad ist schon erreicht, und auch das ehrgeizigere der Ziele des Pariser Vertrags fordert nur ein Limit von 1,5 Grad.
Viele dieser widersprüchlichen Details verstellen den Forschern zufolge den Blick auf das Gesamtbild. Den Ozeanen steht in den kommenden Jahrzehnten eine dramatische Veränderung bevor, wie es sie in der Erdgeschichte noch nie gegeben hat. "Was früher Zehntausende Jahre dauerte, geschieht jetzt in Hundert", sagt Ulf Riebesell. Niemand sollte sich darauf verlassen, dass sich das fein austarierte Geflecht des Lebens im Wasser der rapiden Veränderung problemlos anpasst.