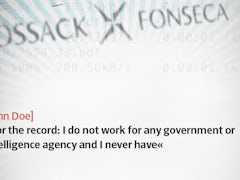Als es richtig eng wurde, fragte Rainer Moormann seine Frau, ob er weitermachen soll. Das war im Jahr 2007, da wies Moormann schon seit einem Jahr auf ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem im Forschungszentrum Jülich hin. Moormann, zuständig für die Überprüfung von Reaktorsystemen am Institut für nukleare Sicherheitsforschung, hatte festgestellt, dass die bis dahin populären Kugelhaufenreaktoren nicht ausreichend gesichert waren: Ein Leck im Reaktor würde ausreichen, damit der radioaktive Staub im Innenraum des Reaktors austritt.
Moormanns Kollegen und Vorgesetzte hielten seine Warnungen für Quatsch. Doch er stocherte weiter und erneuerte seine Vorwürfe, nachdem ihm seine Frau ihre Unterstützung zugesagt hatte. Das hatte Folgen: Kollegen bezeichneten Moormann als verrückt, seine Arbeitsgruppe wurde aufgelöst, im Büro saß er plötzlich allein. Der promovierte Chemiker wurde von einer Stelle auf die andere geschoben.
Moormann, heute 66, ist ein Whistleblower, jemand, der in eine Warnpfeife bläst (englisch: to blow the whistle), um einen Missstand aufzudecken oder Schlimmeres zu verhindern. Und er ist einer von vielen, die deswegen erhebliche persönliche Konsequenzen ertragen müssen: von Mobbing über Rufschädigung bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes, finanzielle Einbußen inklusive. Das bekannteste Beispiel eines Whistleblowers ist Edward Snowden, der brisante Geheimdienstdokumente weitergab und nun seit drei Jahren im Exil in Moskau sitzt, um einer Gefängnisstrafe in seinem Heimatland USA zu entgehen. Die Weitergabe von geheimen Informationen ist in der digitalen Welt immer einfacher geworden, und wird damit auch für Unternehmen zu einem großen wirtschaftlichen Risiko. Es geht um viel Geld.

Eine geheimnisvolle Hacker-Gruppe veröffentlicht die Bauanleitung für Spionage-Werkzeuge der NSA. Edward Snowden vermutet, dass der Kreml den USA drohen will.
Beim Landeskriminalamt in Baden-Württemberg können Hinweise anonym gegeben werden
Nach wie vor sind Whistleblower weitgehend ungeschützt, auch in Deutschland. Anfang Juni hatten die Justizminister der Länder bei ihrer Frühjahreskonferenz in Nauen an die Bundesregierung appelliert, die rechtlichen Möglichkeiten zum Schutz von Whistleblowern zu prüfen. Angesichts der Verurteilungen im LuxLeaks-Skandal werden inzwischen Schutzgesetze für die Hinweisgeber gefordert (siehe " Arm und schutzlos" ).
Aber denken Hinweisgeber bereits beim ersten Alarmschlagen an rechtliche Folgen? Und können bessere Gesetze Whistleblowing sogar fördern? Für den Juristen Nico Herold ist das der zweite Schritt vor dem ersten. Er sagt: "Wenn man Whistleblowing gezielt stimulieren und über das Aufdeckungspotenzial der Informanten Bescheid wissen möchte, muss man ja erst mal wissen, warum machen sie das überhaupt und wie verläuft der Entscheidungsprozess."
Herold ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie der Ludwigs-Maximilians-Universität München. Für seine Doktorarbeit befragte er 28 Whistleblower zu ihren Motiven und ihrem Vorgehen. Je nach Persönlichkeitstyp unterscheidet sich dabei das Empörungspotenzial. Während der rational-pragmatische Typ einen Missstand als objektive Problemstellung begreife, die man eben lösen müsse, ist der ethisch-proaktive Typ deutlich emotionaler im Sinne von "Da muss man doch was machen", erklärt Herold. Im Vorgehen stimmen die Befragten überein: fast immer erst intern und möglichst fallnah. "Das heißt, sie gehen zum Vorgesetzten, sprechen mit Kollegen und versuchen auf möglichst kurzem Weg, das Problem anzugehen", sagt Herold. Die Hemmschwelle sei gegenüber externen Meldestellen wie Strafverfolgungsbehörden und Medien groß. "Das hat auch etwas mit Fairness zu tun: Ich spreche das erst mal intern an", so Herold.
Auch Rainer Moormann informierte zuerst seinen Vorgesetzten und den Vorstand des Forschungszentrums, als er die Gefahr in der Reaktortechnik erkannte. "Ich war ja noch Teil des Systems und versuchte, etwas zu ändern", sagt Moormann, "bis 2008 habe ich mich strikt an die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber gehalten. Ich wollte formalrechtlich nicht angreifbar sein."
Das ist tatsächlich ein Vorwurf, der Whistleblowern häufig gemacht wird: dass sie gleich an die Öffentlichkeit gegangen sind und dem Arbeitgeber keine Chance gegeben haben, das Problem selbst zu beseitigen. Diese Forderung ist vom Arbeitsrecht abgedeckt, sagt Klaus Hennemann, ehemaliger Arbeitsrichter und Mitglied im Beirat des Vereins Whistleblower-Netzwerk: "Bevor man jemanden wegen eines gravierenden Missstands nach außen, also in der Öffentlichkeit, anprangert, muss man sich immer erst mal intern um Abhilfe bemühen - es sei denn, das wäre unzumutbar."
Was zumutbar ist oder nicht, wird vor Gericht und im Einzelfall bewertet. Ist der eigene Vorgesetzte in ein Korruptionsgeflecht verwickelt, dürfte klar sein, dass er als Ansprechpartner für einen Hinweisgeber ungeeignet ist. Doch wer an Unsauberkeiten im Unternehmen beteiligt ist, ist für Whistleblower nicht immer erkennbar. Ob sie ihre Hinweise an der richtigen Stelle abgeben und ernst genommen werden, wissen sie erst, nachdem sie Alarm geschlagen haben.
Wie wertvoll die Informationen von Insidern sind, weiß Jürgen Steck, Erster Kriminalhauptkommissar im Landeskriminalamt Baden-Württemberg. In seiner Inspektion 330, zuständig für die Ermittlung von Korruption und Amtsdelikten, betreiben die Beamten seit September 2012 das Business Keeper Monitoring System (BKMS), ein anonymes Hinweisgebersystem. Allein bis zum Jahresende 2015 erhielten sie 625 Hinweise auf Korruption und Wirtschaftskriminalität. Knapp 90 Prozent der Informationen stuften die Ermittler als prüfungswürdig ein. "Wir waren selbst gespannt, wie sich das entwickeln würde", sagt Steck: "Tatsächlich hatten wir bisher nur drei Leute, die man als Denunzianten bezeichnen kann. In der überwiegenden Masse läuft das sehr seriös ab."
Unternehmen fürchten Imageverluste wegen unlauterer Machenschaften im Betrieb. Also stellen sie lieber den eigenen Mitarbeiter ruhig und bezichtigen ihn der Verleumdung. Dabei kommt es vor allem dann zu einem Imageproblem, wenn die Vorwürfe öffentlich werden. Die Untersuchung von Nico Herold zeigt, dass die Whistleblower den Schritt nach außen - zu den Strafverfolgungsbehörden, den Medien, an die Öffentlichkeit - vor allem dann wagen, wenn ihr Arbeitgeber sie schlecht behandelt. "Externes Whistleblowing ist fast immer Ultima Ratio für Missstandsinsider", sagt Herold, doch "wenn der Whistleblower immer weiter in die Ecke gedrängt wird, werden externe Meldesysteme für ihn immer mehr zur Option. Die interne Eskalation produziert also erst externes Whistleblowing."
Diese interne Eskalation, das Kaltstellen des Informanten durch Mobbing, Versetzung oder Kündigung, führe nicht nur zu einer Spirale von Aktion und verschärfter Reaktion, sagt Herold, sondern verändere auch die Motivation der Whistleblower: "Das geht weg vom eigentlichen Missstand und hin zu den beeinträchtigten persönlichen Interessen: Karriere, Reputation, Integrität." Die Auseinandersetzung bekomme einen Charakter im Sinne von "Wer hat recht?", so Herold.
Formale Abmahnungen, sagt Rainer Moormann, habe er nicht bekommen, der Imageschaden bei einem Arbeitsgerichtsprozess wäre zu groß gewesen: "Mich haben der schlechte Ruf der Kerntechnik und ihr Glaubwürdigkeitsproblem geschützt." Auch er fühlte sich erst, als sein Arbeitgeber ihn fallen ließ, berechtigt, die Öffentlichkeit zu informieren. "Wenn ich meinen Bericht nicht aktiv unter die Leute gebracht hätte, wäre der ja versackt", sagt der Sicherheitsforscher. Zu diesem Zeitpunkt ging es auch um seine Ehre als Wissenschaftler, schließlich wollte er nicht als jemand abgetan werden, der sich nur wichtigmachen will: "Dass ich auch meinen Ruf retten wollte, ist ja klar. Das lässt sich ja nicht trennen."

Sie übergaben einem Journalisten Dokumente, die zu den Lux-Leaks-Enthüllungen führten. Ein Luxemburger Gericht hat die zwei Männer dafür nun verurteilt.
Firmen müssen interne Informanten ernst nehmen, auch wenn es weh tut
Es liegt also im Interesse der Unternehmen, den betriebsinternen Informanten ernst zu nehmen, auch wenn es weh tut. Indem Firmen eigene Systeme schaffen, etwa eine interne Hinweisgeber-Hotline einrichten oder einen externen Rechtsanwalt als Vertrauensperson benennen, setzen sie weniger Anreize für Whistleblower, ihre Hinweise mit Externen zu teilen. Und: Bleibt die Erstinformation im Unternehmen, bleibt dort auch die Bearbeitungshoheit.
Doch ist das wünschenswert? Zwar ist nicht jeder angezeigte Missstand eine schwerwiegende Straftat, aber "das geschäftliche Interesse ist nicht notwendig deckungsgleich mit dem öffentlichen Interesse", sagt Klaus Hennemann vom Verein Whistleblower-Netzwerk. Schließlich könne das innerbetriebliche Problem exemplarisch für einen viel größeren und weitergehenden gesellschaftlich relevanten Skandal stehen. Hennemann ist daher gerade aus arbeitsrechtlicher Sicht dafür, Whistleblower selbst entscheiden zu lassen, an wen sie sich wenden.
Auch LKA-Ermittler Jürgen Steck sieht die Konkurrenz zwischen seinem anonymen Hinweisgebersystem und firmeninternen Meldewegen: "Mit der Problematik müssen wir leben." Wichtig sei, dass die Hinweisgeber überhaupt eine Plattform nutzen könnten, sagt Steck, "letztlich können sie ja selbst beurteilen, wohin sie mit ihrem Hinweis gehen sollten".
Rainer Moormann veröffentlichte seinen Bericht als wissenschaftliches Papier. Als sein Arbeitgeber den Druck auf ihn erhöhte, gab Moormann Informationen an die Presse. Drei Jahre später, also acht Jahre nach Moormanns ersten Hinweisen, gab das Forschungszentrum Jülich bekannt, die Forschung an den Kugelhaufenreaktoren einzustellen. Zu dem Zeitpunkt arbeitete Moormann nicht mehr in Jülich, sondern war im vorgezogenen Ruhestand, aus Rücksicht auf seine Gesundheit, wie er sagt. 2011 bekam er den Whistleblowerpreis der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Er klärt weiter über die Risiken der Kugelhaufentechnik auf, schreibt mit einem Co-Autor ein Buch zum Thema. Durch den vorzeitigen Ruhestand habe er einige Hundert Euro weniger an Rente. "Aber das ist der Preis, den ich dafür zahlen muss", sagt Moormann.