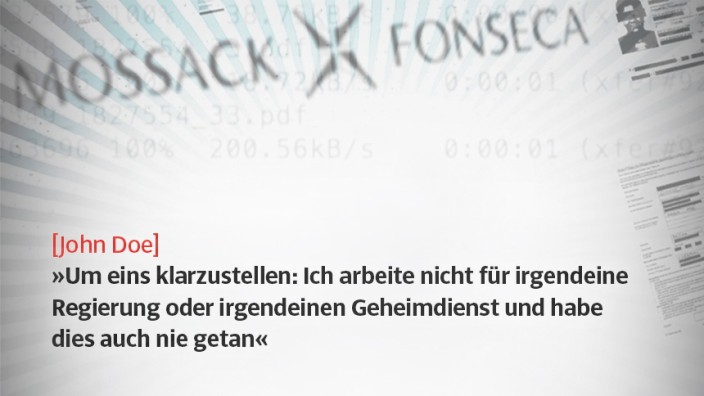Vor mehr als einem Jahr wurde die Süddeutsche Zeitung von einer auf Anonymität bedachten Quelle kontaktiert, die sich selbst "John Doe" nannte, und interne Daten der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca anbot. Die SZ entschied, die Daten gemeinsam mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) auszuwerten, im Lauf der Recherche wuchs die Kooperation auf mehr als 100 Medien aus rund 80 Ländern an. Die weltweiten Reaktionen auf die Veröffentlichungen der Panama Papers vor gut einem Monat waren enorm, es gab Rücktritte, Massendemonstrationen, Razzien und Ermittlungen in Dutzenden Ländern. Nun hat "John Doe", die anonyme Quelle, der SZ eine Art Manifest zukommen lassen, das sich gleichsam als Erklärung seines Tuns wie als Aufruf zum Handeln lesen lässt. Die SZ veröffentlicht dieses Dokument hier auf Deutsch, auf panamapapers.de aber auch auf Englisch. Der Text und die dahinterstehende politische Haltung hatten keinen redaktionellen Einfluss auf die Veröffentlichungen der SZ oder anderer Recherchepartner, und werden dies auch in Zukunft nicht haben. Mit der Übergabe der Daten der Panama Papers waren und sind keine inhaltlichen Bedingungen verbunden.SZ
Die Ungleichheit der Einkommen, die Kluft zwischen Arm und Reich, ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Es betrifft jeden von uns, weltweit. Seit Jahren tobt die Debatte über eine plötzliche Verschlimmerung der Lage, doch Politiker, Wissenschaftler und Aktivisten sind trotz ungezählter Reden, Analysen, schwacher Proteste und ein paar Dokumentarfilmen rat- und hilflos, wie diese Entwicklung aufzuhalten ist. Die Fragen bleiben: Warum? Und warum gerade jetzt?
In den Panama Papers ist die Antwort darauf nun offensichtlich geworden: umfassende, alltägliche Korruption. Dass ausgerechnet eine Rechtsanwaltskanzlei diese Antwort liefert, ist keineswegs Zufall. Mossack Fonseca ist mehr als ein Rädchen im Getriebe der "Vermögensverwaltung". Die Kanzlei nutzte ihren Einfluss, um weltweit Gesetze zu diktieren und zu umgehen und so über Jahrzehnte hinweg die Interessen von Kriminellen durchzusetzen. Mit der Pazifikinsel Niue hat sich Mossack Fonseca im Grunde sogar eine eigene Steueroase erschaffen.
Ramón Fonseca und Jürgen Mossack wollen uns weismachen, dass die von ihnen verwalteten Briefkastenfirmen wie Autos seien: Auch da mache man den Verkäufer ja nicht verantwortlich, wenn der Wagen für ein Verbrechen genutzt würde. Aber Gebrauchtwagenverkäufer machen keine Gesetze. Und bei genauem Hinsehen sind die Briefkastenfirmen, die Mossack Fonseca verkauft hat, wie gemacht für Betrug im großen Stil - es wären sehr spezielle Autos.
Briefkastenfirmen werden häufig mit dem Straftatbestand der Steuerhinterziehung in Verbindung gebracht. Doch die Panama Papers belegen ohne den geringsten Zweifel: Auch wenn Briefkastenfirmen nicht per Definition illegal sind, dienen sie dazu, eine Bandbreite von Verbrechen zu begehen, die weitaus schlimmer sind als Steuerhinterziehung.
Ich habe mich dazu entschlossen, Mossack Fonseca dem Urteil der Weltöffentlichkeit auszusetzen, weil ich der Meinung bin, dass die Kanzleigründer, Angestellten und Kunden für ihre Rolle bei diesen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Bislang ist erst ein Bruchteil der schmutzigen Machenschaften von Mossack Fonseca bekannt, es wird Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern, bis alles ans Licht gekommen ist.
Um eines klarzustellen: Ich arbeite nicht für irgendeine Regierung oder irgendeinen Geheimdienst
Mittlerweile ist eine weltweite Debatte entbrannt, die Anlass zu Hoffnung gibt. Die Höflichkeitsrhetorik der vergangenen Jahre, die das Fehlverhalten der Reichen und Mächtigen sorgsam ausgeklammert hatte, ist passé. Es geht nun um den Kern der Sache.
Genau dazu habe ich ein paar Gedanken.
Um eines klarzustellen: Ich arbeite nicht für irgendeine Regierung oder irgendeinen Geheimdienst, und habe dies auch nie getan, weder als direkter Angestellter noch im Auftrag. Ich vertrete hier allein und einzig meine Meinung, genauso wie es allein meine Entscheidung war, die Dokumente der Süddeutschen Zeitung und damit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) zuzuspielen. Dies ist nicht zu einem bestimmten politischen Zweck geschehen, sondern weil ich beim Anblick der Dokumente genug begriffen habe, um zu verstehen, wie ungeheuerlich ihr Inhalt ist.
Die aktuelle Medienberichterstattung hat sich bis jetzt darauf konzentriert, was skandalöserweise innerhalb des Systems legal und erlaubt ist. Was alles legal und erlaubt ist, ist in der Tat ein Skandal und muss geändert werden. Aber wir dürfen einen anderen wichtigen Punkt nicht aus dem Blick verlieren: Die Kanzlei, ihre Gründer und Angestellten, haben wissentlich unzählige Gesetze gebrochen, und das weltweit und wiederholt.
In der Öffentlichkeit haben sie so getan, als ob sie von alldem nichts wussten, aber die Dokumente zeigen, dass sie genauestens informiert waren und vorsätzlich gegen das Gesetz verstoßen haben. Es steht zum Beispiel bereits fest, dass Jürgen Mossack vor einem Bundesgericht in Nevada einen Meineid geschworen hat, und wir wissen auch, dass seine IT-Abteilung versucht hat, in diesem Verfahren Beweise verschwinden zu lassen. Dafür sollten sie vor einem Gericht zur Rechenschaft gezogen werden.
Die Panama Papers könnten Tausende Anklagen nach sich ziehen, wenn die Strafverfolgungsbehörden in den Besitz der Dokumente gelangen und sie auswerten könnten. Das ICIJ und seine Partnermedien haben vollkommen zu Recht erklärt, die Dokumente nicht weiterzugeben. Ich jedoch bin bereit, mit den Behörden zusammenzuarbeiten - in Rahmen meiner Möglichkeiten.
Allerdings: Ich habe mitangesehen, was mit Whistleblowern und Aktivisten in den USA und Europa geschehen ist, wie ihr Leben zerstört wurde, nachdem sie Vorgänge öffentlich gemacht hatten, die offensichtlich kriminell waren. Edward Snowden sitzt in Moskau fest, im Exil, weil die Obama-Regierung auf Grundlage des AntiSpionage-Gesetzes Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. Man sollte Snowden für seine NSA-Enthüllungen als Helden feiern und ihm Preise verleihen, aber ihn nicht bestrafen. Bradley Birkenfeld bekam von der US-Steuerbehörde Millionen für seine Informationen über die Schweizer Bank UBS - und wurde dennoch vom US-Justizministerium verurteilt. Antoine Deltour wird momentan in Luxemburg der Prozess gemacht, weil er Journalisten Informationen zur Verfügung gestellt hat, die offenlegten, wie das Land mit enormen Steuervergünstigungen internationale Firmen angelockt hat, und damit letztlich seine europäischen Nachbarländer um Milliarden an Steuergeldern gebracht hat.
Es gibt eine Menge weiterer Beispiele. Whistleblower, die das Richtige tun, indem sie Straftaten aufdecken, egal ob als Insider oder Outsider, verdienen Immunität vor dem Gesetz. Punkt. Solange Regierungen keinen Rechtsschutz für Whistleblower garantieren, sind Strafverfolgungsbehörden weiterhin abhängig von ihren eigenen Informationsquellen oder von medialer Berichterstattung, um an entsprechende Dokumente zu gelangen.
Einstweilen appelliere ich an die Europäische Kommission, das britische Parlament, den Kongress der Vereinigten Staaten und an alle Nationen, unverzüglich zu handeln, nicht nur, um Whistleblower zu schützen, sondern auch, um dem weltweiten Missbrauch von Unternehmensregistern ein Ende zu setzen. Die EU sollte dafür sorgen, dass die Firmenregister jedes Mitgliedsstaates frei zugänglich sind und offen einsehbar die letztlich wirtschaftlich Berechtigten benannt sind.
Großbritannien, das zwar stolz sein kann auf seine bisherigen innenpolitischen Maßnahmen, muss endlich voranschreiten und das Bankgeheimnis in seinen Überseegebieten abschaffen, die zweifelsohne eine Säule der weltweiten organisierten Korruption sind. Und die Vereinigten Staaten müssen den Umgang mit Firmendaten in den Bundesstaaten auf den Prüfstand stellen. Es ist überfällig, dass der Kongress sich zu Wort meldet und eine Transparenzpolitik einführt, die öffentliche Zugänglichkeit und Offenlegung von Firmendaten festschreibt.
Auf politischen Gipfeltreffen das Hohelied staatlicher Transparenz zu singen ist eine Sache, aber es ist eine andere, den Worten Taten folgen zu lassen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass US-Abgeordnete einen Großteil ihrer Zeit mit Spendensammeln für ihre Wahlkämpfe verbringen. Solange jedoch gewählte Politiker gerade diejenigen um Geld bitten, die im Vergleich zu den anderen Bevölkerungsschichten das größte Interesse daran haben, Steuern zu vermeiden, kann die Steuerhinterziehung unmöglich ernsthaft angegangen werden. Durch diese widerliche politische Praxis beißt sich die Katze in den Schwanz - das Problem ist unlösbar. Amerikas Wahlkampffinanzierungssystem ist im Kern krank und muss reformiert werden.
Banken, Finanzaufsichts- und Steuerbehörden haben versagt
Natürlich ist das nicht die einzige Baustelle. Der neuseeländische Premierminister John Key war erstaunlich still, als die Rolle seines Landes diskutiert wurde, das den Cook-Inseln das Dasein als Mekka des Finanzbetrugs ermöglicht. In Großbritannien haben die Tories schamlos versucht, ihre Machenschaften mit Offshore-Firmen unter dem Teppich zu halten, während Jennifer Shasky Calvery, die Direktorin der Ermittlungsbehörde des US-Finanzministeriums, gerade ihren Rücktritt bekannt gegeben hat - um stattdessen bei der HSBC anzuheuern, einer der fragwürdigsten Banken der Welt, die nicht ohne Grund in London ihren Hauptsitz hat. Und so dringt das altbekannte Drehgeräusch des Personalkarussells hinüber in das ohrenbetäubende Schweigen Tausender bislang unbekannter wahrer Briefkastenfirmeneigentümer, die sehr wahrscheinlich dafür beten, dass Calverys Nachfolger ähnlich rückgratlos sein werden. Es ist verlockend, sich angesichts eines solchen politischen Duckmäusertums in Defätismus zu flüchten und zu argumentieren, der Status quo werde sich ohnehin nie ändern und gerade die Panama Papers seien ein Beweisstück für den fortschreitenden moralischen Niedergang unserer Gesellschaft.
Jedoch: Endlich ist das Thema wirklich zum Thema geworden, und dass Veränderungen Zeit brauchen, ist nichts Neues. Fünfzig Jahre lang haben Exekutive, Legislative und Judikative weltweit im Umgang mit Steueroasen, die sich wie Metastasen auf dem Globus ausbreiten, kläglich versagt. Selbst jetzt, wo Panama erklärt, nicht nur das Land sein zu wollen, aus dem die Panama-Papiere stammen, wird dort bequemerweise nur die Kanzlei Mossack Fonseca unter die Lupe genommen - also nur ein Pferdchen des sich weiterhin drehenden panamaischen Offshore-Karussells.
Banken, Finanzaufsichts- und Steuerbehörden haben versagt. Es wurden Entscheidungen getroffen, die die Reichen verschont und die Mittel- und Geringverdiener getroffen haben.
Hoffnungslos rückständige und inkompetente Gerichte haben versagt. Die Richter sind zu oft den Argumenten der Reichen gefolgt, deren Anwälte - und zwar nicht nur Mossack Fonseca - gut darin sind, den Buchstaben der Gesetze Genüge zu tun, während sie gleichzeitig alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Sinn der Gesetze auf den Kopf zu stellen.
Die Zeit zu handeln ist gekommen, und ein Anfang wäre, endlich die richtigen Fragen zu stellen
Die Medien haben versagt. Viele Fernsehanstalten sind nur noch lächerliche Abziehbilder ihrer selbst, und unter Milliardären scheint es neuerdings in Mode gekommen zu sein, Zeitungen aufzukaufen und so eine ernsthafte Berichterstattung über die Reichen und Superreichen zu verhindern. Seriösen Investigativ-Journalisten fehlt es dagegen an den finanziellen Mitteln. Das hat Folgen: Neben der Süddeutschen Zeitung und dem ICIJ hatten, entgegen anderslautenden Behauptungen, auch Redakteure großer Medien Dokumente aus den Panama Papers vorliegen - und entschieden, nicht darüber zu berichten. Die traurige Wahrheit ist, dass einige der prominentesten und fähigsten Medienorganisationen der Welt nicht daran interessiert waren, über diese Geschichte zu berichten.
Sogar Wikileaks hat wiederholt nicht auf meine Nachrichten reagiert.
Aber an erster Stelle haben die Anwälte versagt. Eine Demokratie braucht verantwortungsvolle Individuen, die das Gesetz verstehen und es wahren, nicht solche, die es verstehen und ausnutzen. Anwälte sind im Durchschnitt derart korrupt, dass Umwälzungen in diesem Berufszweig geschehen müssen, und zwar viel weiter gehender als die bisher unterbreiteten Vorschläge. Zunächst: Der Begriff der Rechtsethik, auf dem der Verhaltenskodex und die Zulassung für den Anwaltsberuf basieren, ist zum Widerspruch in sich verkommen. Mossack Fonseca hat nicht in einem Vakuum gearbeitet - Jürgen Mossack hatte Verbündete und Kunden in nahezu jedem Land der Welt, obwohl seine Kanzlei immer wieder negativ aufgefallen war. Wären die am Boden liegenden Industrien dieser Länder nicht im Grunde schon Beweis genug, sollte spätestens jetzt gefordert werden, dass Juristen sich nicht länger selbst regulieren sollten. Es funktioniert einfach nicht. Wer das meiste Geld hat, findet immer einen hilfsbereiten Anwalt für seine Zwecke, sei es die Kanzlei Mossack Fonseca oder eine andere, von der wir noch nichts wissen.
Was ist mit dem Rest der Gesellschaft?
Die Auswirkungen dieses vielfachen Versagens führen zum ethischen Niedergang unserer Gesellschaft und letztlich zu einem neuen System, das wir noch Kapitalismus nennen, das aber in Wahrheit ökonomisches Sklaventum ist. In diesem System - unserem System - wissen die Sklaven weder, dass sie Sklaven sind, noch kennen sie ihre Herren, die in einer Parallelwelt leben, und die unsichtbaren Ketten sorgfältig unter einem Haufen unverständlicher Gesetzestexte verstecken. Das weltweite Schadensausmaß sollte uns alle wachrütteln.
Dass die Alarmglocke von einem Whistleblower geschlagen werden musste, sollte Anlass zu noch größerer Sorge sein. Denn es bedeutet, dass die Kontrollmechanismen unserer Demokratien versagt haben, dass der Zusammenbruch ein Zusammenbruch des Systems ist, und dass gravierendere Zusammenbrüche folgen könnten. Die Zeit zu handeln ist gekommen, und ein Anfang wäre, endlich die richtigen Fragen zu stellen.
Historiker wissen, dass Besteuerung und ungleiche Machtverhältnisse in der Vergangenheit bereits Revolutionen ausgelöst haben. Damals war militärische Macht notwendig, um die Menschen zu unterdrücken, während es heute genauso effektiv oder noch effektiver ist, die Menschen vom Zugang zu Informationen abzuschneiden - auch weil das im Verborgenen geschieht. Aber wir leben in einer Zeit günstiger, grenzenloser Datenspeicher und schneller Internetverbindungen, die nationale Grenzen überschreiten. Es sieht also sehr danach aus, dass die nächste Revolution digital sein wird.
Vielleicht hat sie aber auch schon begonnen.