Peter-Alexander Wacker, 59, fühlt sich von der deutschen Politik zu wenig unterstützt. Deshalb baue der Chemiekonzern Wacker, der im bayrischen Burghausen sein Stammwerk hat, die neue Siliziumfabrik nun in den USA. Den Deutschen fehle die Erkenntnis, wie wichtig es sei, eine industrielle Basis zu besitzen. "Inzwischen geht es uns wahrscheinlich zu gut", meint Wacker. Er hat 2008 den Vorsitz im Vorstand gegen den im Aufsichtsrat eingetauscht. Dass Vorstände zwei Jahre warten sollen, bevor sie in den Aufsichtsrat dürfen, findet er schlecht. Dadurch gehe Kompetenz verloren.
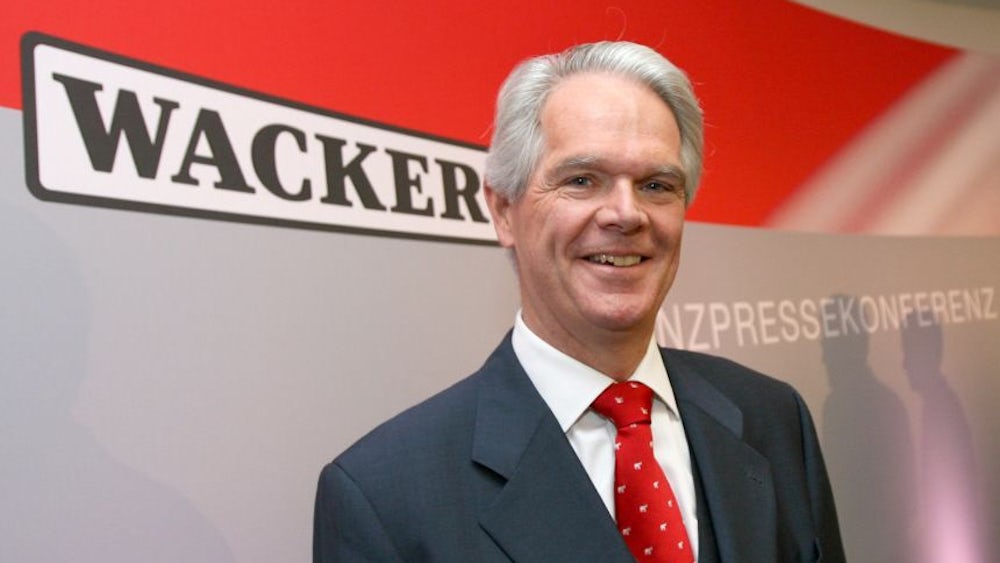
SZ: Herr Wacker, Ihr Unternehmen baut eine Siliziumfabrik in den USA. Warum nicht in Deutschland?
Wacker: Die USA haben den Zuschlag bekommen, weil unter anderem an dem neuen Standort die Infrastruktur besser ist als in Deutschland. Auch ist die Energie billiger. Der Energiepreis in Deutschland ist im internationalen Vergleich am oberen Ende. Die Chemieindustrie ist aber sehr energieintensiv. Die deutsche Politik unterstützt uns da zu wenig.
SZ: Aber die Regierung hat doch gerade auf Drängen der Industrie die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert.
Wacker: Die Laufzeitverlängerung ist die eine, der Atomausstieg die andere Seite. Wir können uns den Ausstieg doch gar nicht leisten. Wo soll der Strom denn herkommen? Am Ende importieren wir ihn aus dem Ausland, das den Strom in Atomkraftwerken herstellt. Da ist es mir lieber, wir haben die Technologie unter Kontrolle. Wenn wir mehr in die Forschung investiert hätten, wären wir heute viel weiter in der Beherrschung der möglichen Risiken. Doch die Politik hat die Weichen in vielerlei Hinsicht falsch gestellt.
SZ: Woran hakt es konkret?
Wacker: Zum Beispiel an der schlechten Straßen- und Bahnanbindung unseres Stammwerkes in Burghausen in Ostbayern. Alle Rufe, die Verkehrsanbindung zu verbessern, wurden nicht gehört. Es fehlt anscheinend die Erkenntnis, dass es wichtig ist, die industrielle Basis zu stärken. Die Politik belastet die Unternehmen immer mehr mit Abgaben und wundert sich, dass die Firmen ins Ausland gehen.
SZ: Ist das in Sachsen besser als in Bayern? Wacker will künftig in Sachsen investieren.
Wacker: In Sachsen ist die Akzeptanz unserer Branche bei Politik und in der Öffentlichkeit größer als in Bayern. Natürlich kann ein Politiker allein nicht sicherstellen, dass Bürgerproteste ausbleiben. Aber er kann für einen generellen Grundkonsens sorgen.
SZ: In den USA gibt es diesen Konsens. Woran liegt das?
Wacker: Am gesamten wirtschaftlichen Klima. In den USA werden Firmen unterstützt mit Infrastrukturmaßnahmen, es gibt langfristige und kostengünstige Energielieferverträge, es werden Umschulungen finanziert und vieles mehr.
SZ: Warum mögen die Deutschen die Industrie nicht?
Wacker: Viele Politiker haben die Fähigkeit verloren, die Probleme der Menschen zu sehen, ihnen die Zusammenhänge zu erklären und sie mitzunehmen. Das führt zu einem großen Unmut. Der zeigt sich dann in solchen Bürgerprotesten, wie wir sie nun in Stuttgart erlebt haben.
SZ: Die Menschen sind nur schlecht informiert?
Wacker: Nein, das nicht. In Stuttgart sind alle demokratischen Prozesse durchlaufen worden. Da ist viel informiert worden. Aber ich denke, dass die Einbindung der Meinungen, also die Mediation, viel zu spät stattgefunden hat.
SZ: Liegt das auch am allgemeinen Wohlstand, dass die Industrie nicht mehr den Rückhalt in der Bevölkerung hat?
Wacker: Ja. Dies kann man zum Beispiel an China festmachen. Dort ist die Zusammenarbeit zwischen der Regierung, den lokalen Behörden und den Menschen sehr viel enger als in Deutschland. Und natürlich ist auch die Bereitschaft höher, etwas für eine industrielle Ansiedlung zu tun. Die Chinesen verbinden mit der Industrie einen Zuwachs an Wohlstand. Für die Deutschen hatte die Industrie nach dem Krieg auch einen sehr hohen Stellenwert. Inzwischen geht es uns wahrscheinlich zu gut. Denn wir erkennen nicht, wie wichtig eine industrielle Basis für Deutschland ist.
SZ: Sie sind stolz darauf, ein gutes Verhältnis zur Belegschaft zu haben. Wie sind Sie durch die Krise gekommen?
Wacker: Wir arbeiten von jeher vertrauensvoll mit unseren Mitarbeitern zusammen. In der Wirtschaftskrise sind sie uns entgegengekommen, haben finanzielle Zugeständnisse gemacht durch Kurzarbeit und Lohnverzicht. So etwas ist nur möglich, weil die Belegschaft weiß, dass sie das zurückbekommt, wenn es dem Unternehmen wieder besser geht. Wir halten unsere Versprechen. Vertrauen und Verlässlichkeit prägen die Unternehmenskultur von Wacker.
SZ: Das ist Teil der deutschen Sozialpartnerschaft. Auf so etwas können Sie in den USA nicht bauen. Dort ist es schwieriger, mit den Arbeitnehmervertretern ein langfristig gutes Verhältnis aufzubauen.
Wacker: Grundsätzlich haben Sie recht. Doch am Ende des Tages werden wir daran gemessen, ob wir mit dem investierten Kapital eine Rendite erwirtschaften. Gute Sozialpartnerschaft muss man sich leisten können.
Das schafft Loyalität.
SZ: Sie wurden 2006 als Familienunternehmer des Jahres ausgezeichnet. Was bedeutet das für Sie?
Wacker: Jede Auszeichnung ist etwas Positives, weil sie Leistung anerkennt. Wir haben das Unternehmen gut aufgestellt für die nächsten 100 Jahre. Auch nach dem Börsengang ist die Familie Mehrheitsgesellschafter. Das gibt Konstanz, Sicherheit und Langfristigkeit. Wacker wird damit nicht zum Spielball von Spekulanten. Auf der anderen Seite profitieren wir von dem Zugang zum Kapitalmarkt und von der Kontrolle und dem Verlangen nach Transparenz.
SZ: Bei Transparenz denken wir an Corporate Governance. Hat die Korruption in Deutschland zugenommen?
Wacker: Nein, ich glaube nicht. Wir haben heute eine andere Wahrnehmung von Korruption. Und wir überziehen auch schon wieder. Wenn man einem Kunden eine Flasche Wein zu Weihnachten schickt, dann kommt die zurück, weil der Compliance Officer das nicht erlaubt. Fakt ist, dass sich die Rechtslage geändert hat. Früher konnten Firmen diese Kosten sogar steuerlich absetzen.
SZ: War das bei Wacker so?
Wacker: Korruption war für Wacker nie ein Thema.
SZ: Was hat die Siemens-Affäre bei Ihnen bewirkt?
Wacker: Die Siemens-Affäre war für uns kein Auslöser, etwas zu verändern, wohl aber die neue Rechtslage. Wir setzen natürlich all das um, was das Gesetz verlangt. Wir haben zum Beispiel einen Compliance Officer installiert. Aber das Wichtigste ist eine vertrauensvolle Unternehmenskultur und dass man Dinge anspricht, die nicht gut laufen.
SZ: Müssten die Aufsichtsräte wachsamer sein, um Korruption zu verhindern?
Wacker: Nach der neuen Gesetzeslage werden sie wachsamer sein, weil sie stärker in die Haftung genommen werden können. Aber entscheidend ist, dass das Zusammenspiel zwischen Management und Kontrollgremien funktioniert. Vorschriften alleine reichen nicht aus.
SZ: Wie eng ist Ihr Kontakt zum Compliance Officer?
Wacker: Wir sind in einem regen Austausch. Wenn es etwas gäbe, dann käme er sicher auf den Aufsichtsrat zu. Das ist aber nicht eine Frage von Regeln. Unternehmen müssen Corporate Governance leben, man kann das nicht hineinzwingen per Gesetz.
SZ: In Deutschland wird eine Frauenquote in Vorständen und Aufsichtsräten diskutiert. In einigen Ländern gibt es die Quote schon. Was halten Sie davon?
Wacker: Mit gesetzlichen Quoten kann man nur schwer etwas durchsetzen. Man sollte lieber fragen, warum so wenige Frauen in den Gremien sind. Jüngere Frauen haben den Konflikt zwischen Familie und Beruf. Den müssen wir lösen, indem wir zum Beispiel bessere Betreuungsmöglichkeiten schaffen. Eine Quote wird dazu führen, dass Frauen wegen ihres Geschlechts und nicht wegen ihrer Kompetenz in die Gremien kommen. Wir sollten Frauen in die Lage versetzen, ihren Beruf so lange auszuüben, bis sie für Führungsposten qualifiziert sind.
SZ: Der Fachkräftemangel wird da Druck machen.
Wacker: Ja, absolut. Aber egal ob wir einen Fachkräftemangel bekommen oder nicht, wir dürfen die Frauen und ihr Potential nicht vernachlässigen. Da müssen noch viele kleine Rädchen gedreht werden. Der Grundkonflikt ist aber der zwischen Familie und Beruf.
SZ: Gibt es bei Wacker einen Betriebskindergarten?
Wacker: Wir haben Belegrechte für Kindergartenplätze an unseren Standorten, die wir unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Aber ein Unternehmen alleine kann die gesellschaftlichen Probleme nicht lösen.
SZ: Finden Sie es richtig, dass es bei der Besetzung von Aufsichtsräten seit ei niger Zeit eine zweijährige Wartefrist für ehemalige Vorstandsmitglieder gibt?
Wacker: Immerhin kann diese Wartefrist ja mit Mehrheit der Hauptversammlung außer Kraft gesetzt werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass dem Aufsichtsrat durch die zweijährige Frist Kompetenz verlorengeht. Ich habe das am eigenen Leib erlebt. Mit meiner umfassenden Kenntnis des Unternehmens als früherer Vorstandsvorsitzender tue ich mich doch viel leichter, die richtigen Fragen zu stellen und schnell zum Kern vorzustoßen.
SZ: Aber ein direkter Wechsel erschwert die Rolle des neuen Chefs.
Wacker: Es kommt darauf an, wie die beiden miteinander können. Wir sind bei Wacker ein Team, das gut zusammenarbeitet. Die heutigen Vorstandsmitglieder waren ja schon lange vorher bei Wacker, den Vorstandsvorsitzenden Rudolf Staudigl kenne ich schon seit Jahrzehnten.
SZ: Sie waren 57 Jahre alt, als Sie 2008 in den Aufsichtsrat gingen. Eigentlich doch viel zu jung, um sich aus dem operativen Geschäft auszuklinken.
Wacker: Ausschlaggebend waren zwei Gründe. Der Aufsichtsratschef Karl Heinz Weiss war 79 Jahre alt und wollte nicht ein weiteres Mal zur Wiederwahl antreten. Da war für mich klar, dass ich in den Aufsichtsrat gehe, zumal das Vorstandsteam gut eingespielt war. Und zweitens wollte ich mehr Zeit für meine Familie haben. Sie ist in den Jahren, in denen ich das Unternehmen geleitet habe, oft zu kurz gekommen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist nämlich nicht nur für engagierte Frauen ein Problem, sondern genauso auch für Männer.
SZ: Wie nah sind Sie am täglichen Geschehen?
Wacker: Ich halte mich auf dem Laufenden. Ich habe einmal im Monat meinen Jour fixe mit dem Management, bei dem wir über die Zahlen und das operative Geschäft diskutieren.
SZ: Wie verbringen Sie den Tag?
Wacker: Ich habe außer dem Mandat bei Wacker auch ein Aufsichtsratsmandat bei dem Banknotendrucker Giesecke & Devrient. Wenn man solche Posten ernst nimmt, dann kostet das Zeit. Ansonsten fliege ich nicht mehr mit dem frühesten Flugzeug zu Terminen, sondern starte zu einer angenehmeren Zeit.
SZ: Was bedeutet Ihnen Ihr karitatives Engagement bei der Arche, Sie geben viel Geld hinein?
Wacker: Es gibt viel Armut in Deutschland. Die Arche unterstützt Kinder, die in Armut leben. Sie kümmert sich um Kinder, die vieles nicht haben, was für uns selbstverständlich ist. Geborgenheit, Zuwendung, Unterstützung, Versorgung. Wenn man sieht, wie hastig sich Kinder nach dem Wochenende ein Mittagessen reinzwängen, weil sie hungrig sind, dann wirft das ein verheerendes Bild auf Deutschland. Ich will dagegen etwas tun. Die Arche ist einfach ein Zufluchtsort für Kinder. Das alles läuft vor einem christlichen Wertehintergrund.
SZ: Unterstützen Sie auch deshalb gerade diese Hilfsorganisation?
Wacker: Auf jeden Fall. Die zehn Gebote sind ausschlaggebend für unser Zusammenleben. Daraus kann man unter anderem ableiten, wie man sich in der Gruppe verhält.
SZ: Welche Rolle spielt der christliche Glaube für Sie?
Wacker: Er ist die Basis, auf der wir leben. Er ist die Grundordnung unserer Kultur und unseres Rechtsstaates.
SZ: Wie haben Sie das im Unternehmen verankert?
Wacker: Durch mein Verhalten. Indem ich meinen Leuten vertraue und ihnen zu verstehen gebe, dass sie mir vertrauen können. Vertrauen, Zuverlässigkeit und Respekt gegenüber den anderen. Das sind für mich wichtige Grundpfeiler.