Offiziell endete die Zukunft von Till Reuter als Vorstandschef des Augsburger Roboter-Herstellers Kuka am ganz frühen Montagmorgen um 1.52 Uhr: Kurz und kalt gab der Konzern in einer Börsen-Pflichtmitteilung bekannt, dass Reuter im Dezember seine Tätigkeit beenden werde. Finanzchef Peter Mohnen soll vom 6. Dezember an übergangsweise den Vorstandsvorsitz übernehmen. In einer Pressemitteilung folgen dann die üblichen Floskeln: Andy Gu, der für den chinesischen Investor Midea den Kuka-Aufsichtsrat führt, dankt Reuter für "seinen großen Einsatz". Dieser wird mit den Worten zitiert, er sei stolz darauf, die vergangenen zehn Jahre "Teil von Kuka" gewesen zu sein.
Reuter war es, der aus dem Sanierungsfall Kuka eine Vorzeigefirma für Robotik gemacht hat. Und er war es, der 2016 empfahl, das Übernahmeangebot des chinesischen Hausgerätekonzerns Midea anzunehmen. Damals wurde aus dem Unternehmen, das man vorher vor allem in Fachkreisen und im Großraum Augsburg kannte, plötzlich ein weltweiter Name. Und irgendwie auch eine Art Symbol für die chinesische Kaufwut in Deutschlands Industrie.
Dass es anschließend zwischen den Deutschen und den Chinesen kriselte, war immer mal wieder zu hören. Passiert aber war nichts. In Berlin hatte Reuter bis zuletzt vorgesprochen - offenbar um für sein Projekt, eine friedliche Übernahme aus China, zu werben. Bis dann am Freitagabend eine merkwürdige Meldung über die Ticker ging: "Mögliche Veränderungen im Vorstand der Kuka Aktiengesellschaft", lautete die Überschrift. Weiter hieß es, Chefaufseher Gu und Reuter führten "Gespräche über die vorzeitige Beendigung der Vorstandstätigkeit von Herrn Dr. Reuter." Der Aufsichtsrat hatte da aber noch gar nicht getagt. Keine 51 Stunden später war die Trennung dennoch vollzogen.
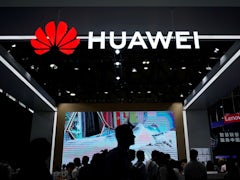
Die USA bringen den chinesischen Handyhersteller Huawei mit dem dortigen Geheimdienst in Verbindung und bieten ihren Verbündeten Geld dafür, wenn sie sich ihrem Huawei-Boykott anschließen.
Kuka und Midea sind auch kein Einzelfall, und Reuter ist nicht allein mit seinem ziemlich plötzlichen Abschied. Schon andere Manager vor ihm haben erlebt, wie chinesische Eigentümer erst sehr lange sehr zurückhaltend waren - nur um sich dann doch sehr rasch von ihren Statthaltern zu trennen. Gerade hinter den deutsch-chinesischen Kulissen, dieser Eindruck drängt sich für Außenstehende auf, ist es dabei sehr oft sehr lange ruhig. Auf der einen Seite stehen die angestellten Manager, die ihren Job machen dürfen, so, wie sie es für richtig halten - solange sie damit erfolgreich sind. Auf der anderen Seite stehen die chinesischen Investoren, deren Vertreter vom Aufsichtsrat aus ganz ruhig beobachten, wie sich die Dinge bei ihrer neuen Beteiligung entwickeln.
Das geht dann manchmal zwei Jahre gut, manchmal vier Jahre. Aber irgendwann knallt es dann auf einmal. Mal mit Vorwarnung, mal ohne. Zum Beispiel bei Putzmeister, einem Hersteller von Betonpumpen, der 2012 vom chinesischen Sany-Konzern übernommen wurde: Immerhin blieb Gerald Karch noch knapp fünf weitere Jahre Chef - dann aber war plötzlich Schluss für ihn. Angeblich waren die neuen Eigentümer gegen eine Vertragsverlängerung.
Oder der Fall des Türschlösser-Herstellers Kiekert aus Heiligenhaus bei Düsseldorf: 2012 gingen die Rheinländer an den börsennotierten chinesischen Autozulieferer Lingyun, eine Tochterfirma des Staatskonglomerats China North Industries. Noch im Frühjahr zeigte sich der damalige Kiekert-Chef Karl Krause im Gespräch durchaus zufrieden mit seinem Eigentümer. Der Investor handle strategisch und mit "der Mentalität eines Häuslebauers", sagte Krause damals. Besonders positiv falle auf, wie "langfristig und nachhaltig orientiert" die Chinesen vorgingen. Zwei Monate später war auch Krause auf einmal weg. Eingeweihte berichten, dass es unterschiedliche Auffassungen über die Elektronik-Strategie bei Kiekert gegeben habe. War es wirklich nur das? Einige Monate nach Krauses Abgang jedenfalls wurde die nächste Personalie bekannt: Ulrich-Nicolaus Kranz, Kiekert-Finanzchef und einer der Architekten des Verkaufs an Lingyun, scheidet zum Jahreswechsel auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus.
Und vor wenigen Wochen dann der Fall Grammer: Der Autozulieferer aus der Oberpfalz wurde von einem chinesischen Wettbewerber übernommen, dessen Umsatz gerade mal ein Siebtel so groß ist wie bei den Deutschen. Kaum war der Deal über die Bühne, kündigte der gesamte Vorstand.
Kuka war eine der ersten großen chinesischen Übernahmen in Deutschland
Jetzt also Till Reuter, der Architekt der Kuka-Übernahme, ausgerechnet jener Mann, der wie kein zweiter für Übernahmen aus China in Deutschland geworben hatte. Wie es nun weitergeht? Eine Weile können sich die Arbeitnehmer von Kuka noch sicher fühlen. Die Investorenvereinbarung, die Standorte und Beschäftigung sichert, läuft bis Ende 2023. Reuter hat sie ausgehandelt und aus heutiger Sicht wirkt sie wie eine Vorahnung auf das, was kommen könnte, wenn der chinesische Eigentümer erst einmal freie Hand hat. Entsprechend sei die Mitarbeiterversammlung am Montagnachmittag, an der auch Reuter teilnahm, geprägt gewesen von "Trennungsschmerz", sagt Betriebsrat Armin Kolb. "Es gab stehende Ovationen für den Vorstandschef, das kommt selten vor in Konzernen." Auch ihn selbst habe die Trennung überrascht, sagt er - obwohl er selbst im Kuka-Aufsichtsrat sitzt: "Ich bin nicht nahe am Wasser gebaut, aber selbst mich haben die Emotionen gepackt."
Dass der Fall Kuka mehr Aufmerksamkeit erhält als Kiekert oder Grammer, dafür gibt es gute Gründe: Der Robotik-Experte war eine der ersten großen chinesischen Übernahmen in Deutschland. Erst später begann man sich zu fragen, was eigentlich dahinter steckt. Die Antwort lautet: "Made in China 2025" - ein groß angelegter Staatsplan für eine ganz neue Industrie. Zehn Branchen haben sich die Wirtschaftsplaner ausgeguckt: Autos und Züge, den Flugzeugbau, die digitalisierte Produktion oder die Pharmaindustrie - überall soll die Volksrepublik führend sein. An Geld fehlt es nicht, der Staat hilft finanziell kräftig bei den politisch gewünschten Übernahmen mit. Knapp 200 solcher Deals hat es in vergangenen vier Jahren hierzulande gegeben. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung kam kürzlich zu dem Ergebnis, dass China seine eigenen Industrien vor ausländischem Zugriff schütze, aber im Westen immer mehr Schlüsseltechnologien einkaufe.
2016 versicherten Midea und Kuka noch: Kuka bleibt Kuka und die Patente in Augsburg, Reuter stand ja für Stabilität. Um Zweifeln vorzubeugen, wurde eine Investorenvereinbarung ausgehandelt. Die Botschaft: Aus China mischt sich niemand ein. Knapp zwei Jahre ließ Midea Reuter gewähren. Auf der Hauptversammlung 2017 erklärte Aufsichtsratschef Gu noch, wie stolz man sei, dass Kuka und Midea jetzt eine Familie seien.
