Im August vergangenen Jahres veröffentlichte Thomas Piketty, Professor an der École d'Économie de Paris, ein fast tausend Seiten dickes Buch mit einem unbescheidenen Titel: "Le capital au XXI siècle" - "Das Kapital im 21. Jahrhundert". Es behauptete sich gut unter den französischen Sachbüchern der Saison und wurde in der Kritik als die lang erwartete Wiedervereinigung der Ökonomie mit der Geschichte gerühmt. Ein paar Monate später weckte dasselbe Buch in den USA eine solche Aufmerksamkeit, dass der amerikanische Verlag die Veröffentlichung der Übersetzung vorzog.
"Capital in the Twenty-First Century" (Belknap Press, Cambridge 2014) ist jetzt seit fünf Wochen auf dem Markt und gilt als Offenbarung: Das Buch, schreibt Paul Krugman, der bekannteste Wirtschaftswissenschaftler der Welt, in der New York Review of Books, sei eine "Wasserscheide". Es werde "unser Denken über die Gesellschaft und unser Denken über die Ökonomie" verändern. Martin Wolf, der führende Ökonom der Financial Times, erklärte das Werk zu einem "außerordentlich wichtigen Buch", das niemand zu übersehen sich leisten könne. Daran ist zumindest soviel Wahres, dass Thomas Piketty, als er in der vergangenen Woche durch Nordamerika reiste, vom Finanzminister in Washington bis zu den Vereinten Nationen in New York auf eine Weise herumgereicht wurde, als habe er die Weltformel entdeckt.
Die Aristokratie ist wieder da: eine Klasse, die sich grundsätzlich über alle anderen erhebt
Dabei ist die These, zu deren Beweis Thomas Piketty mit seinem Buch auszieht, denkbar schlicht: Der gesellschaftliche Reichtum, erklärt er, sei zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht anders verteilt als vor hundert oder zweihundert Jahren. Heute wie damals gebe es eine kleine Gruppe extrem reicher Menschen, die über einen gewaltigen Teil aller verfügbaren Einkommens- und Vermögenswerte verfügen, während der weitaus größere Teil der Menschheit wenig mehr besitzt als die Arbeitskraft, die er zu Markte trägt. Der Sozialstaat und die angebliche Nivellierung der sozialen Unterschiede, der Aufstieg der Mittelschicht, die zahllosen politischen Bildungs- und Vermögensinitiativen - all diese Versuche der demokratisch verfassten Industriestaaten, den Reichtum zu verallgemeinern, hätten an den Verhältnissen kaum etwas geändert, und wenn, dann nur für begrenzte Zeit.
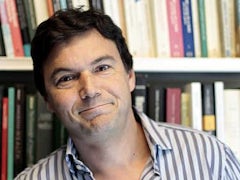
Nie war unsere Gesellschaft so reich wie heute. Und manche sind eben reicher als die anderen. Der Ökonom Thomas Piketty warnt im Interview, dass die Ungleichheit wieder so drastisch werden könnte wie zu feudalen Zeiten.
Tatsächlich, so Thomas Piketty, treffe nicht einmal die liberale Lehre zu, es bedürfe deutlicher finanzieller Unterschiede, um Leistung zu motivieren. Denn der weitaus größere Teil allen Reichtums bestehe nicht in Arbeitseinkommen, sondern in Vermögen. Und so etwas werde auch heute weniger erworben als vielmehr ererbt - in einem Maße, wie das zuletzt im frühen 19. Jahrhundert der Fall gewesen sei.
Im Zentrum des Buches steht tatsächlich eine Formel. Sie lautet: "r >g", wobei "r" für die Kapitalrendite steht ("return of capital") und "g" für das Wirtschaftswachstum ("economic growth"). Sie bedeutet nicht nur, dass sich alle "Scheren" in der Verteilung von Reichtum immer weiter öffnen müssen, allein schon, weil sich die Kapitalrenditen fortlaufend akkumulieren, sondern auch, dass diese Unterschiede in Zeiten niedrigen Wachstums - gegenwärtig mögen es im Schnitt der westlichen Industrieländer 1,5 Prozent im Jahr sein - besonders groß ausfallen.
Denn auch bei einer Rendite von vier oder fünf Prozent wird der Reichtum vermehrt, während die Inflation, und sei sie auch noch so gering, für alle Menschen, die von ihrem Einkommen leben müssen, wie eine zusätzliche Steuer wirkt. Hinzu kommt, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten eine Gruppe von sehr reichen Angestellten bildete, die sich zumindest zum Teil an die Stelle der Vermögensbesitzer älterer Herkunft setzte: die führenden Manager großer Unternehmen, die, wie Thomas Piketty meint, vor allem deshalb so viel verdienen, weil sie ihre Entlohnung selbst festsetzen können. Tatsächlich sei in diesen Menschen eine Art Aristokratie wiedergekehrt - eine neue Klasse, die sich grundsätzlich über alle anderen erhebt, prinzipiell nicht belangbar ist und sich wiederum vor allem dynastisch erhalte.
Pikettys Werk ist, gemessen an anderen ökonomischen Fachbüchern, leicht zu lesen. Es ist in kurze Kapitel gegliedert, die aufeinander aufbauen und also beim Unterschied von Einkommen und Kapital beginnen, um bei den Staatsschulden aufzuhören. Und es hat einen Wesenszug des "Kapitals" von Karl Marx übernommen: nämlich die Neigung, aus einem großen Fundus philosophischen und vor allem literarischen Wissens zu schöpfen, um so, in einer einzigen großen Bewegung, einen ganzen Weltzustand für das eigene Vorhaben zu mobilisieren. Die berühmten Romane des 19. Jahrhunderts sind es vor allem, die es Piketty angetan haben, die Bücher, in denen fortwährend von Renten und Erbschaften, von Kredit und Schulden die Rede ist.
Bei Honoré de Balzac, in dessen Roman "Vater Goriot" aus dem Jahr 1835, fand er den Dialog, der die These seines eigenen Werks zusammenfasst: das Gespräch zwischen Eugène de Rastignac, einem mittellosen jungen Adligen, und dem Verbrecher Vautrin. Darin versucht Vautrin, sein Gegenüber von dem Gedanken abzubringen, Medizin oder Jura zu studieren, weil er damit in seinem ganzen Leben nicht das Geld verdienen könne, das er sofort erhalte, wenn er die schüchterne Erbin heiratete, die sich in ihn verliebt hatte.
Unbescheiden ist der Titel des Buches - "Das Kapital im 21. Jahrhundert" - dennoch, vor allem, weil er offen das Hauptwerk von Karl Marx zitiert, und zwar keineswegs, um daran anzuschließen, sondern um es zu ersetzen. "Zweifellos", erklärt Thomas Piketty, "fehlte es Karl Marx an statistischen Daten, um seine Vorhersagen zu verfeinern".
Für den französischen Ökonomen ist das ein Einwand, der an die Substanz geht. Denn das Werk, mit dem er die moderne Volkswirtschaft neu begründen will, fußt vor allem auf Empirie, genauer: auf Angaben zur Einkommen- und Vermögensteuer, die er über fünfzehn Jahre hinweg in einer eigenen Datenbank, der "World Top Income Database", sammeln und mit modernem technischen Gerät auswerten ließ. Das Material reicht dabei nicht überall, aber doch etwa für Frankreich, bis ins späte achtzehnte Jahrhundert zurück und umfasst vor allem die westlichen Industriestaaten. Er sei kein Gegner der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, beteuert Thomas Piketty mehrmals in seinem Buch, er habe nichts gegen das Kapital. Er hätte diese Sätze nicht schreiben müssen. Denn es ist ja die Empirie, die ihn, als wäre er ein Naturwissenschaftler, vor dem Verdacht schützt, er hege eine rebellische Absicht.
Marx auf den Müll
Dennoch gäbe es das Aufsehen nicht, das "Kapital im 21. Jahrhundert" gegenwärtig erregt, rührte das Buch nicht an etwas Skandalöses. Da ist zunächst der Umstand, dass es mit einem gigantischen akademischen Aufwand dem landläufigsten aller Vorurteile gegen den Kapitalismus recht gibt: Denn dass die Reichen immer reicher werden, während die Armen meistens arm bleiben, das weiß der resignierende Volksverstand, ohne deswegen Wirtschaftswissenschaften studiert oder Konjunktur-Institute befragt zu haben. In dieser Moral lebt der Gedanke, dass die Klassengesellschaft nie zu existieren aufgehört hat, auch in Zeiten fort, in denen er durch allerlei Schichtenmodelle oder Statusabstufungen abgelöst zu sein scheint. Da ist aber darüber hinaus die Selbstsicherheit, mit der Thomas Piketty seine Kollegen aus derselben Disziplin mit der Begründung abfertigt, sie spekulierten nur, während er über die harten Daten verfüge. Mit diesem Einwand wird dann nicht nur Karl Marx zum Müll der Geschichte gelegt, sondern auch etwa Simon Smith Kuznets, der amerikanische Ökonom, der nach dem Zweiten Weltkrieg behauptet hatte, im fortgeschrittenen Kapitalismus müsse die Ungleichheit der Einkommen schwinden.
Tatsächlich habe die Ungleichheit in und nach dem Zweiten Weltkrieg abgenommen, genauso wie in und nach dem Ersten, sagt Piketty. Er nennt zwei Gründe: Zum einen habe der Krieg eine beträchtliche Zahl großer Vermögen zerstört, zum anderen sei mit dem Wiederaufbau ein Wachstumsschub entstanden, der eine Rückkehr zur historischen Ungleichheit erst einmal verhindert habe - wie überhaupt Ausbildung, technischer Fortschritt und schnelles Wachstum die Faktoren seien, die dem permanenten Drängen des Kapitals entgegenwirkten, sich so schnell wie möglich zu so großen Haufen wie möglich zu versammeln, und zwar in privater Hand.
Anfang der Siebzigerjahre sei es mit der scheinbaren Vergesellschaftung des Reichtums allerdings vorbei gewesen - wobei es beinahe gleichgültig gewesen sei, ob die Rückkehr zur Privatwirtschaft offensiv wie in den USA und in Großbritannien oder zurückhaltend wie in Frankreich, Deutschland oder Schweden betrieben worden sei. Am Ende stehe doch dasselbe Resultat, nämlich eine oligarchische Verteilung des Reichtums, der zufolge etwa zehn Prozent der Amerikaner über siebzig Prozent des nationalen Reichtums verfügen - und das oberste eine Prozent über die Hälfte davon.
Und was ist mit dem klassischen Einwand gegen alle sozialistisch inspirierte Theorie, den Leuten gehe es heute viel besser als vor fünfzig oder gar hundertfünfzig Jahren? "A rising tide lifts all boats", sagte John F. Kennedy im Jahr 1963, "eine Flut hebt alle Boote". Gemeint war damit, dass ein Wirtschaftswachstum zwar die einen mehr, die anderen weniger begünstige, am Ende aber alle etwas davon hätten. Thomas Piketty kann belegen, dass dieser Glaube in die Irre geht: Etwa sechzig Prozent des Zuwachses an Produktivität, der von den frühen Siebzigerjahren bis heute erreicht wurde, kam keineswegs denen zugute, die ihn hervorgebracht hatten, sondern wurde von Investoren und ihren Managern eingezogen. Pikettys Erfolg in den USA geht auf diesen Nachweis zurück: Er argumentiert nicht wie ein linker Moralist, der die Ungleichheit als solche anprangert. Stattdessen nimmt er den Idealismus der Rechten zumindest scheinbar ernst. Und dass sich mehr Leistung für die meisten Menschen nicht lohnen soll: Das rührt an die Grundlagen dieser Gesellschaft.
Pikettys Argument, wer über die Empirie verfüge, sei auch der Souverän der Theorie, hat eine zweite Seite: Denn wenn es nur um die Daten gehen soll, also nur um Zahlen zur Einkommen- und Vermögensteuer, muss die Wirtschaftsform, aus der sie hervorgehen, als etwas zumindest Untergeordnetes erscheinen. Denn dem Finanzamt kann es gleichgültig sein, ob ein Gewinn aus der Rente für eine Verpachtung von Land, aus der Verzinsung von Staatspapieren, aus dem Ertrag einer Investition in einen Industriebetrieb oder aus der Rendite aus einer Spekulation mit Finanzderivaten hervorgeht. Der französische Ökonom denkt in dieser Hinsicht nicht anders als das Finanzamt: Es geht ihm um das Kapital, nicht um den Kapitalismus.
Seine Überheblichkeit gegenüber Thomas Malthus, David Ricardo oder Karl Marx hat deshalb etwas grundsätzlich Unangemessenes: Denn diese hatten sich darum bemüht, eine bestimmte Wirtschaftsform zu erklären, anstatt nur deren Wirkungen zu addieren. Sie wollten wissen, wie die Werte entstehen, die da angeblich verteilt werden, zu welchem Zweck sie produziert werden, mit welchen Mitteln, von wem und auf wessen Kosten. Thomas Piketty verhält sich dagegen wie ein utopischer Sozialist des neunzehnten Jahrhunderts. Er zeigt die soziale Ungleichheit und ihr exorbitantes Maß auf, um zu dem Schluss zu kommen, sie müsse grundsätzlich reglementiert werden - wobei es vermutlich dieses Ansinnen ist, das ihm die Einladung ins amerikanische Finanzministerium verschafft.
So sehr Thomas Piketty nämlich darauf insistiert, von nichts als von Fakten zu sprechen: Die Kategorie, auf der sein ganzes Unternehmen gründet, nämlich die Ungleichheit, gehört selber nicht zur empirischen Welt, sondern sie ist eine idealistische Setzung. Man merkt, dass sie ihrem Autor Schwierigkeiten bereitet: Denn eigentlich will er sich ja, den eigenen empiristischen Ansprüchen treu, aller Spekulationen und, entschlossener noch: aller Vorhersagen, enthalten. Aber dann erscheinen im Text immer wieder seltsam bedrohliche Sätze wie der, es sei nicht auszuschließen, dass eine allzu deutliche Abkehr von meritokratischen Maßstäben "schreckliche" Folgen für den Zusammenhalt der Gesellschaft haben könne.
Doch einmal abgesehen davon, dass die persönliche Leistung allenfalls einer der Faktoren ist, die der Kapitalismus honoriert - da spielen das Glück, die Größe des zur Verfügung stehenden Kapitals oder die schlichte Rücksichtslosigkeit eine nicht minder große Rolle -, so ist es mehr als zweifelhaft, dass die Verteilung von Reichtum überhaupt ein Anliegen dieser Wirtschaftsform ist. Thomas Piketty, ein Mann, der als französischer Bürger den Sozialisten nahesteht und im Jahr 2007 Ségolène Royal bei ihrer Bewerbung um die Präsidentschaft unterstützte, tut aber in seiner wissenschaftlichen Arbeit so, als wäre Verteilung etwas so Selbstverständliches, dass darüber gar nicht nachgedacht werden müsste.
Dieser Idealismus hat Folgen. Denn er führt zu der Forderung, mit der Thomas Piketty das "Kapital im 21. Jahrhundert" abschließt: dass es eine progressive Vermögensteuer geben sollte, überall auf der Welt, um den jüngsten "auf Vererbung beruhenden Kapitalismus" ("patrimonial capitalism") zu beschränken. Bei Vermögen von über hundert Millionen Euro, die in der Regel eine Rendite von sechs oder sieben Prozent abwürfen, sei dabei durchaus an zwei Prozent jährlich zu denken, vielleicht sogar an mehr. Vielleicht könne die Europäische Union, die ja schon über die institutionellen Voraussetzungen für eine solche Steuer verfüge, das Modell dafür liefern.
Sie wird es nicht tun, weil auch in der Europäischen Union lauter Nationalstaaten darum konkurrieren, das international erfolgreichste Kapital an sich zu binden - etwa mit niedrigen Steuern oder mit geringer Regulierung. Pikettys Utopie indessen ist auch ein Urteil über das "Kapital im 21. Jahrhundert". Denn was ist von so viel Empirie zu halten, wenn die Konsequenz daraus nur ein wenig Empörung ist - und ein Vorschlag, über dessen illusionären Charakter man sich sofort einigen kann?
Linktipps:
- Die New York Times hat Piketty getroffen und porträtiert
- Nassim Taleb wirft Piketty methodische Fehler vor: On the Biases in the Estimation of Inequality Using Bracketed Quantile Contributions
- Piketty hat viele seiner ökonomischen Daten auf seiner Webseite veröffentlicht, zu seinem Buch und anderen Forschungen.
