Linda May hat ihr Zuhause bei einer Auktion erstanden. 1400 Dollar hat der Trailer gekostet, ein blassgelber Hunter Compact, Baujahr 1974. "Der Innenraum ist 1,60 Meter hoch, ich bin 1,50", sagt sie. "Passt perfekt." Sie ist Mitte sechzig, zweifache Mutter, vierfache Großmutter, trägt silbergraue Haare und eine rosa Brille. Die Amerikanerin verbringt ihren Lebensabend in diesem Anhänger beziehungsweise am Steuer ihres Jeep Grand Cherokee, den sie von einem Schrottplatz gerettet hat.
Linda zählt zu einer wachsenden Gruppe von Nomaden in den USA. Sie übernachten neben den Highways, auf Supermarkt-Parkplätzen, in der Wüste, sie füllen ihre Benzintanks mit Saisonarbeit. Diese Workamper, wie sie sich nennen, verladen Zuckerrüben, schieben Rollwagen durch Warenlager, pflücken Äpfel in Oregon und Blaubeeren in Kentucky, bewachen Tore an Ölfeldern in Texas. Meist handelt es sich um Mittelschichtler, in ihren früheren Leben waren sie Manager, Banker, IT-Ingenieure, Sachbearbeiter. Die meisten hat die Finanzkrise von 2008 um ihre Rücklagen gebracht; ohne Altersabsicherung ziehen sie von Job zu Job, von Küste zu Küste. Ihre Häuser und Wohnungen, ihren "real estate", mussten sie tauschen gegen etwas, das sie "wheel estate" nennen: gebrauchte Wohnmobile, ausgediente Schulbusse, Pick-ups mit Campingaufbauten, Trailer.
Diesem Treck durch Amerika ist die Journalistin Jessica Bruder gefolgt, hat selbst Monate in einem Camper verbracht. Ihre Megarecherche spann sich über drei Jahre und 15 000 Meilen, gut 50 Interviews hat sie mit Arbeitsnomaden geführt. (Wie sie allerdings diesen enormen Zeitaufwand finanzierte, erfährt man nicht.) Das Ergebnis ist eine 383 Seiten dicke Mischung aus Dokumentation und Reportage, 2017 in den USA erschienen. Bruder hat an der Columbia Journalism School in New York gelehrt, sie schreibt unter anderem für die Washington Post und das Magazin der New York Times. "Nomaden der Arbeit" basiert auf einem Artikel, den sie für das angesehene Harper's Magazine schrieb. Sie gewann dafür einen Journalistenpreis und war für weitere nominiert. Damit nicht genug: Das Buch wird demnächst verfilmt, mit Oscar-Preisträgerin Frances McDormand in der Hauptrolle.
Solche Ehre wird Journalisten selten zuteil. Bruder eröffnet Einblicke auf ein soziales Phänomen, das so brisant wie tabuisiert ist. Die Workamper leben in einer fast geschlossenen, unsichtbaren Welt, aus Scham oder weil sich ihre Existenz in den Weiten Amerikas und neben den vielen sorglos dauerreisenden Senioren in ihren Riesencampern verliert. Sie haben eigene Strukturen mit eigener Logistik. Sie organisieren sich über Apps, sie angeln sich Jobs durch Inserate auf Websites wie Workers on Wheels und Workamper News, sie helfen sich aus, wenn jemand in akute Not gerät.
Die 500 Dollar Sozialhilfe im Monat reichen nicht, um sich eine Mietwohnung zu leisten
2016 waren fast neun Millionen der über 65-jährigen Amerikaner noch immer angestellt, 60 Prozent mehr als ein Jahrzehnt davor, zitiert Bruder die Statistik. Freilich, und das erwähnt sie nicht, gehören dazu auch Freiwillige, die ohne wirtschaftliche Not einfach gern beschäftigt bleiben; Amerikas Arbeitsrecht kennt keine Altersgrenze nach oben. Mit den Zehntausenden Arbeitsnomaden entstand eine Schattenwirtschaft. Sie sind jederzeit und überall einsetzbar, als Saisonpersonal erscheinen sie, wo und wann sie gebraucht werden. Sie bringen ihr Eigenheim mit und verwandeln Firmenparkplätze vorübergehend in Firmensiedlungen. Sie sind nicht lange genug dabei, um sich gewerkschaftlich zu organisieren. Amerikanische Unternehmen werden steuerbegünstigt, wenn sie "sozial Schwache" beschäftigen; für einen Konzern wie Amazon sind sie daher ideale Aushilfen. Der Versandhändler betreibt eigens ein Programm namens Camper Force: In der Hochsaison, also den vier Monaten vor Weihnachten, engagiert er zusätzlich bevorzugt betagte Wanderarbeiter.
In der Tradition sozialkritischer US-Schriftsteller wie John Steinbeck ("Früchte des Zorns"), Upton Sinclair ("Der Dschungel") oder Barbara Ehrenreich ("Nickel and Dimed") porträtiert Bruder Missstände und soziale Verlierer. Diejenigen, bei denen ein prekäres Elternhaus, schlechte Ausbildung, Krankheit, Scheidung, Drogenmissbrauch oder eben eine Finanzkrise dem American Dream im Weg stehen. Manches Scheitern ist fremd-, manches selbstverschuldet. Linda Mays Tochter etwa kommt wie ihre Mutter kaum über die Runden, dennoch leistet sich die Familie vier Hunde, die sie miternähren muss.
Die Seniorin Linda hat sich auf Campingplätze spezialisiert, zu ihrer Arbeit als Platzwart gehört nicht nur, Tag und Nacht für Neuankömmlinge ansprechbar zu sein, sondern auch dreimal täglich die Toiletten zu putzen. Ihre früheren Jobs waren: Truckerin, Cocktailkellnerin, Versicherungsagentin, Bauinspektorin oder Händlerin mit Bodenbelägen. Sie gibt zu, sich nie um Alterssicherung gekümmert zu haben. Nach vielen Jahren mit mieser Bezahlung verlor sie Wohnung, Arbeit, dann Arbeitslosenhilfe. Alkohol und Meth machten sich in ihrem Leben breit. Sie zog bei einer Tochter und deren Familie ein, bis die ebenfalls aus Geldnot in eine kleinere Wohnung wechseln musste. Sie hat Anspruch auf Sozialhilfe, aber die 500 Dollar im Monat reichen nicht mal für die Miete. Linda landete in ihrem Trailer.
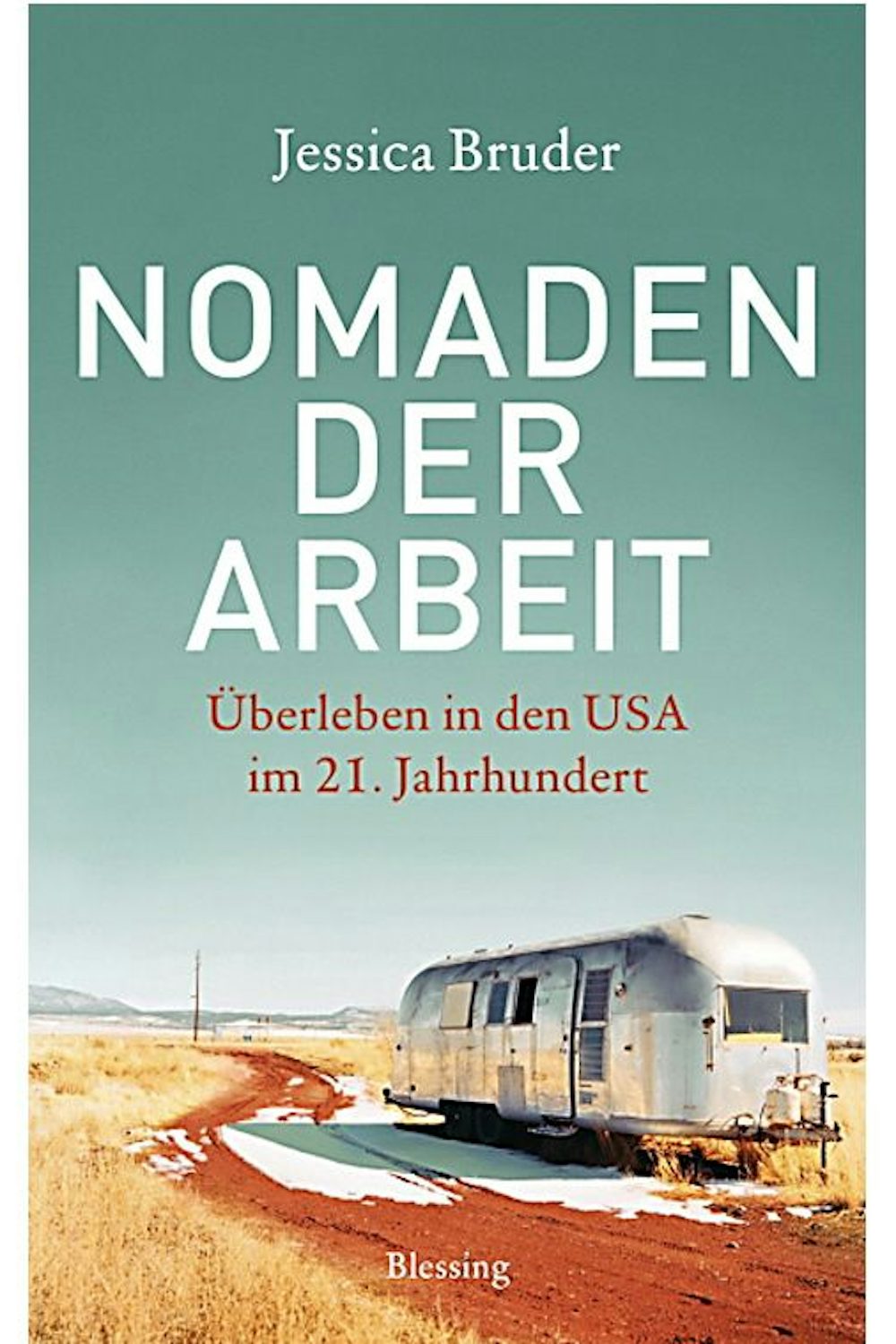
Arbeitsmigranten waren immer Teil der USA. Nach dem Bürgerkrieg (1861 - 65) zogen Schwarze gen Norden, wo Stahl-, Kohle- und später Autofabriken Arbeit en masse boten. Die Wirtschaftskrise nach dem Börsencrash 1929 brachte in den frühen 30er-Jahren die "Okies" nach Westen, und seit jeher ist Amerikas Landwirtschaft auf mexikanische Saisonarbeiter angewiesen. Was die aktuellen Workamper besonders macht: Sie sind weiß und betagt. Und sie teilen sich eine amerikanische Tugend: Sie tragen ihr Schicksal mit Würde, Gejammer würde es nur schwerer machen. Sie verweigern den Begriff "homeless", nennen sich lieber "houseless" und sehen in ihrem Dasein durchaus auch eine große Freiheit. Im wohlfahrtsverwöhnten Europa mag das für manchen zynisch klingen, aber vielleicht ist solch ein autarkes Leben in der Tat würdevoller als das deutscher Sozialhilfeempfänger, die bei Bier und RTL 2 ruhiggestellt werden.
So eindrücklich Bruders Beobachtungen sind - irgendwann verliert sie sich darin. Das Buch gerät zu detailliert, zu lang, zu redundant. Analytisches kommt zu kurz, ebenso die Stellungnahme von Verursachern und Verantwortlichen: von Politikern, die Arbeitsgesetze erlassen, von Pensionsfondsverwaltern, die die Rentner um ihre Ersparnisse brachten, von Firmen wie Amazon, deren Praktiken die Autorin anprangert. Als sie auch noch über zwei lange Kapitel schildert, wie sie sich ihren eigenen Trailer aussucht und einrichtet, um selber in einer Zuckerrübenfabrik und einem Warenlager zu jobben, denkt man sich: Jetzt ist gut, man kann seinen Protagonisten auch zu nahekommen.
Ein Lektor hätte Bruder und ihren Idealismus bremsen sollen. Doch im Kern ist das Buch eine spannend geschriebene Dokumentation. Auf seine Verfilmung kann man sich freuen.