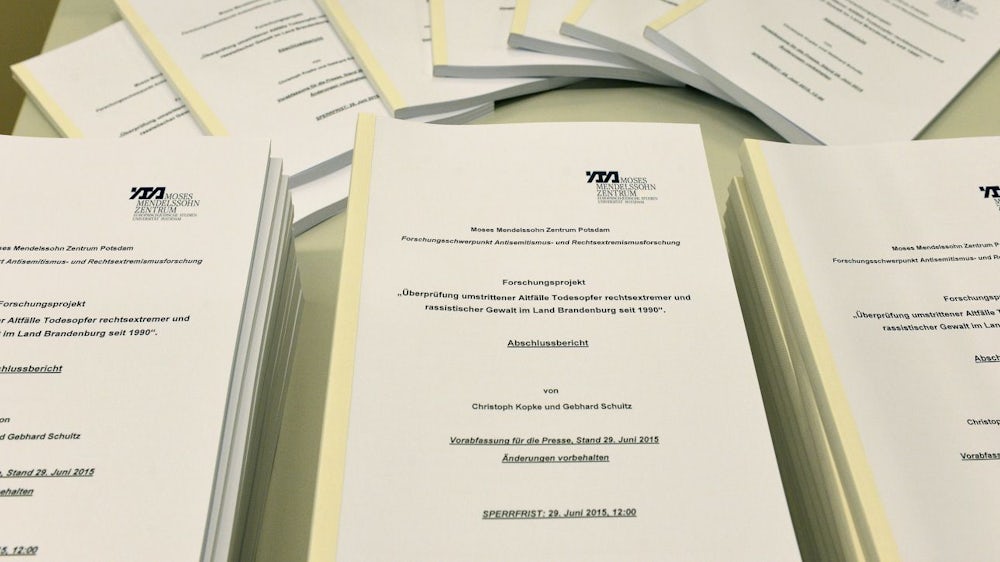SZ: Sie haben 24 Fälle in Brandenburg auf einen rechtsextremen Hintergrund untersucht - welcher hat Ihnen am meisten Kopfzerbrechen bereitet?
Christoph Kopke: Auch wenn wir letztlich den politischen Hintergrund in dem Fall nicht verifizieren konnten: Das ist der Fall von Kajrat Batesow, einem russischen Spätaussiedler. In einer Disco wurden er und ein Freund angepöbelt und geschlagen. Ein Täter warf einen schweren Feldstein auf Batesow. Er starb im Krankenhaus. Die Täter gaben an, die Männer hätten Stress gemacht, aggressiv nach Zigaretten gefragt. Daraus hätte sich eine Schlägerei entwickelt.
Knapp drei Monate nach den Schlagzeilen aus Tröglitz hat wieder ein für Flüchtlinge vorgesehenes Gebäude gebrannt. Diesmal wurde in Meißen Feuer gelegt. Nicht weit weg, in Freital, zeigt sich weiter jeden Abend fremdenfeindliche Stimmung.
Die Täter kamen aus der Technoszene und waren Zivildienstleistende. Klingt nicht nach dem klassischen rechtsextremen Täterprofil.
Tatsächlich nicht. Trotzdem ist das Ganze sehr seltsam. Zeugen wurden unter Druck gesetzt, das ganze Klima war gegen die Spätaussiedler. Kajrat Batesow hatte schon vorher wegen verschiedener Angriffe Kontakt zur Opferperspektive aufgenommen. Deswegen kann ich persönlich nicht glauben, dass es so abgelaufen ist, wie die Täter es beschreiben. Allerdings ist schon das Gericht daran gescheitert, den Fall lückenlos aufzuklären. Auch wir können keine eindeutige Einschätzung zu dem Fall abgeben.
64 Todesopfer rechtsextremer Gewalt tauchen deutschlandweit in der offiziellen Statistik auf - Journalisten sprechen dagegen von 152, die Amadeu-Antonio-Stiftung sogar von 184. Woher kommen diese großen Unterschiede?
Diese Statistik beruht auf der Einschätzung der Polizei, die mithilfe bestimmter Kriterien versucht, zeitnah politisch motivierte Straftaten festzustellen. Dabei haben sie grundsätzlich erst mal weniger Informationen zur Verfügung als Journalisten, die später in einem Prozess sitzen.
Die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit rechtsextremer Gewalt fallen in die neunziger Jahre. Wie erklären Sie sich das?
Nach der Wiedervereinigung brechen in Ostdeutschland staatliche aber auch familiäre Strukturen weg - plötzlich kümmert sich keiner mehr um eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen. In den Fällen, die wir untersucht haben, zeigen sich große Tendenzen von Verwahrlosung und Desintegration. Diese Entwicklung geht einher mit einer starken rassistischen und rechtsextremen Mobilisierung. Es gibt Kinder- und Jugendcliquen, die alles weghauen, was ihnen nicht in den Kram passt, und die sich eindeutig rechts verorten. Gleichzeitig gibt es große Defizite in der Zivilgesellschaft, die Probleme hat, auf die Fälle angemessen zu reagieren. Es wurde weggeschaut, das Problem kleingeredet.

Falko Lüdtke stellt einen Rechtsextremisten zur Rede - wenig später ist er tot. Das Gericht gibt Lüdtke eine Teilschuld. Erst 15 Jahre später wird er rehabilitiert.
Aber auch im Westen gab es Todesopfer.
Eine ganze Reihe abscheulicher und wirklich politisch gemeinter Taten sind in Westdeutschland passiert - auch schon vor der Wende. Dennoch glaube ich, dass die flächendeckenden Krawall- und Gewalttaten eher in Ostdeutschland stattfanden und dann auch in den Westen zurückgeschwappt sind. Man konnte richtiggehend beobachten, wie die ostdeutsche rechtsextreme Jugendkultur die Randgebiete zum Westen erobert - beispielsweise in Franken. Vielleicht schaut man auch im Osten mehr hin.
Besonders in den neunziger Jahren wurden von der Polizei nur wenige Todesopfer rechtsextremer Gewalt anerkannt. Warum?
Grundsätzlich fehlten zu der Zeit eindeutige Kriterien. Eine politische Tat musste auch eindeutig als solche gemeint sein, der Täter eindeutig eine politische Absicht verfolgen, die zur Systemüberwindung führen sollte. Warf ein Skinhead einen Molotowcocktail auf einen Dönerladen, war das nur Brandstiftung. Hätte er gleichzeitig "Heil Hitler" gerufen oder "Nieder mit der Bundesrepublik Deutschland", wäre es politisch motiviert gewesen. Erst durch die Einführung der Statistik für politisch motivierte Kriminalität können Polizisten die Motivation des Täters oder auch die Opfergruppe mit in die Bewertung aufnehmen. Aber natürlich gibt es Schwächen.

Zehn Jahre nach dem Mord an Theodoros Boulgarides erinnert München mit einer Gedenkfeier an die Opfer des NSU-Terrors. So viel Aufmerksamkeit gab es in der Stadt lange nicht.
Welche?
Es geht um ein schnelles Lagebild, und da ist es oft schwierig zu bestimmen, was das tatbegleitende oder tatbestimmende Motiv ist. Nehmen wir einen Fall aus unserem Bericht. Der arbeitslose und psychisch Kranke Wolfgang Auch wurde von einer Gruppe von Jugendlichen zu Tode geprügelt. Man könnte es so sehen, dass der eine vielleicht zugeschlagen hat, weil er es lustig fand, der andere, weil er sich großtun wollte vor seinen Kumpels. Aber wenn ich mir in dem Fall die komplette Gemengelage anschaue, stellt es sich anders dar: Die Gruppe definiert sich als eindeutig rechtsextrem. Der Spielplatz ist bekannt, andere Jugendszenen trauen sich da nicht hin, weil sie Angst haben, geschlagen zu werden. In der Gesamtperspektive gibt es für mich also ein politisches Motiv.
Würde es aus Ihrer Sicht Sinn machen, ein Nachmeldesystem einzuführen?
Dafür müsste die Justiz in der Lage sein, den politischen Charakter von Taten herauszustellen. Wenn ich an die Aktendurchsicht denke, erkennt die Polizei noch am meisten rechtsextreme Taten. Es kommt vor, dass in den Ermittlungsakten von einer örtlichen rechtsextremen Jugendszene die Rede ist - im Urteil steht dann nur was von einer Jugendszene. Wenn sich ein Nachmeldesystem auf Gerichtsurteile bezieht, könnten wir genau den gegenteiligen Effekt haben. Dann würden weniger Fälle als politisch motiviert eingestuft.
Stimmt es also, dass die Justiz auf dem rechten Auge blind ist?
Nein - es gibt durchaus nachvollziehbare Gründe, warum Gerichte auf eine politische Einschätzung verzichten. Totschlag mit Todesfolge ist durch Fakten beweisbar, Rassismus oder Rechtsextremismus sind als Motive schwerer nachzuweisen. Findige Anwälten nehmen das auseinander und haben dann einen guten Anlass, in Revision zu gehen. Manchmal ist es vielleicht für den Staatsanwalt schwierig, das politische Motiv zu sehen, weil er unter Politik ausgefeilte Konzept oder höhere Ziele versteht. Manche Rechtsextreme definieren ihre Ideologie aber einfach und schlicht darüber, dass sie "gegen Ausländer" und "für Deutschland" sind.
Was sollte sich dann aus Ihrer Sicht ändern?
Man sollte die Statistik für politisch motivierte Kriminalität entmystifizieren. Einerseits sollten die Kriterien öffentlich gemacht, aber auch der Aktualität angepasst werden. Gleichzeitig müssen die Menschen verstehen, dass die Statistik nicht die Wahrheit beansprucht. Es ist ein polizeiliches Erfassungssystem und nicht dazu da, abzubilden, was es an Rechtsextremismus im Land gibt. Dafür haben wir ja auch die Journalisten, zivilgesellschaftliche Bündnisse und Opferberatungsstellen. Aus den verschiedenen Perspektiven ergibt sich ein Gesamtbild und eine realistische Lagebeurteilung.
In Ihrem Bericht stufen Sie neun Fälle als eindeutig politisch motiviert ein. Warum ist es wichtig, dass der Staat diese Opfer offiziell anerkennt?
Es ist wichtig für die Angehörigen und die Freunde der Opfer. Und es ist wichtig für die örtliche Gesellschaft, sich vor Augen zu führen, was passiert ist. Denn es gibt in vielen Fällen eine unglaubliche Empathielosigkeit: Zeugen greifen nicht ein, rufen nicht einmal die Polizei. Ich finde es viel wichtiger, darüber zu sprechen, welche konkreten Konsequenzen aus rechtsextremer Gewalt zu ziehen sind. Dazu gehört, sich zu fragen, was wir für eine Einwanderungs- und Jugendpolitik machen wollen. Nach der Entdeckung des NSU hat es der Staat nicht geschafft, das Vertrauen der migrantischen Community zurückzugewinnen. Das wäre viel wichtiger, als große Veranstaltungen mit Kerzen und Broschüren auszurichten, wo man verspricht, was man nicht halten kann oder will: 'lückenlose Aufklärung'.