Nach all den Jahren hat sie den Duft noch immer in der Nase: Rosinen und Olivenöl. Ein kleines Kind war Lisbeth Schmidt damals, als der Vater die Pakete schickte - aus Griechenland, wo er stationiert war. Die Rosinen und das Olivenöl wurden in der Familie verteilt, "ein Schatz für uns". Vor Jahren hat Lisbeth Schmidt noch eine Erinnerung an den Vater gefunden, eine handfestere als die Gerüche aus der Vergangenheit: Fotoalben. In einer Kiste, die sie beim Ausräumen der elterlichen Wohnung unbesehen in den eigenen Keller übersiedelt hatte, lagen sie.
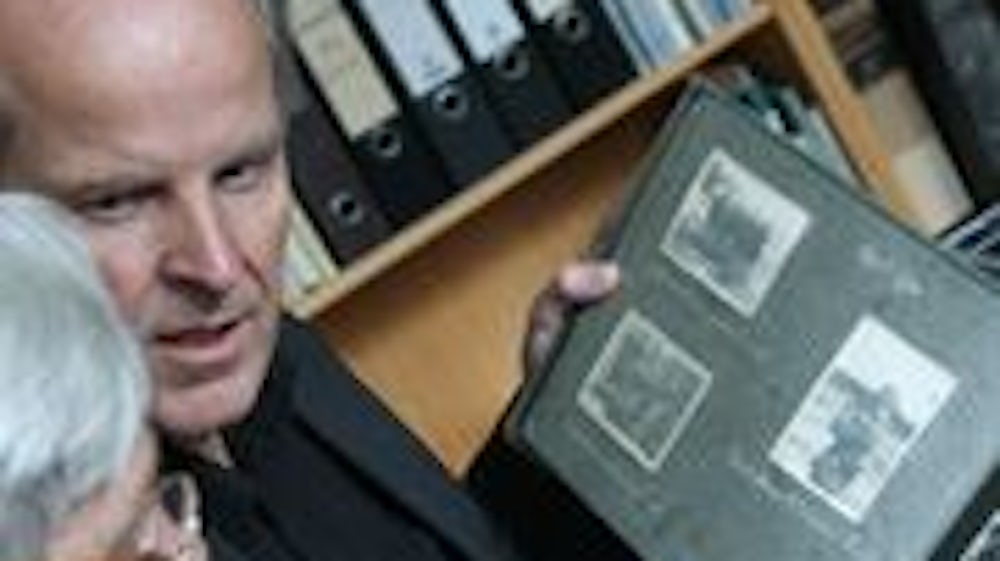
Lisbeth Schmidt dachte ab und zu sogar daran, dass sie sie nach oben holen wollte. Doch immer kam etwas dazwischen: die Familie, der Beruf. Dann las sie den Aufruf in der Zeitung - und ging noch am selben Tag in den Keller. Nun sitzt sie da, in einem Nebenraum des Stadtmuseums, mit einem Experten für historische Aufnahmen an ihrer Seite und blättert die Alben des Vaters durch. Man sieht keine lachenden Kindergesichter, keine Ausflüge mit der Familie in die Berge. Die Fotos zeigen den Krieg, wie ihr Vater ihn sehen wollte.
Aufgenommen hat er Menschen, die auf Eseln reiten, die Akropolis, blühende Agaven, Fischer, die Netze flicken. "Schöne Bilder sind das", sagt Ulrich Pohlmann, dem die Fotosammlung des Stadtmuseums untersteht. "Ihr Vater hatte einen guten Blick." Doch wo ist der Krieg? "Sieht aus wie ein Urlaubsalbum", wundert sich die Tochter, aber der Kunsthistoriker Pohlmann hat eine Erklärung. Das Fotografieren im Krieg habe vielen Soldaten "Stabilität" gegeben in einer Welt, die aus den Fugen geraten war. "Alle bürgerlichen Werte wurden ja plötzlich in Frage gestellt", sagt Pohlmann. Und mit dieser Ausnahmesituation ging jeder auf seine Art um. Lisbeth Schmids Vater simulierte Frieden.
Fotos des Grauens
Andere dokumentieren in ihren Fotos das Grauen: die Kreuze auf den Gräbern der Kameraden, die aufgequollenen Pferdekörper. Gern fotografiert wurden auch die Kriegerdenkmäler der anderen, "um den eigenen Triumph auszukosten", wie Pohlmann vermutet. Blättert man die Alben chronologisch durch, lässt sich ablesen, wie der Kriegsverlauf auch die Kriegsteilnehmer veränderte.
Wer anfangs noch in Siegerpose vor dem Eiffelturm posierte, hat den Krieg später im Osten anders erlebt. Dann zeigen die Bilder Kameraden, die sich durch den Matsch kämpfen, meterhohe Schneewehen oder Kreuze im Acker. Unter einem Bild steht, feinsäuberlich in weißer Tinte geschrieben: "Division Heldenfriedhof". "Da herrschte längst Galgenhumor", sagt Pohlmann. Division, das waren eigentlich die Lebenden.
"Fremde im Visier" heißt die Ausstellung, die bis 28. Februar im Stadtmuseum zu sehen ist. Sie zeigt "Knipserbilder" aus dem Zweiten Weltkrieg, was kein despektierlicher Begriff ist, sondern Fotos bezeichnet, die Amateure aufgenommen haben.
Viele solcher Amateur-Alben lagern noch heute auf Dachböden oder in Kellern, wurden oft weggeräumt, weil die Nachgeborenen nichts damit anzufangen wissen - oder weil das Erbe verstört. Aber die Alben einfach wegzuwerfen, davor scheuen viele dann doch zurück. Die Bilder gehören zur Familiengeschichte, wenn auch aus einer dunklen Zeit. Oft aber sind sie schwer zu deuten, weshalb das Museum an einigen Ausstellungstagen den Besuchern anbietet, mit ihren eigenen Alben vorbeizukommen.
Marlis Eichinger hat zwei Stunden Anfahrt auf sich genommen, jetzt packt sie drei Alben aus ihrem Rucksack. Gebunden mit einer Kordel, der Deckel aus verblichenem Leinen, eines grün, eines orange. Das grüne trägt den Reichsadler mit Hakenkreuz im Eichenlaubkranz. Darunter die Nummer seines Infanterie-Regiments.

Exotische Eindrücke und grausamer Kriegsalltag. Eine Ausstellung des Münchner Stadtmuseums zeigt private Fotografien aus dem Zweiten Weltkrieg.
Ihr Schwiegervater, sagt Eichinger, sei bei der SA gewesen. Und es gibt einiges, das sie ihn gerne gefragt hätte, nur die Gelegenheit dazu hat sie nie bekommen. 1944 ist der Schwiegervater gefallen, selbst Eichingers Mann kannte den Vater kaum. Seine Mutter erzählte gern von Koffern voll mit Rindfleisch, Wein oder Bürsten, die er zum Heimaturlaub mitbrachte. Nur vom Krieg erzählt hat er selbst ihr nicht. Dabei war er von Anfang an dabeigewesen.
Seine Fotos zeigen den Einmarsch in Österreich: das Ehepaar, bei dem der SA-Mann in Linz einquartiert war, das umkränzte "Elterngrab des Führers" in Leonding, jubelnde Menschen, die Hand zum Hitlergruß erhoben. "Aus welcher Perspektive hat er das aufgenommen?", will Marlis Eichinger wissen. Aus der Perspektive des marschierenden Soldaten, antwortet Pohlmann. Aus der Perspektive eines Mannes, der mitten im Geschehen war.
Wie weit der Schwiegervater verstrickt war, versucht die Schwiegertochter zu ergründen. Die Fachliteratur hat sie gewälzt. Und doch sind Fragen offen geblieben. Wo überall war er im Einsatz? Was hat er getan? Es gibt Lücken, die sie irritieren, Bilder, die herausgenommen wurden. Vieles lässt sich allein anhand der Fotos nicht klären, aber auf manche Details kann Pohlmann Eichinger aufmerksam machen: Die Männer ohne Gewehr? Französische Kriegsgefangene. Die Juden, die die Hand zum Gruß heben? Tun es, weil es so Vorschrift war, wenn sie einem Uniformierten begegneten.
Entlarvender als die Bilder sind meist die Bildunterschriften. Da werden Juden als "das auserwählte Volk" und Farbige hinter Stacheldraht - Kriegsgefangene der französischen Armee - als "Verteidiger der Grand Nation" verspottet. Auf einem Foto in Eichingers Album lehnt der Leichnam eines verbrannten Soldaten an der Wand, den Helm noch auf dem Kopf. "Da saß ein Volltreffer", hat ihr Schwiegervater dazu notiert.
Etwas mulmig zumute
Zweimal bereits hat das Stadtmuseum eingeladen, Alben mitzubringen. Anfangs war Pohlmann etwas mulmig zumute: Würde überhaupt jemand kommen? Und wie werden die Menschen reagieren? Dann standen sie Schlange, beim ersten Mal. Manche kamen allein, andere mit der ganzen Familie. Einer wollte wissen, wie viel seine Fotos bei Ebay einbringen würden. Ein anderer brach in Tränen aus beim Anblick der Bilder.
Manche haben einfach das Bedürfnis zu reden. Und manche überlassen ihre Alben gleich dem Museum, weil die Kinder damit eh nichts anfangen können. Heidi Knetsch tut das; sie will die Alben "zu treuen Händen" übergeben. Bei der Marine war ihr Vater, sein Schiff sank im Schwarzen Meer, er aber überlebte, weil eine rumänische Apotheker-Familie den mit schweren Verbrennungen Gestrandeten in Fett und Filz wickelte. Solche Alben, die dem Museum überlassen werden, will Pohlmann archivieren und später auswerten.
Marlis Eichinger packt ihre Alben wieder ein. Zuhause wird sie sie in den Schrank räumen neben die anderen Alben. Die mit den lachenden Kindergesichtern und den Ausflügen in die Berge.
Termine für die "Fotoalben unter der Lupe": 16. Dezember, 13. und 27. Januar, 10. und 24. Februar, jeweils 15- 17 Uhr in der Ausstellung im Stadtmuseum.