Wozu noch Journalismus? Die Ethik der Medienmacher ist in Gefahr: Journalisten werden zu Handlangern der Politiker, bloggen im Netz und werden durch Laien ersetzt. Wie ist der Journalismus zu retten - und wieso sollten wir das überhaupt tun? In dieser Serie - herausgegeben von Stephan Weichert und Leif Kramp - setzen sich angesehene Publizisten auf sueddeutsche.de mit dieser Frage auseinander. Zum Schluss schreibt Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, worauf es beim Journalismus ankommt und geht auch auf die diversen Beiträge der Serie ein und fasst diese zusammen.

Es gibt eine merkwürdige Angst vor der Bloggerei. Es wird so getan, als sei die Bloggerei eine Seuche, die via Internet übertragen wird und den professionellen Journalismus auffrisst. Das ist, mit Verlaub, Unfug. In jedem professionellen Journalisten steckt ein Blogger. Der Blog des professionellen Journalisten heißt FAZ oder SZ, Schweriner Volkszeitung oder Passauer Neue Presse, Deutschlandfunk oder Südwestradio. Der sogenannte klassische Journalist hat dort seinen Platz, und er hat ihn in der Regel deswegen, weil er klassische Fähigkeiten hat, die ihn und sein Produkt besonders auszeichnen.
Es gibt das etwas altbackene Wort "Edelfeder" für die Journalisten, die mit der Sprache besonders behände umzugehen vermögen. Der professionelle Journalist ist, wenn man bei diesem Sprachgebrauch bleiben will, eine Art Edelblogger.
Ein guter Journalist ist ein Scott
Dass der Journalismus - gedruckt, gemailt, getwittert, gesendet - überleben wird, glauben alle Sachverständigen, die sich in dieser Serie äußern; die meisten glauben, dass er gut überleben wird. "So groß kann keine Krise sein, dass er verschwände" sagt Peter Glaser. Sascha Lobo meint, die Gesellschaft brauche "professionellen Journalismus dringender als je zuvor, weil die Flut der Informationen den Bedarf an Einordnung, Sortierung und Bewertung der Fakten und ihrer Zusammenhänge exponentiell erhöht". Dirk von Gehlen konstatiert freilich, dass der "mediale Frontunterricht" zu Ende gehe. Jetzt komme es für Journalisten darauf an, "ein Forum führen zu können". Und Jörg Sadrozinski sieht die Journalisten als trusted guides in einem tiefgreifenden Transformationsprozess agieren. "Die Zukunft des Journalismus liegt", so einfach ist es und so einfach sagt es Axel Ganz, "im Journalismus." Er hat recht. Und deshalb sollten Journalisten, Verleger und Medien-Geschaftsführer nicht so viel von Pressefreiheit reden, sondern sie einfach praktizieren.
Der Journalismus wird sich nicht mehr so fest wie bisher am Papier festhalten, er löst sich zum Teil davon; aber er löst sich nicht auf. Er verändert seinen Aggregatzustand, er ist nicht mehr so fest, wie er es hundertfünfzig Jahre lang war, er ist schon flüssig geworden, vielleicht wird er gasförmig. Das wird ihm nicht schaden. Gase erfüllen jeden Raum. Ein Journalismus, der Angst vor solchen Veränderungen hätte, wäre ein Unglück. Ein guter Journalist ist ein Forscher, ein 'Entdecker, ein Erklärer - er ist ein Amundsen, er ist ein Scott. Er kann Dinge, die andere nicht können und er traut sich Dinge, die sich andere nicht trauen.
Mit dem Journalismus ist es so ähnlich wie mit anderen Berufen auch. Es gibt in Deutschland 20.000 Richter; aber es gibt viel, viel mehr Leute, die sich auch täglich ihr Urteil bilden. Es gibt in Deutschland 310.000 Polizisten. Aber es gibt noch viel mehr Leute, die auch ganz gut darauf aufpassen, was in ihrer Umgebung passiert. Es gibt zigtausend examinierte Pädagogen und Erzieher in Deutschland. Aber es gibt viel, viel mehr Leute, Mütter und Väter, die Kinder erziehen, ohne dass sie das studiert haben. Die Leute, die sich ihr Urteil bilden, ohne dass sie Jura studiert haben, machen die Richter nicht überflüssig. Die Leute, die sich um ihr Wohnviertel kümmern, machen Polizisten nicht überflüssig. Und Leute, die ihre Kinder erziehen, machen Pädagogen nicht überflüssig.
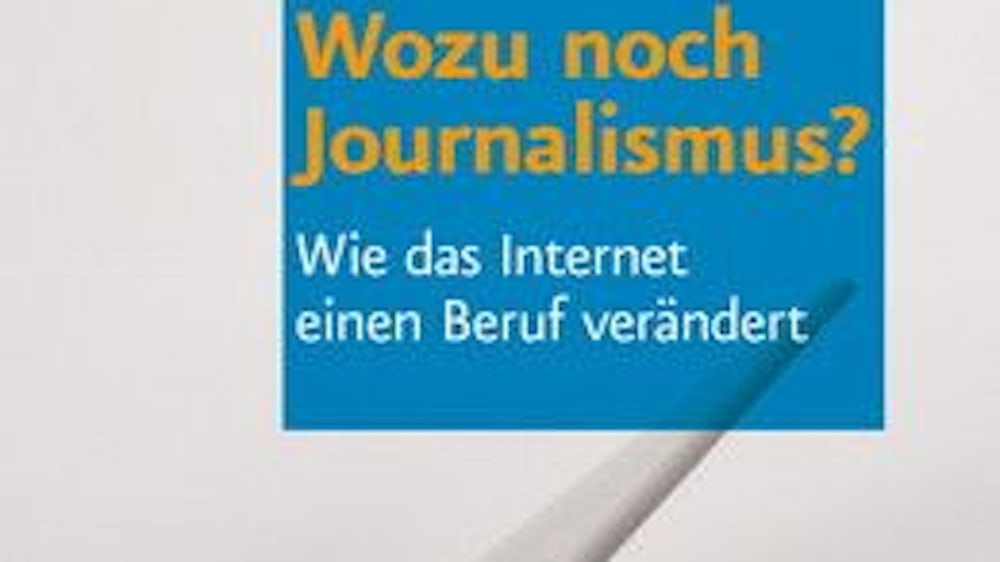
So ist das mit dem Journalismus auch. Es gibt in Deutschland zigtausend professionelle Journalisten. Aber es gibt noch viele, viele andere Leute, die auch ganz gut lesen und schreiben können, aber nicht recherchieren, reportieren, kommentieren und pointieren gelernt haben. Wenn es darum geht, vertraut man den Profis. Ein Möbelverkäufer, Fitnesstrainer oder Geschäftsführer, ein Richter, Polizist, Pädagoge oder Meteorologe, der wissen will, was in der Welt passiert und was er davon halten soll, will normalerweise nicht lesen und hören, was andere Möbelverkäufer, Fitnesstrainer oder Geschäftsführer davon halten, sondern was ein professioneller Journalist, ein Experte also, dazu sagt oder schreibt. Professioneller Journalismus erklärt verlässlich, was passiert - nach professionellen Kriterien. Wenn ein Möbelverkäufer oder ein Fitnesstrainer das aus irgendwelchen Gründen auch kann, dann - herzlichen Glückwunsch.
Der Journalismus ist keine verspätete Veranstaltung des hochmittelalterlichen Zunftwesens. Den Journalismus kann man also nicht mit Zunftordnung und Zunftzwang verteidigen - sondern nur mit Können. Der Journalismus ist schon immer ein besonders freier Beruf gewesen. Und die Bloggerei ist eine neue Bühne für diese Freiheit. Wie viel guter Journalismus auf dieser Bühne gedeiht, muss sich noch zeigen. Kein Schauspieler muss sich vor einer neuen Bühne fürchten. Ein Journalist auch nicht.
Ich weiß also wirklich nicht, warum man sich als Zeitungsmensch vor den Blogs oder auch vor digitalen Zeitungen fürchten soll. Eine gute digitale Zeitung macht das, was eine gute klassische Zeitung auch macht: ordentlichen Journalismus. Man sollte damit aufhören, Gegensätze zu konstruieren - hier Zeitung und klassischer Journalismus, da Blog mit einem angeblich unklassischen Journalismus. Man sollte schon gleich gar damit aufhören, mit ökonomischem Neid auf die Blogs zu schauen. Dort wird kaum Geld gemacht. Man sollte auch das Lamento darüber aufhören, dass der klassische Journalismus in einem Bermuda-Dreieck verschwinde. Wenn er das täte, dann hätte er das Attribut "klassisch" nicht verdient, dann wäre er halt einfach nicht gut oder nicht gut genug gewesen.
Konkurrenz belebt das Geschäft
Der gute klassische ist kein anderer Journalismus als der gute digitale Journalismus. Die Grundlinien laufen quer durch diese Cluster und Raster. Es gibt guten und schlechten Journalismus, in allen Medien. So einfach ist das. Und wer sich durch die Wasser- und vor allem durch die Abwasserleitungen des Internets klickt, der merkt ziemlich schnell, wie guter und wie schlechter Journalismus aussieht - und was den Namen Journalismus nicht verdient und womöglich auch gar nicht beansprucht.
Noch nie war Journalismus weltweit zugänglich; heute ist er es. Noch nie hatten Journalisten ein größeres Publikum als heute, nach der digitalen Revolution. Noch nie war die Konkurrenz so groß; sie belebt das Geschäft. Sie schafft Bedürfnisse. Noch nie war das Bedürfnis nach einem orientierenden, aufklärenden, verlässlich einordnenden, klugen Journalismus so groß wie heute. Die Texte, die dieser Journalismus produziert, werden Nachrichten im Ursinne sein: Texte zum Sich-danach-Richten. Internet ist die globale horizontale Verbreiterung des Wissens. Guter Journalismus geht in die Tiefe.
Es gibt die Pressefreiheit, weil die Presse auf die Demokratie achten soll. Diese Achtung beginnt mit Selbstachtung. Es wird daher, und in den Zeiten des Internets mehr denn je, gelten: Autorität kommt von Autor und Qualität kommt von Qual. Dieser Qualitäts-Satz steht zwar in der Hamburger Journalistenschule, aber er gilt nicht nur für Journalistenschüler. Er meint nicht, dass man Leser und User mit dümmlichem, oberflächlichem Journalismus quälen soll. Qualität kommt von Qual: Dieser Satz verlangt von Journalisten in allen Medien, auch im Internet, dass sie sich quälen, das Beste zu leisten - und er verlangt von den Verlegern und Medienmanagern, dass sie die Journalisten in die Lage versetzen, das Beste leisten zu können. Dann hat der Journalismus eine glänzende Zukunft.
Prof. Dr. jur. Heribert Prantl ist Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung und leitet die Redaktion Innenpolitik.
Im Herbst 2010 erscheint das Buch Wozu noch Journalismus? Wie das Internet einen Beruf verändert im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht.