SZ: In der Flüchtlingsdebatte warnen viele vor jungen, muslimischen Männern: Sie seien aggressiv, sexistisch, gefährlich. Woher kommt dieses Bild?
Kübra Gümüşay: Das ist ein sehr typisches Bild, das schon in den vergangenen Jahrzehnten präsent war. Der türkische Mann zum Beispiel wurde immer als potenzielle Gefahr für die deutsche Frau gesehen: ein Mann, der sehr potent, aggressiv, sexuell aufgeladen und respektlos gegenüber Frauen sein soll. Ein ähnliches Bild gab es in den 50er Jahren von Italienern, später richtete sich dieses Bild gegen Türken und Araber, gegen die Kinder der Gastarbeiter. Noch etwas später wurden die Männer dann primär als "Muslime" gesehen.
Warum hält sich das Bild so hartnäckig?
Es sagt eigentlich mehr über die deutsche Gesellschaft aus als über den Islam oder diese Männer. Nämlich darüber, wie sich die Deutschen selber sehen. Sie zeichnen ein idealisiertes Bild von Deutschland als Gesellschaft, in der es keinen Sexismus gibt. Stattdessen versuchen sie, den Sexismus in der eigenen Gesellschaft auf die neu Dazugekommenen zu projizieren, um damit zu suggerieren, dass das Problem importiert sei. Besonders krude wird es, wenn erzkonservative Politiker, die nichts mit Feminismus am Hut haben, plötzlich Sexismus beklagen, wenn es um Muslime oder Geflüchtete geht. Sie vereinnahmen damit die feministische Debatte für ihre politischen Ziele.
Wie äußert sich das Bild außerhalb der Politik?
Es zieht sich durch die ganze Populärkultur, in der Musik, im Kino. In Filmen zum Beispiel gibt es für muslimische Männer fast ausschließlich die Rolle des prolligen Gangsters, der aggressiv ist, respektlos gegenüber Frauen. Selten werden diese Männer als intellektuelle Wesen dargestellt, als klug, feinsinnig oder mal melancholisch, philosophisch. Erlaubt sind Rollen, wie sie zum Beispiel Elyas M'Barek häufig spielt: Der arabischstämmige Mann ist ein Player, er hat Sprachprobleme, er ist vielleicht lustig, aber auch ein wenig dumm.
Sie erwähnen, dass es ein ähnliches Bild von Italienern gab - geht es nicht eher um das Stereotyp des impulsiven, unkontrollierbaren Südländers als um den Islam?
Mit dem Islam ist es speziell verbunden, weil es sehr viele Bemühungen gab, das Bild theologisch und kulturell zu begründen. Ein Beispiel dafür ist die Publizistin Necla Kelek. Wenn sie zum Beispiel im Fernsehen sagt: Der muslimische Mann sei sexuell so aufgeladen, dass er - wenn er keine Frau finde - sich an Tieren vergehe. Und auch an anderer Stelle wurde versucht, das Bild des sich nicht unter Kontrolle habenden muslimischen Mannes in einen Kausalzusammenhang zur Religion zu stellen. Indem zum Beispiel der Prophet Mohammed als frauenfeindlich und sexuell aggressiv dargestellt wurde. Damit steht das Stereotyp in einem Gesamtkontext, der schwerer zu entlarven ist als das klar rassistische Bild, das es etwa von Italienern gab.
Wie ist denn das Männerbild im Islam?
Theologisch gesehen, gibt es im Islam kein festgeschriebenes Männerbild. Genauso wenig, wie es ein festgeschriebenes Frauenbild gibt. Grundsätzlich gilt der Prophet als Vorbild, aber es gibt sehr viele verschiedene Auslegungen und Interpretationen seiner Person. So gibt es Theologinnen und Theologen, die schreiben: Der Prophet war ein Mann, der im Haushalt nicht nur geholfen, sondern richtig im Haushalt gearbeitet hat. Die Pflichten waren nicht primär die der Frau, sondern man hat sie sich aufgeteilt. Der Prophet nähte demnach seine Gewänder selbst und flickte seine Schuhe. In der Praxis ist in den muslimisch geprägten Ländern das Männerbild sehr unterschiedlich. In der westlichen Welt herrscht aber eine ziemlich festgelegte Vorstellung des islamischen Mannes. Es ist sehr schwer, sich davon zu befreien.

Sie sind jung, wollen Rechtsanwalt werden oder Architekt. Sie rappen auf Deutsch und sprechen über das Land, das sie verlassen mussten und doch im Herzen tragen.
Wie wirkt sich das auf das Leben muslimischer Männer aus?
Das Traurige ist, dass viele Menschen anfangen, den Rollen zu entsprechen, die die Gesellschaft für sie vorsieht. Wenn es in der Gesellschaft nur eine Rolle für mich gibt, dann ist es leichter, mich in sie zu fügen, als dagegen aufzubegehren. Im Alltag haben es muslimische Männer einerseits etwas leichter als muslimische Frauen, weil sie häufig nicht sofort als Muslime erkennbar sind - anders als Frauen, die ein Kopftuch tragen. Andererseits gilt jeder arabisch- oder türkischstämmig aussehende Mann mittlerweile als muslimisch - unabhängig davon, ob er beispielsweise atheistisch oder christlich ist.
Darüberhinaus war der muslimische Mann in der Debatte immer der Hauptfeind, der aggressive Unterdrücker. Die muslimische Frau galt als Opfer, das vor der Unterdrückung durch den Mann gerettet werden muss. Deswegen gab es viele Initiativen, diese Frauen zu ermächtigen. Muslimischen Männern hingegen begegnen die Menschen mit Angst und Misstrauen.
Gab es in den vergangenen Jahren auch positive Entwicklungen?
Allein das Wissen um Stereotype kann manchmal helfen, sie zu durchbrechen. Ich sehe in den vergangenen Jahren insofern Erfolge, als dass ein gewisser Bildungsaufstieg entstanden ist. Es gibt nun auch in Deutschland immer mehr muslimische Männer, die Vorbilder für andere sind. Sie zeigen: Der muslimische Mann kann auch Sozialunternehmer werden, Theologe, Intellektueller.
Inzwischen wird muslimischen Menschen auch zugestanden, für sich selbst zu sprechen. Allerdings treten sie häufig ausschließlich als Experten auf für Themen, die in Zusammenhang mit ihrer Religion und Herkunft stehen. Sie dürfen über Terror sprechen, aber seltener über Liebe oder das Wirtschaftssystem. Das ist ein großes Problem. Denn wenn Menschen immer nur in bestimmten Zusammenhängen auftreten, verfestigt sich das Bild, das man von ihnen hat.
In der Flüchtlingsdebatte tauchen Stereotype wieder ziemlich deutlich auf. Macht Deutschland da gerade einen Schritt zurück?
Deutschland ist extrem gespalten und polarisiert. Auf der einen Seite gibt es Debatten, die den Eindruck erwecken, es hätte die Diskussionen der vergangenen 20 Jahre nicht gegeben. Gleichzeitig haben wir in den Medien aber viele fortschrittliche und progressive Stimmen, die Menschen mit Migrationshintergrund nicht auf bestimmte Rollen festlegen wollen.

Über Fremde spricht es sich viel leichter als über das Eigene. Das sollte nicht so bleiben, denn eigentlich ist ganz leicht zu beantworten, was deutsch ist. Man muss dann nur die richtigen Schlüsse ziehen.
Ging der mediale Diskurs der vergangenen Jahre am Mainstream vorbei?
Das glaube ich nicht. Ich denke erstens nicht, dass es den einen Mainstream in der Debatte überhaupt gibt. Es gibt viele wütende, hasserfüllte Menschen, aber auch sehr viele progressive, tolerante. Es ist allerdings häufig so, dass der hasserfüllte Teil der Bevölkerung sehr viel lauter ist als der andere. Wir haben jahrelang den Fehler gemacht, auf die hasserfüllten Menschen, den wütenden Mainstream zu reagieren, anstatt selbst die Debatte voranzutreiben.
Inwiefern?
Wir haben über destruktive und populistische Fragen diskutiert wie: Gehört der Islam zu Deutschland? Sind Muslime weniger gebildet als andere Religionen und Gemeinschaften? Ist der Islam eine Religion der Gewalt? Weil diese Fragen aus dem wütenden Mainstream kamen. Meinem Gefühl nach steht der stillere, offene Teil der Gesellschaft erst allmählich auf und bringt sich ein. Das hat man zum Beispiel nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo gesehen und bei den Gegendemonstrationen zu Pegida.
Welche Debatte sollte dieser stillere Teil der Gesellschaft voranbringen?
Wir müssen über Leitkultur sprechen. Bis heute bekommen viele liberal-progressive Menschen eine Gänsehaut, wenn sie den Begriff Leitkultur überhaupt hören. Er ist für sie - berechtigterweise - verbunden mit Abgrenzung, Nationalismus. Dabei finde ich, dass eine Leitkulturdebatte positiv sein kann. Wenn wir zum Beispiel ein für allemal gemeinsam festhalten, dass es ausreichen muss, sich an das Grundgesetz zu halten, um Deutsche oder Deutscher zu sein. Denn darin sind unsere Werte schließlich festgehalten. Bisher haben wir hingegen Debatten, die den Eindruck erwecken, als gäbe es einen ungeschriebenen Wertekanon in Deutschland. Und alles, was nicht herkunftsdeutsch ist, widerspricht ihm automatisch.
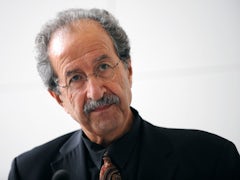
Rafik Schami hat seine Heimat Syrien vor 40 Jahren verlassen. Im Interview spricht er über die Sehnsucht nach einer Illusion - und die sehr realen Probleme der Flüchtlingskrise.
Wie äußert sich das gegenüber Flüchtlingen?
Die Gesellschaft erwartet von Flüchtlingen, dass sie Übermenschen sind. Sie zeichnet ein idealisiertes Bild von Deutschland, dem die Geflüchteten entsprechen sollen - obwohl es die meisten Deutschen nicht tun. Manche Geflüchtete sind freundlich, gesprächig, gebildet. Manche aber nicht. Wir dürfen nicht sagen: Wenn Flüchtlinge allen Idealen entsprechen, dann sind sie willkommen. Wenn sie aber grummelige, wortkarge Männer ohne Hochschulabschluss sind, wollen wir sie nicht. Dabei ist doch Deutschland reich bestückt mit grummeligen, dumpfbackigen Männern. Wie kommen wir darauf, dass Geflüchtete einem anderen Ideal entsprechen müssen?
Ganz ähnlich ist es für Menschen mit Migrationshintergrund, die schon länger hier leben. Sie müssen akzentfrei Deutsch sprechen, studieren, sich gesellschaftlich engagieren, immer freundlich und fleißig sein, gewissermaßen Überdeutsche werden. Und trotzdem werden sie oft nicht als Deutsche gesehen, bleiben "Fremde."
Was wäre ein besserer Umgang?
Zunächst einmal muss uns in Deutschland klar werden, dass auch wir das Ideal einer Gesellschaft, wie wir sie zeichnen, noch lange nicht erreicht haben. Wir müssen uns unsere Werte gegenseitig beibringen, nicht nur den Geflüchteten.
Außerdem dürfen wir auf keinen Fall anfangen, unser generelles Verhältnis zu Geflüchteten von einzelnen Ereignissen abhängig zu machen. Zum Beispiel, ob einer der Terroristen von Paris getarnt als syrischer Flüchtling nach Frankreich kam. Oder wenn ein Flüchtling sich sexistisch verhält. Unseren Umgang mit Geflüchteten sollten wir nicht ständig neu austarieren, aufgrund einzelner Vorfälle. Er darf nicht auf wackeligem Boden stehen. Unser Umgang mit Geflüchteten sollte auf Idealen basieren, die wir beschützen.
