Sophies Schneeanzug ist zu klein. Ein neuer muss her. Der zweite schon in diesem Winter. Und der alte? Ab in den Keller. Nur: Da stapeln sich schon fünf Kartons mit Babybodys, ersten Sommerkleidchen und mit dem vorletzten Schneeanzug. Einmal abgesehen vom Platzproblem: Die Klamotten werden mit zunehmender Lagerung weder besser noch modischer. Also wohin damit?
Wegwerfen fühlt sich falsch an. Die meisten Sachen sind noch gut, und sie atmen das Glück vergangener Kindertage. Das karierte Sommerkleidchen, das Sophie am ersten Geburtstag trug. Die Wollmütze, die ihr so gut stand. Wegwerfen? Schöner wäre, wenn sich jemand anderes daran erfreuen würde. So denken viele Eltern: Keine andere Gruppe verleiht, verkauft oder verschenkt so viel Kleidung wie sie, das hat eine Greenpeace-Umfrage ergeben. Etwa 80 Prozent der Mütter haben - gegenüber 13 Prozent der Jugendlichen - keine Scheu vor gebrauchten Dingen.
Man kann die Leihklamotten jederzeit zurückgeben - ungewaschen und sogar kaputt
Das Problem dabei ist nur: Sachen loswerden ist gar nicht so einfach. Die Verwandtschaft sucht sich aus dem Kleiderberg mit spitzen Fingern nur die drei schönsten Stücke raus. Und vom Flohmarkt kommt man oft genug mit der Hälfte wieder zurück. Natürlich gehörte man gerne zu den Secondhandprofis, die ihre Stücke, liebevoll fotografiert, gewinnbringend im Internet auf Ebay-Kleinanzeigen oder in Foren wie Mamikreisel oder Momox absetzen. Tatsächlich aber fährt manch eine frustrierte Mutter nach dem erfolglosen Flohmarkttag dann doch die Schleife über den Wertstoffhof und versenkt alles in der Altkleidertonne.
Wie wäre es, wenn man Kinderklamotten mühelos weitergeben könnte, damit ein anderes Kind sie trägt? Genau das will die Firma Tchibo künftig anbieten. Der bei Eltern vor allem wegen seiner Kinderkleidung beliebte Händler baut zusammen mit der Start-up-Firma Kilenda einen Mietservice für Kinderkleidung auf. Vom 23. Januar an kann man unter tchibo-share.de einen Teil des Kinderklamotten-Sortiments leihen statt kaufen - für monatlich etwa ein Fünftel des Kaufpreises. Der Babybody - etwa mit Zoodruck aus der aktuellen Kollektion - kriegt man dann für einen Euro im Monat statt gekauft im Dreierpack für 14,99; den Pyjama für 1,60 Euro statt 12,99, die Kapuzen-Fleecejacke für zwei Euro statt 17,99.
Tchibo leitet dabei zunächst mal ein Umweltgedanke. In einer Branche, die wegen ihrer schmutzigen Produktionsbedingungen zuletzt stark in der Kritik stand, bemüht sich das Unternehmen wie viele andere Firmen auch um einen nachhaltigeren Ansatz. "Wir wollen die Kleidung im Kreislauf halten. Das spart den Kunden Zeit, Geld und Platz - und schont Ressourcen", sagt Sandra Coy, Sprecherin bei Tchibo. Der Service richtet sich also an umweltbewusste Kunden, aber auch an solche, die vielleicht keine Muße haben, wochenendenlang auf Flohmärkten rumzustehen, die also den Service schätzen. Man kann die Sachen nach einem Monat Mietzeit jederzeit einzeln zurückschicken, und zwar auch ungewaschen und sogar kaputt. Tchibo übernimmt das Risiko. "Wir wollen der berufstätigen Mutter die Arbeit abnehmen", sagt Coy. Geld spart man mit dem Angebot dafür nur bei wirklich kurzer Mietzeit. Monatlich vier Euro kostet etwa die geliehene Allwetterjacke - nach einer Mietsaison landet man da schnell beim Ladenpreis von 29,95 Euro. Dafür darf man sie, ist der Kaufpreis einmal erreicht, aber auch behalten.
Schluss also mit Wäschebergen, vollgestopften Altkleiderkisten, anstrengenden Flohmarkttagen, wenn wir nur leihen statt besitzen? "Weg vom Besitz - das entschlackt den Alltag und schont Ressourcen", sagt Kirsten Brodde, Textilexpertin von Greenpeace. "Tchibo packt die Kunden beim Komfort", lobt sie, vielleicht könne es so wirklich gelingen, Menschen zu einem anderen Konsumverhalten zu bewegen. Immerhin leihen wir bereits selbstverständlich Bücher, streamen Musik, mieten Autos oder Bohrmaschinen. Nun komme vielleicht auch Schwung in den Klamottenverleih, hofft Brodde.
Ansätze dafür gibt es bereits: Die Start-ups Kleiderei oder Myonbelle etwa liefern per Abomodell monatlich eine Kiste mit mehreren Leihklamotten nach Hause, abgestimmt auf Größe und Stil der Kundin. Beim Kleiderkreisel kann man ausgediente Teile schnell und einfach tauschen, verkaufen oder verschenken. Und Angebote wie Dresscoded oder Chic by Choice vermieten über das Netz Dirndl, Hochzeits- oder Abendkleider mit passenden Schuhen und Accessoires, die man meist nur ein Mal trägt und dann jahrelang im Schrank hängen hat. Es sind erste zarte Ansätze, die sich gegen den zunehmend besinnungslosen Kaufrausch stellen. Der Konsum an Kleidung wird weltweit bis 2030 um 63 Prozent zunehmen, wie die Studie "Pulse of the Fashion Industry" prognostiziert. Die Modezyklen werden immer kürzer. "Wir kaufen Kleidung inzwischen wie Wegwerfware: 60 neue Teile pro Jahr", sagt Brodde. Vier Mal werden die Teile durchschnittlich getragen, bevor wir sie aussortieren - und in der Regel einfach auf den Müll werfen. Ein Fünftel unserer Kleidung tragen wir gar nicht. Auch Kinderklamotten sind davon betroffen. Aufdrucke von aktuellen Serien etwa lassen ein T-Shirt ein Jahr später schon alt aussehen. Die Schleifchen am Mädchenpulli machen es schwierig, Klamotten auch an Jungen zu vererben. Immer schneller günstig produzierte Kleidung wird zu Ramschpreisen auf den Markt geworfen.

Will man das wirklich - oder ist das nur Trend? Damit Konsumenten dem Kaufrausch verfallen, hat die Wirtschaft das ganze Jahr geackert. Wie funktioniert das?
Fast Fashion nennt sich dieser Kaufrausch, und ein Innehalten oder Umdenken kommt nur langsam in Gang.
Dabei wäre ein anderes Konsumverhalten dringend nötig, das sagen Umweltorganisationen schon lange. Nicht nur weil uns unsere vollgestopften Keller auf der Seele lasten, sondern vielmehr, weil die Textilindustrie, so wie sie derzeit funktioniert, die Umwelt zerstört. Nach der Ölindustrie gilt sie als die zweitdreckigste Industrie der Welt. Die Produktion von Textilien verschlingt Unmengen an Chemie, Wasser und Energie: Laut WWF verbraucht der Baumwollanbau ein Viertel der weltweit verkauften Insektizide und elf Prozent der Pestizide. Etwa 3000 Chemikalien werden zum Färben, Waschen oder Bedrucken von Textilien eingesetzt, viele davon giftig. Allein in China, dem größten Textilproduzenten der Welt, haben laut Greenpeace über 300 Millionen Menschen keinen Zugang mehr zu sauberem Trinkwasser. Und das Wasser wird immer knapper: Etwa 7000 Liter Wasser verbraucht die Produktion einer einzigen Jeans.
Immerhin: Auf Druck von Umweltorganisationen haben sich inzwischen viele große Firmen dazu verpflichtet zu entgiften. Sie verwenden Biobaumwolle oder recycelten Stoff. Auch Recycling aber kostet Energie, Wasser, Chemie. Nachhaltiger wäre es, die Kleidung einfach länger zu nutzen. Ganz generell hieße das: gute Qualität, zeitloses Design und sorgfältige Pflege. Einige Firmen versuchen ganz gezielt, mit der Langlebigkeit Geld zu verdienen. Tom Cridland mit seiner "30 Year Collection" etwa gibt dreißig Jahre Garantie auf seine schlichten T-Shirts, Jacketts und Hosen. Die Jeansmarke Nudie repariert kostenlos ihre Jeans in den eigenen Läden. Aber auch die Verleih-Idee von Tchibo ist ganz im Sinne der Umweltschützer.
"Wie lange die Sachen genutzt werden, ist fraglich"
Ob sie aber funktioniert? Die Journalistin und Buchautorin Kathrin Hartmann ist skeptisch: "Wie lange die Sachen genutzt werden, ist fraglich. Womöglich ist so ein Babybody schnell zu fleckig oder ausgeleiert, um für Geld vermietet zu werden - und landet dann doch schnell im Abfall." Außerdem wird in den Läden oder den Tchibo-Supermarktregalen von dem neuen Leihmodell erst mal nichts zu sehen sein. Dort kann man Produkte weiterhin nur kaufen; lediglich im Internet gibt es die Leihsachen. Damit der Kleiderverleih wirklich Ressourcen schont, muss er jedoch groß werden. "Es bleibt abzuwarten, ob diese Mietservices nur schöne Öko-Zusatzangebote sind - oder wirklich dazu führen, dass Mieten an die Stelle von Kaufen tritt, also weniger Kleidung produziert wird", sagt Hartmann.
Ein Leihtrend jedenfalls zeichnet sich ab: Ein Viertel der Konsumenten glaubt, Produkte zu besitzen werde in Zukunft unwichtiger, wie die KPMG-Kurzstudie "Sharing Economy" ergeben hat. Etwa die Hälfte der Befragten findet mieten praktisch, weil sie die Dinge nicht mehr weiterverkaufen oder instand halten müssen, also Zeit und Geld sparen.
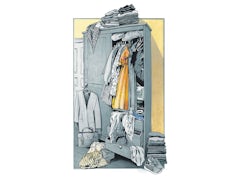
Laut einer neuen Umfrage besitzen die Deutschen mehr als fünf Milliarden Kleidungsstücke - und tragen nur einen Bruchteil.
Im Kinder-Kleidungsmarkt ist der Verleih noch ein Nische, aber es gibt ihn: Hochpreisige Kindermode sowie Spielzeug und Autositze vermietet seit drei Jahren die Magdeburger Firma Kilenda, die für Tchibo jetzt Abwicklung und Vertrieb übernimmt. Andere Firmen wie Kindoo verleihen Kleidung und Ausstattung, bei Mami Poppins kann man Kinderwagen leihen. Tchibo ist nun die erste große Modefirma, die das Vermieten im Massenmarkt ausprobiert.
Und die Chancen, dass gerade Eltern bereit sind, neue Wege beim Konsum zu gehen, stehen gut. Wer Kinder hat, sorgt sich eher um die Zukunft des Planeten. Mit den Kindern wächst bei vielen Menschen die Bereitschaft, im Laden nach Ökoprodukten oder eben dem Biobaumwoll-Strampler zu greifen. Drei Viertel der Eltern achten laut einer Greenpreace-Umfrage auf gefährliche Chemie in Kinderkleidung. Die Kleidung soll schadstofffrei und langlebig sein - das ist Eltern wichtiger als Preis und Marke. Eltern wollen zudem Platz und Geld sparen, darum tauschen und übernehmen sie ohnehin gerne Kleidung für ihre Kinder - am liebsten mit Bekannten oder auf dem Flohmarkt.
Im Grunde haben sie darum ja immer schon gemacht, was Umweltschützer jetzt fordern: Eltern haben schon immer recycelt. Viele Kinder sind über Jahre mit den geerbten Klamotten von Geschwistern und Freundeskindern ausgestattet. Die Hebammen predigen das ohnehin: Die alten, ausgewaschenen Bodys sind die besten, weil da die Chemie schon raus ist. Also weitertragen, flicken, vererben. Auch mit Fleck. Die Umwelt freut sich.

