Am 10. Dezember 1788 hielt der Maler Joshua Reynolds in der Londoner Royal Academy of Arts einen Vortrag mit dem Titel: "Gainsboroughs Charakter - seine Vorzüge und Schwächen". Reynolds war ein langjähriger Rivale Thomas Gainsboroughs gewesen, der einige Monate zuvor gestorben war. Der Vortrag sollte lange Zeit die Sicht auf den Künstlerkollegen stark mitprägen, und heute muss man vieles, das Reynolds damals sagte, cum grano salis lesen. Bedeutsam bleibt allerdings folgender Satz: "Wenn diese Nation jemals ein Genie hervorbringen sollte, das ausreicht, um uns die ehrenvolle Auszeichnung einer 'Englischen Schule' zu verleihen, dann wird der Name Gainsborough der Nachwelt in der Geschichte der Kunst als einer der allerersten dieses klingenden Namens überliefert werden."
Gainsborough, sagte Reynolds, habe mit seinen Landschaften und Porträts weit mehr Interesse bei ihm geweckt als irgendein Werk der Römischen Schule seit Andrea Sacchi. Mit anderen Worten: Italien hatte seit mehr als hundert Jahren keinen Künstler mehr hervorgebracht, der Gainsborough hätte das Wasser reichen können. Der Verstorbene wurde damit nicht nur zum Begründer einer eigenen, nationalen Malschule erhoben, seine Überlegenheit gegenüber den kontinentalen Kollegen wurde gleich mit postuliert.
Vor diesem Hintergrund muss man die auf den ersten Blick etwas unverhältnismäßig erscheinende freudige Erregung verstehen, die die Ausstellung "Gainsborough's Blue Boy" in der Londoner National Gallery ausgelöst hat. Das Ganzkörperporträt eines etwa Achtzehnjährigen, das Thomas Gainsborough um 1769/70 vollendete, wird zum ersten Mal seit genau 100 Jahren wieder in England gezeigt.
Der kalifornische Eisenbahnmagnat zahlte Weltrekordpreise
Bevor man sich dem Stil und Motiv dieses Gemäldes widmet, das von manchen britischen Kritikern in den 1920er-Jahren als "schönstes Bild der Welt" eingestuft wurde, sollte man sich seine Geschichte vergegenwärtigen: Nachdem es 1770 in der Royal Academy of Arts gezeigt worden war, fand es über mehrere Besitzer seinen Weg in die Sammlung des Herzogs von Westminster. Als 1910 die britische Einkommen- und Erbschaftsteuer drastisch erhöht worden war, sah der etwas klamme Herzog sich 1921 gezwungen, es an den Kunsthändler Joseph Duveen zu verkaufen. Ein Jahr darauf erwarb der amerikanische Eisenbahnmagnat Henry E. Huntington den "Blue Boy" für den damaligen Weltrekordpreis von 728 000 Dollar.
Als dieser Verkauf bekannt wurde, löste die Nachricht eine Art Volkstrauer aus. Vor der Verschiffung des "Blue Boy" nach Kalifornien war er im Rahmen einer regelrechten Abschiedstournee in der National Gallery zu sehen. Innerhalb von drei Wochen besuchten mehr als 90 000 Menschen das Werk. Im Laufe des 19. Jahrhunderts hatten diverse Ausstellungen die Idee einer "Englischen Schule" gefestigt, und Gainsboroughs Werk stand neben William Hogarths im Zentrum dieser Idee. Der anonyme Kritiker des Arts Journal bemerkte 100 Jahre nach Entstehung des Gemäldes anlässlich einer Ausstellung in Manchester, Gainsborough festige mit "Blue Boy" "für unsere einheimische Schule eine Position, die nicht nur ehrenwert, sondern auch einzigartig unabhängig ist". Die Gegenüberstellung dieser einheimischen Schule und kontinentaler Werke in einer Art "Kampf der Schulen" wurde gerade in der Royal Academy of Arts gefördert.
Nach dem Verkauf des "Blue Boy" schrieb der damalige Direktor der Galerie, Charles Holmes, bei der Abschiedsausstellung "au revoir" auf die Rückseite des Bildes, in der Hoffnung, dass es zurückkommen würde. Seitdem ist es in der Huntington Art Gallery in San Marino, Kalifornien, ausgestellt, wurde bisher nie verliehen und wird nach diesem Jubiläumstrip wohl auch nie wieder verliehen werden.
Was aber macht den "Blue Boy" - die Identität des jugendlichen Modells ist bis heute umstritten - im Bewusstsein der englischen Kunstwelt zu einem solch besonderen Werk? Zunächst war es ein stilistisches Kräftemessen mit Anthonis van Dyck, der als Hofmaler Charles I. in England als größter Porträtmaler überhaupt galt. Van Dyck hatte stets die Pracht der höfischen Mode hervorgehoben, seine elegante Sprezzatura bildete die Grundlage des gesamten britischen Rokoko-Stils. Gainsborough kleidete den enigmatischen Knaben in ein Kostüm aus dem 17. Jahrhundert, in Kavalierskleidung mit weißen Strümpfen und blauen, üppig goldbestickten Satinhosen. Gainsborough begegnete van Dyck also gleichsam auf seinem eigenen Territorium. Alles an der Figur strahlt ein Bewusstsein kontinentaleuropäischer Tradition aus, vom klassischen contraposto bis hin zum selbstbewusst abgewinkelten Ellbogen.
Dass Gainsborough die blaue Farbe ins Zentrum rückte, war hingegen originell und ungewöhnlich, und stellte einen Kontrast zu Reynolds' Auffassung dar, nach der diese Farbe in den Hintergrund gehörte. Noch dazu verwendete Gainsborough Preußisch Blau, die erste künstlich hergestellte Farbe, die zu van Dycks Zeiten noch gar nicht zur Verfügung gestanden hatte.
Der "Blue Boy" wurde in Kalifornien fester Teil des amerikanischen Bilderbestandes. Die räumliche Nähe der Huntington-Sammlung zu Hollywood hat vor allem zu seiner wiederholten Verwendung in Filmen geführt, der eigentlichen Bildsprache Amerikas: Er kommt in Laurel-und-Hardy- und "Nackte-Kanone"-Komödien ebenso vor wie in Batman- und James-Bond-Filmen; Jamie Foxx trägt das Van-Dyck-Kostüm mit extrem komischem Effekt in "Django Unchained". Er signalisiert Gediegenheit und europäisches Raffinement. In England tröstete man sich derweil in Abwesenheit des Originals mit Reproduktionen auf Geschirrtüchern, Tellern und Schnapsgläsern.
Identifikation kommt im deutschen Wust juristischer Ausfuhr-Debatten nicht vor
Das Trauma dieser Veräußerung führte dazu, dass britische Regierungen später immer wieder den Verkauf wichtiger Kunstwerke ins Ausland unterbanden und Sammlungen veranstaltet wurden, um diese Arbeiten "für die Nation zu retten". Darunter war interessanterweise auch ein Selbstporträt Anthonis van Dycks, das die National Portrait Gallery 2014 für einen reduzierten Preis von zehn Millionen Pfund ankauften. Immerhin gut anderthalb Millionen waren durch öffentliche Spenden zusammengekommen. Der Zweck der Ausfuhrkontrolle bestehe darin, heißt es auf der Website der britischen Regierung, "Kulturgütern, die als von herausragender nationaler Bedeutung angesehen werden, die Möglichkeit zu geben, im Vereinigten Königreich zu verbleiben. Das System soll einen möglichst gerechten Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen schaffen, die bei der Beantragung einer Ausfuhrgenehmigung eine Rolle spielen: der Schutz des nationalen Kulturerbes, die Rechte des veräußernden Eigentümers, des Käufers in Übersee und die Stellung und der Ruf des Vereinigten Königreichs als internationaler Kunstmarkt".
Hier tritt ein bemerkenswerter, fundamentaler Unterschied zur Herangehensweise in Deutschland zutage. Denn auf breite mediale Debatten über die Veräußerung eines Teils des "nationalen Kulturerbes" oder emotional aufgeladene Spendenapelle an die Bevölkerung wartet man hierzulande vergeblich. Natürlich wird über die Spannungen zwischen Kunstmarkt und Gesetzgeber berichtet, wenn durch verschärfende Novellierungen der Kulturgutschutz-Ausfuhrbestimmungen Kunstwerke im Land gehalten werden sollen. Doch das Element einer Identifikation mit einzelnen Werken, das in Großbritannien eine so zentrale Rolle spielt, kommt im deutschen Wust juristischer Debatten über Mitwirkungspflichten von Museen und Händlern, Alters- und Wertgrenzen, über Straf- und Bußgeldregelungen nicht vor. Geprägt vom Bruch in der Kulturentwicklung, den der barbarische Umgang der Nazis mit Kunst und Künstlern darstellte, herrscht ein nüchterner, ja bürokratischer Stil vor. Gerade bei Stücken, etwa der Romantik, deren ursprünglicher Kontext von mehreren Bedeutungsschichten, von historischen Relativierungen und Bedenken überlagert ist, wird jedes Pathos gemieden.
Ganz anders im Vereinigten Königreich. Was die spezielle Beliebtheit des "Blue Boy" dort angeht, die sich auch an den gegenwärtigen Publikumszahlen in der National Gallery ablesen lässt, so ist sie gerade durch sein historisierendes Element erklärbar (das übrigens paradoxerweise eher untypisch im Gesamtwerk Gainsboroughs ist). Es entsprach - und entspricht bis heute - der nostalgischen englischen Selbstwahrnehmung. Dass es sich um eine Art Pastiche eines flämischen Malers handelt, die dabei zur Apotheose einer einheimischen Schule erklärt wird, erscheint nur auf den ersten Blick paradox: Ein Großteil der englischen Malerei basiert nicht auf Reisen ins europäische Ausland, sondern auf der Schulung durch das, was in englischen Sammlungen vorhanden war. So war etwa auch Gainsboroughs Landschaftsmalerei durch die pathosgeladene Naturauffassung von Salvator Rosa und Nicolas Poussin geprägt.
Letztlich zeigt die eklektische Mischung aus kontinentalem Einfluss und genuiner stilistischer Innovation, die Schaffung eines idealisierten ästhetischen Überbaus mit starker emotionaler Komponente, wie komplex die Einflüsse sind, die zur Konstruktion eines Nationalstils führen. Es bedarf anscheinend einzelner, exemplarischer Werke, um diesen im Bewusstsein eines Publikums zu verankern. Im Grunde geht es aber nicht um diese Einzelwerke, sondern um ein geschlossenes, als kontinuierlich empfundenes Selbstbild.
Dass diese Geschlossenheit, man könnte auch sagen: Abgeschlossenheit, ihre Tücken hat, erweist sich nicht zuletzt in Ereignissen wie dem Brexit, dem die Illusion einer absoluten britischen Selbstgenügsamkeit in allen Belangen zugrunde liegt - wirtschaftlich, politisch und kulturell. Dass herausragende Werke wie der "Blue Boy" aber auch nach einem Jahrhundert eine derartige Sogwirkung entfalten, dass Gainsboroughs Gemälde offenkundig Teil des nationalen Gedächtnisses geblieben ist, jenseits legalistischer Kulturschutzregularien, vermerkt man aus deutscher Sicht dennoch mit einer gewissen Sehnsucht nach einem ähnlich engen Verhältnis der Menschen hierzulande zu ihrem eigenen Kulturerbe.
Was könnten die "Blue Boys" der Deutschen sein?
Ema (Akt auf einer Treppe)
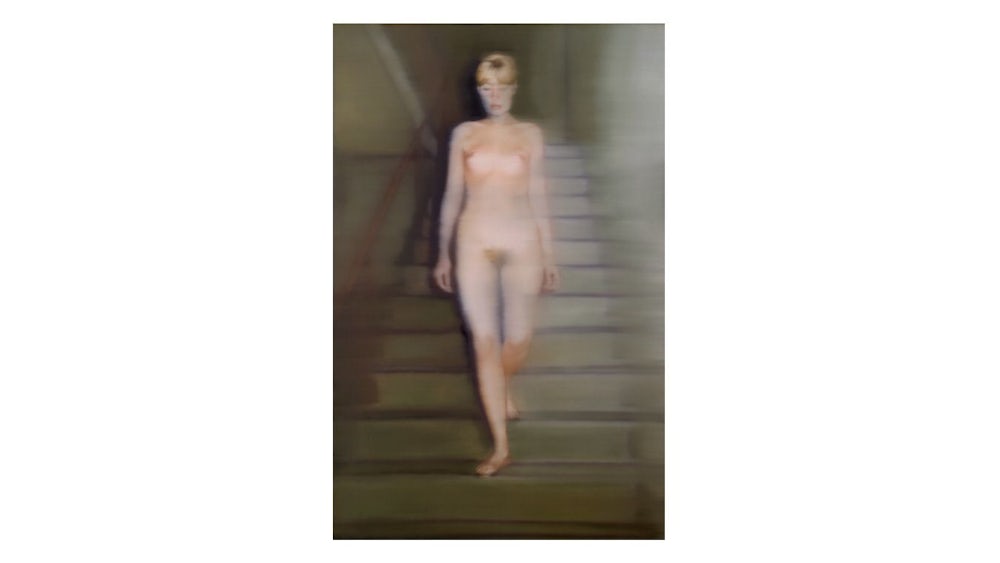
Mag sein, dass die Malerei die meiste Zeit des 20. Jahrhunderts mit Abstraktion beschäftigt war, als identitätsstiftend werden vor allem figurative Motive empfunden, vor allem Bilder, die Menschen zeigen. Das Werk von Gerhard Richter ist dafür beispielhaft, der entweder Farbe mit Rakel und Schrubber auf Leinwände auftrug oder im charakteristischen, leicht verwischten Duktus Fotografien oder Medienbilder kopierte. Die Abstraktionen mögen bedeutend sein, interpretiert und kanonisiert werden vor allem Richters Familienbilder - von "Betty", der Rückenansicht seiner ältesten Tochter, bis zu "Tante Marianne", für das er ein Foto seiner von den Nazis ermordeten Tante mit ihm selbst als Baby als Vorlage verwendete. Und auch "Ema (Akt auf einer Treppe)" (1966) nach einem Bild seiner damaligen Ehefrau, das derzeit im Kölner Museum Ludwig ausgestellt ist, wird weniger als künstlerische Replik auf Marcel Duchamp betrachtet - denn als eines der Familienmitglieder dieses Künstlers geliebt, den die Deutschen verehren wie keinen sonst.
Wanderer über dem Nebelmeer

Ein Maler solle nicht bloß malen, was er vor sich sehe, schrieb Caspar David Friedrich, sondern auch das, was er in sich sehe. Eine Sentenz, die den Zugang zu einem seiner berühmtesten Gemälde erleichtert, dem "Wanderer über dem Nebelmeer" (1818), der heute in der Hamburger Kunsthalle verwahrt wird. Eine Rückenfigur ins Zentrum einer Landschaft zu setzen war zur Entstehungszeit eine gewagte Neuerung. Das Bild thematisierte nicht nur die Natur, sondern auch ihren Betrachter. Poetisierung und Subjektivierung der Weltsicht ließen dieses Bild zu einer Art gemaltem Manifest der Romantik aufsteigen. Das intensiv Individualistische, für das dieser Zugang stand, wurde als Konkretion typisch deutschen Empfindens gedeutet. Eine nationale Überformung, die viele allegorische und religiöse Aspekte außer Acht ließ und die Auseinandersetzung mit Friedrich im 20. Jahrhundert in anachronistischer Weise erschwerte.
Selbstbildnis im Pelzrock

Mehr als zwei Jahre dauerte der Kampf um Dürer, genauer gesagt: um die Absage der Münchner Alten Pinakothek an das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, das das ikonische "Selbstbildnis im Pelzrock" im Jahr 2012 bei einer Ausstellung des Renaissance-Meisters zeigen wollte. Die Franken waren empört, Horst Seehofer ließ als Landesvater im Landtag abstimmen, sogar Hooligans sollen die Herausgabe gefordert haben. Am Ende siegten die Vernunft und ein salomonisches Gutachten der Konservatoren: Die mehr als 500 Jahre alte Holztafel war zu empfindlich für den Transport. Aber die vorhandenen Schäden - so viel Gerechtigkeit musste sein - gingen nicht auf eine Ausleihe nach Nürnberg in den Siebzigerjahren zurück, sondern waren unbestreitbar älter.
Sixtinische Madonna

Raffaels "Sixtinische Madonna" (1512/1513) die heute in den Gemäldegalerien Alter Meister in Dresden hängt, wird in Deutschland vor allem als kunsthistorisch wertvoller Besitz geschätzt. Wirklich berühmt sind hierzulande vor allem die beiden Engel am unteren Bildrand. In Russland hat die Madonna, ein Ankauf von August III. aus dem Jahr 1754, dagegen den Status einer Ikone. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie als Beutekunst nach Moskau gebracht, als sie zurückgegeben werden sollte, verabschiedeten sich Tausende von ihr, manche kamen mehrmals. Reproduktionen hingen über den Schreibtischen zahlreicher Schriftsteller von Puschkin und Tolstoi bis Dostojewski, der auf die Frage, warum er das Bild so lange und so oft betrachtet habe, antwortete: "Damit ich am Menschen nicht verzweifle."
