Es ist eine Fleißarbeit. Auf der Seite kulturerbe-digital.de versucht Stefan Rohde-Enslin vom Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin einen Überblick über alle Digitalisierungsprojekte von Kulturgut zu schaffen, an denen deutsche Partner beteiligt sind. Er kommt dabei momentan auf 915 Projekte, die von mehr als 633 Institutionen betrieben wurden und werden.

In allen Ecken des Landes wird gescannt, abgelichtet, hochgeladen. In der Erschließungsqualität und Zugangsoffenheit unterscheiden sich diese Vorhaben teils erheblich. Und oft bleibt, was ein wichtiger Nebenzweck zu sein hätte, die bessere Zugänglichkeit der Bestände für ein breites Publikum nämlich, unerfüllt. Wer nicht von der Existenz der Sammlung XY weiß, der wird auch online nie nach ihren Inhalten suchen.
Was aber bringt die Digitalisierung qualitativ Neues, wenn Bestände auch weiterhin nur den Eingeweihten der wissenschaftlichen Community zugänglich bleiben? Wissen, das in den Silos schwer recherchierbarer Datenbanken verwahrt wird, wird im digitalen Zeitalter totes Wissen bleiben.
Wie weit das deutsche Kulturerbe auf seinem Weg nach Digitalien bereits vorangekommen ist, und wo es dabei in unwegsames Gelände zu geraten droht, das war auf einer zweitägigen Tagung von Deutscher Kinemathek und Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin zu erfahren. Die Erschließung der ungeheuren Informationsmengen in Bibliotheken, Museen, Archiven für die Online-Welt ist natürlich das unternehmerische Interesse von Google, das darum mit seinen Google Books mit Macht vorangeprescht ist. Es ist aber längst auch das ureigene Interesse der kulturellen Institutionen selbst.
Europeana und die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) heißen für Deutschland die beiden staatlichen Versuche, zentrale Anlaufstellen für das digitalisierte Kulturerbe zu schaffen - auf europäischer und auf nationaler Ebene. Die DDB ist dabei bislang noch immer nur ein Phantom. Günther Schauerte, Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, berichtete in Berlin vom Stand der Dinge. Einen Starttermin vermochte er aber nicht zu nennen, im nächsten Frühjahr könne es soweit sein, vielleicht auch erst im Sommer: "Uns ist die Qualität wichtiger als das Datum." Die Software stehe aber, zur Zeit in Form einer finalen Testversion. Ab dem Jahresende soll eine Art "Roadshow" mit den ersten Ergebnissen im Lande unterwegs sein.
Die Europeana hingegen, einst das Ergebnis der Aufwallung europäischer Regierungschefs gegen die vermutete Kaperung des europäischen Kulturerbes durch Googles Buchsuche, ist inzwischen seit mehreren Jahren online, hat auch einen Millionenbestand an Digitalisaten vorzuweisen - und blieb doch bislang eine unbefriedigende Veranstaltung mit dem Charakter einer paneuropäischen Wundertüte.
Die technischen und finanziellen Schwierigkeiten des Europeana-Projekts waren von Anfang an groß, bald meldeten sich auch in Brüssel Experten, die das Heil doch eher in einer Kooperation mit Google sahen. Dabei besteht die begründete Hoffnung, dass aus der Europeana doch noch einmal etwas anderes werden könnte als der Europudding des digitalen Kulturerbes.
Wenn sich jene Architektur durchsetzen würde, die in Berlin von Stefan Gradmann skizziert wurde, dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis, dann hätte sie sogar das Zeug dazu, dem kulturellen Erbe der Welt in Sachen digitaler Präsenz die Zukunft zu weisen.
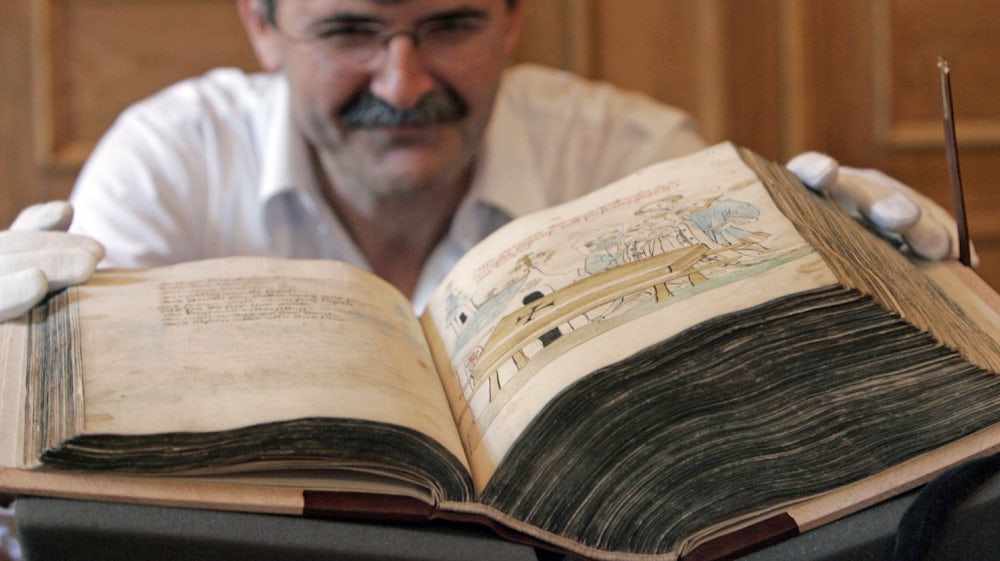
Bislang folgt die Ordnung der Bestände auch in digitalen Bibliotheken und Archiven der Logik des Katalogs. Die Beschreibung und Referenzierung in Metadatensätzen ist, ob sie auf Papier oder in Nullen und Einsen erfolgt, eine statische Angelegenheit. Zwar sind Museen und Archive stärker kontextorientiert als Büchereien, doch "die Bibliothekensicht", so Gradmann zurecht, habe bislang "alle Kulturportale geprägt, inklusive dem, was man heute von Europeana sieht."
Unter Gradmanns Leitung ist das "Europeana Data Model" entwickelt worden, ein Referenzierungssystem, das nach den Prinzipien des semantischen Webs jedes Objekt mit beschreibenden Daten und Kontextdaten versehen würde, die beliebig erweitert und verlinkt werden könnten. Und Linked Open Data würde eine Verknüpfung von Wissen aus Archiven, Bibliotheken und Museen weit über die Informationscontainer individueller Datenbanken ermöglichen. Voraussetzungsloses Auffinden und assoziatives Weitersuchen wie in der Suchmaschine, nicht mehr das Entlangtasten am Schlagwortkatalog - so würde Europeana eine Revolution in der Organisation unseres kulturellen Gedächtnisses vorantreiben. Die Kulturerbe-Einrichtungen, sagt Gradmann, könnten sich in eine globale Wissensarchitektur einbringen. Ihnen stellten sich dadurch aber auch neue Fragen, denn: "Wie viele partikulare Institutionen sind dann noch sinnvoll und erforderlich?"
Mutig vorangegangen in der digitalen Öffnung war das Bundesarchiv, das seit 2008 sein Bildarchiv in der deutschen Wikipedia hochlud. Die Kooperation war ein immenser Erfolg. Um 193 Prozent wurden die Einnahmen des Bundesarchivs zwischen 2008 und 2010 gesteigert, die schriftlichen Anfragen an das digitale Bildarchiv nahmen um 230 Prozent zu. Eine Vielzahl falscher Bildreferenzen konnte durch Nutzerhinweise korrigiert werden. Der Leiter des Bildarchivs Oliver Sander sagt darum, die Zusammenarbeit mit Wikipedia "war und ist hervorragend".
Dennoch beendete das Bundesarchiv sie vor einem Jahr. Schuld waren nicht so sehr die Reibungen im Betrieb, zu denen das erhöhte Nutzerinteresse bei gleichbleibendem Etat und Personalstand unvermeidlich führte. Vielmehr wurde man dem massenhaften Missbrauch der Bilder nicht Herr, die in satten 95 Prozent der Fälle außerhalb von Seiten der Wikipedia nicht mit den nach der Creative-Commons-Lizenz notwendigen Angaben verwendet wurden. "Kein Irrweg, sondern ein Lehrpfad" sei das Wikipedia-Experiment gewesen, meint Sander heute dennoch. Die Konsequenz könne in keinem Fall sein, dass man sich wieder aus dem Netz zurückziehe. Im Gegenteil lasse der Auftrag des Archivgesetzes, Bestände nicht nur zu verwahren, sondern auch nutzbar zu machen, gar keine andere Wahl, als eben ein digitales Bundesarchiv zu werden.
Dass die etablierten Kulturbewahrer an einer Abgrenzung zu den digitalen Wissensvermittlern gar kein Interesse mehr haben, dass sie sich als Teil ein und der selben Community begreifen, machte in Berlin auch Preußenstiftungs-Vize Schauerte mit einem Satz klar, der vor wenigen Jahren noch für Schockreaktionen gesorgt hätte: "Man kann sich über die Museumsinsel genauso gut bei der Wikipedia informieren wie auf unserer eigenen Website."