Die Generationen nach den Babyboomern, also all jene, die nach 1964 geboren wurden, sind die ersten nach dem Zweiten Weltkrieg, die nicht mehr mehrheitlich ihre Eltern wirtschaftlich übertreffen werden. Sich Wohlstand aus eigener Kraft zu erarbeiten, ist schwieriger geworden, vielen Menschen droht später die Altersarmut. Was sind die Ursachen dafür? Julia Friedrichs hat für ihr Buch "Working Class" Menschen begleitet, die dachten, dass Arbeit sie durchs Leben trägt, die reinigen, unterrichten, jeden Tag ins Büro gehen und feststellen, dass es trotzdem nicht reicht. Und sie hat mit Expertinnen und Politikern gesprochen, um herauszufinden, was falsch gelaufen ist.
SZ: Frau Friedrichs, wie definieren Sie eigentlich die "Working Class", die arbeitende Klasse?
Julia Friedrichs: Dazu gehören für mich alle Menschen, die allein mit ihrer Arbeit ihr Leben finanzieren müssen, ohne Vermögen, Rücklagen, Eigentum oder Fonds. Nach dieser Definition sind in Deutschland ungefähr die Hälfte der Menschen Teil der Working Class.
Viele dürften bei dem Begriff eher an den Arbeiter am Fließband denken.
Sich bei der Definition auf Ausbildungsgänge oder bestimmte Berufe zu beschränken, finde ich veraltet. Die Musikschullehrerin mit Examen, die auf Honorarbasis arbeitet, gehört genauso zur Working Class wie der ungelernte U-Bahn-Reiniger.
Die Musikschullehrerin Alexandra, der U-Bahn-Reiniger Sait oder Christian, der bei einer Firma angestellt war, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen für die Marktforschung auswählt - Sie haben all diese Menschen mehr als ein Jahr lang begleitet. Wie kam die Auswahl zustande?
Ich wollte, dass die Vielfalt sichtbar wird. Mir war aber auch wichtig, dass diese Menschen eine Geschichte haben, die über ihre Werktätigkeit hinausgeht, weil ich wollte, dass man ihnen lange zuhört und bereit ist, sich auf ihre Leben einzulassen.
Welche Geschichten waren das?
Zum Beispiel, dass der Sohn der Musikschullehrerin und des Musikschullehrers überlegt, selbst Musiker zu werden, und die Eltern sich fragen, ob sie ihm davon abraten sollen. Weil sie wissen, dass das, was sie lieben, sie in diese schwierige finanzielle Lage gebracht hat. Ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die Depressionen oder einen Burn-out bekommen haben, weil die Inbrunst, mit der sie ihren Job machten, von der Firma nicht zurückgezahlt wurde. Davon erzählt Christians Geschichte.
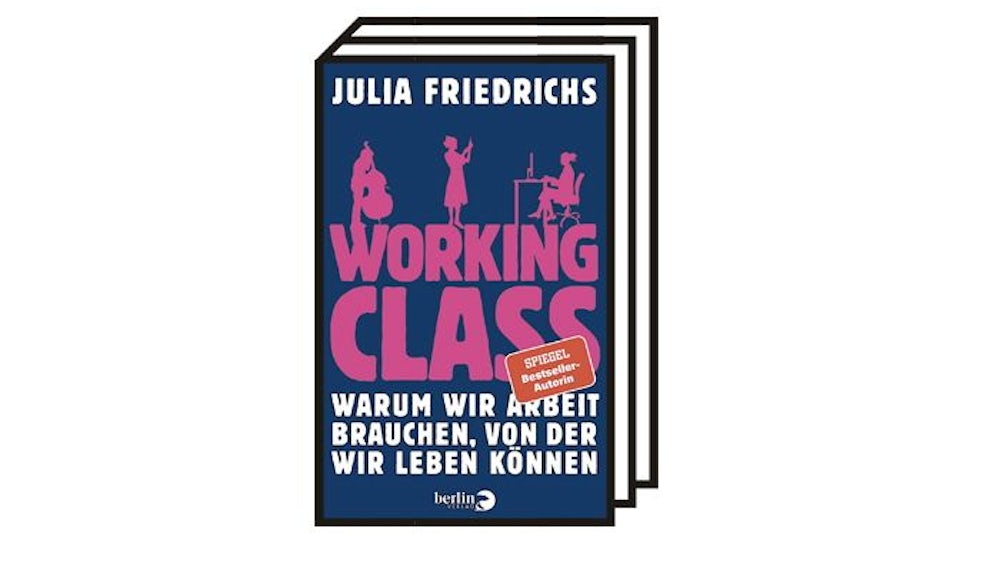
Ist es ein typisches Symptom der modernen Working Class, dass die Menschen ausbrennen, weil sie beruflich nicht vorwärts kommen?
Ich glaube schon. Früher konnte man bei den meisten Unternehmen eine klassische Laufbahn machen: Man hat unten angefangen und sich hochgearbeitet, bis man nach 45 Dienstjahren mit einem dicken Blumenstrauß verabschiedet wurde. Die Arbeitsbeziehung war als lebenslange Ehe angelegt. Bis heute gibt es Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die sich mit Haut und Haaren einem Unternehmen hingeben, aber die Beziehung ist von der anderen Seite eher als Affäre geplant: So lange es geht, geht's, dann ist Schluss.
Sie haben auch mit einem Vermögensverwalter gesprochen, der sehr reiche Kunden hat, was erschien Ihnen da die wesentliche Erkenntnis?
Dass es am anderen Ende gut läuft. Das Vermögen der unteren Hälfte wächst nicht, während die Reichen abheben. Ich war in einem "Family Office", also einem Büro, das sich um die Pflege des Vermögens von sehr reichen Menschen kümmert und für sie überlegt: Kaufen wir damit Wald? Immobilien? In welchen Hedgefonds gehen wir? Das ist weit von dem entfernt, was andere machen können.
Ungleichheit kann auch Ansporn sein.
Klar, beim Monopoly ist es auch ein Ansporn, wenn einer mit drei Straßen mehr gestartet ist, weil man ihn noch einholen kann. Aber wenn er jedes Mal, wenn er über "Los" geht, das Zehnfache von dem einstreicht, was ich bekomme, ist das kein Wettbewerb mehr.
Sondern bloß noch unfair?
Ja. In den USA kann man bereits messen, dass die Arbeitsmotivation der unteren Mittelschicht nachlässt. Wenn du immer machst und tust und es haut trotzdem nicht hin, dann hörst du auf lange Sicht auf, zu machen und zu tun. Das ist natürlich fatal.
Als einer der Gründe für die ungleiche Vermögensverteilung gilt das unausgeglichene Verhältnis von Finanz- und Realwirtschaft.
In den Siebzigern waren sie etwa gleich groß und die Finanzwirtschaft ein Dienstleister der Realwirtschaft: Sie hat Geld geliefert und damit wurden Dinge hergestellt. Inzwischen ist die Finanzwirtschaft viermal so groß wie die Realwirtschaft und das System funktioniert nach ihrer Logik. Am Beispiel Karstadt kann man das gut sehen: Ich glaube, man tritt dem Haupteigentümer René Benko nicht zu nahe, wenn man sagt: Ihm geht es nicht nur darum, zukunftsträchtige Warenhäuser zu etablieren, sondern um das Investment in die guten Immobilien, die an Wert gewinnen und verkauft werden können. Von der tatsächlichen Arbeit bei Karstadt ist das weit entfernt und damit auch von den Angestellten. Die merken natürlich, dass für das Unternehmen nicht mehr allein zählt, wie gut sie als Verkäufer oder Verkäuferin von Salat sind, sondern wie sich der Immobilienpreis des Kaufhauses entwickelt, in dem sie den Salat verkaufen.
Wer heute Teil der Working Class ist, hat häufig noch mitbekommen, wie Eltern oder Großeltern sich durch ihre Arbeit ein gewisses Vermögen aufbauen konnten. Was macht das Ihrer Ansicht nach mit den jüngeren Generationen?
Es macht es schwerer zu erkennen, warum es heute anders ist. Ich habe bei Veranstaltungen erlebt, dass Menschen, die in der alten Bundesrepublik groß geworden sind, immer noch davon ausgehen, dass für jemanden, der sich anstrengt, alles möglich ist, und das auch so weitergeben: "Ich habe als Schlosserlehrling angefangen und jetzt besitze ich vier Häuser, jeder kann das schaffen!" Aber die erzählen von einem anderen Land. Wir sehen in allen Daten, dass es in den Achtzigern und Anfang der Neunziger einen Bruch gab. Damals sind viele Dinge gleichzeitig passiert.
Welche?
Die bestehenden Vermögen sind größer geworden, die Löhne in den unteren Segmenten gesunken, die Berufsbiografien wurden brüchiger, es gab zum Beispiel immer mehr befristete Verträge, und die Sozialabgaben sind gestiegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Ziel "Meine Kinder sollen es einmal besser haben" jahrzehntelang erreicht - aber von denen, die nach 1980 geboren wurden, schafft es nur noch die Hälfte, mehr Wohlstand aufzubauen als die eigenen Eltern. Vor allem gelingt es denen nicht mehr, bei denen es wichtig wäre, weil es ihren Familien nicht so gut geht.
Die vermögenden älteren Westdeutschen, also die, die zwischen 1946 und 1964 geboren wurden, nennen Sie die "goldene Generation" . Was zeichnet sie aus?
Sie sind Glückskinder und waren immer zur richtigen Zeit im richtigen Alter: Als das deutsche Bildungssystem ausgebaut wurde, sind sie zur Schule und an die Unis gegangen, als es hohe Zinsen gab, konnten sie sparen und Immobilien erwerben, jetzt sind sie alt und bestens versorgt. Es würde mich freuen, wenn sie dieses Glück anerkennen und teilen würden. Wenn etwas weitergegeben wird, dann an die eigenen Kinder und Enkel, aber das nützt ja all den anderen nichts.
Allerdings sind auch heute schon fast 17 Prozent der Senioren und Seniorinnen von Altersarmut betroffen.
Das stimmt. Es gibt auch unter älteren Menschen Armut und natürlich ist das schlimm, das will ich gar nicht kleinreden. Aber unter dem Strich ist keine Generation so wohlhabend wie die aktuell ältere.
Kann man der "goldenen Generation" , der es heute so gut geht, denn den Vorwurf machen, auf Kosten der nachfolgenden Generationen zu leben und gelebt zu haben?
Ich finde schon. Viele wusste, dass die Rechnung nicht aufgeht und dem System mehr entnommen als hineingegeben wurde. Das ist analog zur Klimakrise: Auch unserer Generation wird man zurecht vorwerfen, dass wir davon wussten und nicht gehandelt haben. Aber auch wir neigen dazu, zu sagen: "Puh, gut, dass wir noch davongekommen sind."
Der 1989 geborene stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD Kevin Kühnert, den Sie auch für das Buch interviewt haben, sagt, dass die junge Generation zwar für mehr Klimaschutz auf die Straße geht, aber sich nicht genug für ihre sozialen Rechte einsetzt. Teilen Sie diese Ansicht?
Ja, denn viele sind zu sehr daran gewöhnt, Probleme im Arbeitsleben als individuell zu verstehen und sich nicht mehr gemeinsam dagegen zu organisieren.
2015 wurde der Mindestlohn eingeführt, um die Lage der Geringverdiener zu verbessern. Warum hat es kaum etwas gebracht?
Der Mindestlohn hat schon etwas verändert. Für die untersten Einkommen hat er die Lage verbessert und er führt oft dazu, dass die Löhne direkt darüber ebenfalls steigen. Ich glaube aber, dass er zu niedrig ist. Wer ihn bekommt, müsste davon ein gutes und sicheres Leben führen können. Außerdem erfasst er nur die Beschäftigten in regulären, sozialversicherungspflichtigen Jobs - das Musikschullehrer-Paar etwa hat jedoch Honorar-Verträge, an denen seit 2011 nichts mehr geändert wurde.
Nur elf Prozent der Deutschen besitzen Aktien, ihr Vermögen wächst heute meistens noch. Müssten alle in Aktien investieren, weil allein durch Arbeit oft keine finanzielle Sicherheit mehr möglich ist?
In den vergangenen Jahre hätte man damit gute Chancen gehabt, aus wenig Erspartem Vermögen aufzubauen. Aber sollte man jemandem, der nicht weiß, ob er seinen Kindern Wintermantel und -schuhe wird kaufen können, ernsthaft raten, in Aktien zu investieren? Obwohl die Gefahr besteht, dass die Person sich damit nicht auskennt und Geld verliert? Ich glaube, da könnte es klügere Modelle geben.
Zum Beispiel?
Ein Staatsfonds, wie ihn die Norweger haben. Dadurch würde nicht jeder einzeln an der Börse spekulieren, sondern Geld aus Vermögen würde in einen gemeinsamen Fonds eingezahlt, aus dem alle etwas ausgezahlt bekommen.
Sie fordern in Ihrem Buch auch ganz grundsätzlich eine neue Vermögenspolitik. Was könnte noch Teil davon sein?
Das Modell des Mietkaufs finde ich auch sehr überzeugend: Der Staat würde bauen und die Bewohner würden über die Miete die Wohnung Stück für Stück kaufen. So könnten Familien aus der unteren Mittelschicht Eigentum erwerben, ohne Kapital aufbringen zu müssen. Ein anderes gutes Modell ist die soziale Erbschaft, bei der ein Teil aller Erbschaften in einen Fonds eingezahlt und daraus ein Startkapital für junge Menschen finanziert wird. Insgesamt müsste der Staat das Thema Vermögensaufbau ernster nehmen, stattdessen ist das Budget dafür in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Gerade für Menschen aus ostdeutschen Familien oder Familien mit Migrationsgeschichte wäre es total wichtig, dass sie Vermögen aufbauen können, weil sie keinen Teil der westdeutschen Wirtschaftswunderjahre via Erbschaft abgreifen werden.
Sie haben für Ihre Recherche auch deutsche Familienserien aus den Achtzigern angeschaut, zum Beispiel die "Lindenstraße" und die "Schwarzwaldklinik" . Warum?
Ich habe versucht, in die westdeutschen Achtziger zurück zu reisen, weil mir viele Ökonominnen gesagt haben, dass es danach zum Bruch kam. Und Serien wie die "Lindenstraße" hatten den Anspruch, den Alltag nachzuerzählen. Es gibt Szenen, in denen Hans Beimer minutiös seine Ausgaben protokolliert. Offensichtlich konnte damals ein Sozialarbeiter mit drei Kindern als Alleinverdiener mitten in München leben. Gleichzeitig war ich total erschüttert, wie schrecklich das Familienbild in diesen Serien war, wie mies die Frauen behandelt und wie die Männer hofiert wurden. Das hat sehr geholfen, um nicht zu denken: "Ich will dahin zurück." Das will ich keine Sekunde. Ich finde, wir sollten über etwas Neues nachdenken. Etwas Besseres.