Der Produzent Siggi Loch hat gerade einen Sampler mit dem Titel "Fantastische Frauen" (Act) veröffentlicht. Das ist zunächst einmal eine Verneigung vor Musikerinnen und Sängerinnen auf seinem Label Act. "Musik ist weiblich", steht im Begleittext. "Und das war sie schon immer, ob auf Italienisch, Deutsch oder Französisch. Viva la musica. Die Musik. La musique. Und im Jazz? Im 20. Jahrhundert führten Musikerinnen ein Schattendasein." Womit er schon beim Thema ist, denn der Jazz hatte immer schon ein Frauenproblem, das eigentlich ein Männerproblem ist. Man muss da gar nicht tief in die Abgründe schauen, wie man sie etwa in Charles Mingus' Autobiografie "Beneath the Underdog" findet oder in den Erzählungen von Betty Davis, wie Miles sie behandelt hat, als sie vorübergehend mal verheiratet waren. Die Jazzgeschichte ist ein Boys Club, in der die Frauen in erster Linie als Sängerinnen und hin und wieder als Pianistinnen auftauchen. Nicht dass das in anderen Musiksparten besser wäre.

Man könnte nun noch debattieren, ob so ein Sampler eine Form der positiven Diskriminierung ist. Oder ob man Act zugestehen kann, dass man die Geschlechtergerechtigkeit dort schon früh musikalisch behandelt hat. Denn bei "Fantastische Frauen" findet sich keine ästhetische Klammer. Der Sampler hört sich an wie eine Playlist, die den aktuellen Stand des Jazz mit seiner Virtuosität und seiner Bandbreite auf den Punkt bringt. Große Namen sind dabei wie Julia Hülsmann, Terry Lyne Carrington und Johanna Summer, einige Unbekannte. Das hat zumindest musikalisch eine Selbstverständlichkeit.

Mag sein, dass Hip-Hop, Rock und Pop schon ein paar Schritte weiter sind. Diese Selbstverständlichkeit findet sich aber immer öfter. Auf dem neuen Album "12 Stars" (Blue Note) von Melissa Aldana zum Beispiel. Die spielt Tenorsaxofon, das ähnlich wie die Stratocaster-Gitarre im Rock das Symbol ungefilterter Männlichkeit bleibt, von den legendären Zweikämpfen der "Tenor Battles" bis hin zu den Verführungskünsten des Balladenhauchens. Aldana stammt eigentlich aus Chile, gehört aber schon seit mehr als zwölf Jahren zur New Yorker Szene. Man hört vom ersten Takt an, mit welcher Virtuosität sie jede noch so komplexe Idee spielen kann. Da erinnert sie an Zeitgenossen wie Chris Potter oder Immanuel Wilkins, die ihre extreme Handwerklichkeit für immer neue Ausdrucksformen nutzen. Mit ihrem Ton stellt sie sich allerdings deutlich gegen die Strömung vieler Bläser, sich im Klangbild ihrer jeweiligen Ensembles einreihen, wie Wilkins zum Beispiel. Aldana lässt ihrer halbakustischen Rhythmusgruppe viel Freiraum, aber wann immer sie ihren luftigen Ton ansetzt, fokussiert sich das Klangbild in seiner ganzen Klarheit auf sie. Dafür ist dieses Instrument ja auch da.

Daheim in New York spielt Melissa Aldana in dem All-Star-Septett Artemis, das die Pianistin Renee Rosnes mit sechs Musikerinnen gründete. Das Debütalbum war vor eineinhalb Jahren ein weiteres Zeichen, dass die Geschlechtergrenzen im Jazz so gar nichts mit Ästhetik zu tun haben. Zu Artemis gehört auch die Sängerin Cécile McLoren Salvant, auch wenn sie nur auf zwei Stücken des Albums dabei ist. Die ist in Amerika längst in der ersten Reihe, hat schon drei Grammys bekommen und vor zwei Jahren einen MacArthur Genius Grant, dieses sechsstellige Stipendium für die wirklich Besten und Klügsten aus Kultur und Wissenschaft, die Amerika zu bieten hat.
Salvant hat die finanzielle Freiheit offensichtlich gut genutzt. Auf ihrem neuen Album "Ghost Song" (Nonesuch) geht sie die letzten Schritte zu einem sehr eigenen Musikverständnis. Das beginnt gleich mal mit einem Statement. Erstes Stück des Albums ist eine Coverversion, die Kate Bushs "Wuthering Heights" auf einen minimalistischen Kunstgesang reduziert, der eineinhalb Minuten lang die Melodielinie zerdehnt wie ein Gummiband, und zu dem erst gegen Ende Bass und Orgel dazustoßen. Salvant irrlichtert mit großer Lust durch die Geschichte der amerikanischen Musik, changiert zwischen Torch Song und Vaudeville, zitiert Abbey Lincolns Bürgerrechts-Furor, Mahalia Jacksons Spiritualität und Blossom Dearies erotische Naivität. Das ist streckenweise großes Theater, dann wieder Avantgarde, das sprüht und funkelt, ohne jede Effekthascherei, weil die Instrumentierung auf einem allernötigsten Minimum gehalten wird.
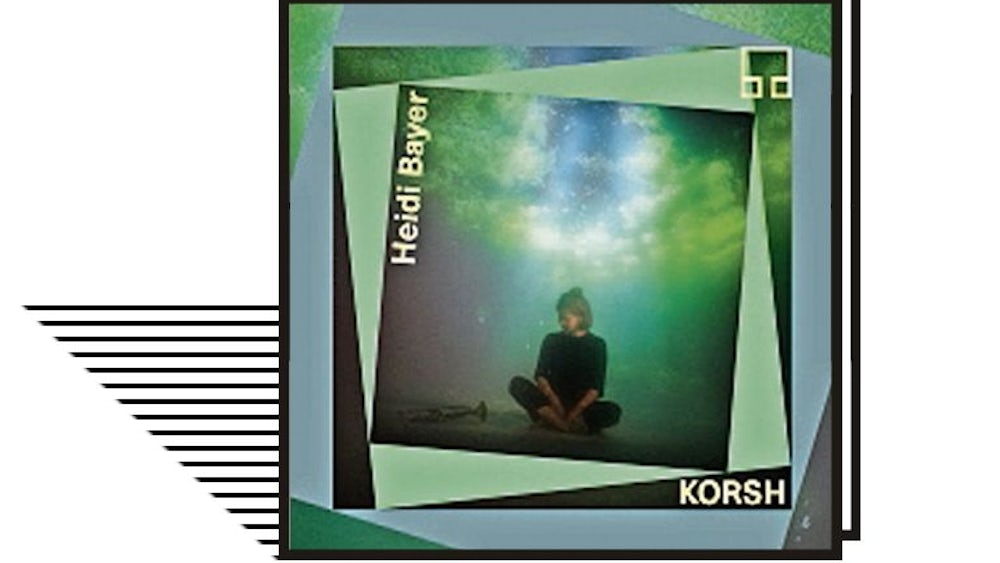
Die Liste der Neuerscheinungen von Musikerinnen, die derzeit ihre Stimme nach ihren eigenen Vorstellungen formen können ist lang. Julieta Eugenios Album "Jump" (Greenleafes) gehört dazu, eine deutliche Verbeugung der Tenorsaxofonistin vor dem Frühwerk von Sonny Rollins. Marta Sanchez' "SAAM (Spanish Art Museum)" (Whirlwind) umkreist den Jazz mit den großen Gesten ihrer spanischen Heimat mitsamt ihren Spannungsbögen und dramatischen Harmonien. Im April erscheint Heidi Bayers Album "Korsch", auf dem sie es schafft mit einem Quintett, in dem das Akkordeon das Klavier ersetzt, eine Brücke zwischen Mingus' Spätwerk und einem deutschen Folklorismus zu schlagen, der eher Volksbühne ist, als die Bierhalle, die sie in einem der Stücke beschwört. Und wer da wirklich ein Etikett für all diese Alben braucht, wäre mit "fantastische Musik" bestmöglich bedient.

