In Deutschland sei alles leichter, sagt ein kambodschanischer Junge während einer nächtlichen Bootsfahrt in gebrochenem Englisch: "Not so much problems." Der Junge lacht, "als schämte er sich für diese Meinung". Auch der Passagier aus Deutschland, der ja immerhin "mitten in der Nacht ein Boot gechartert" hat, "um auf eine einsame Insel zu fahren", ist sich nicht sicher, ob der Junge recht hat. Vielleicht sind deutsche Probleme ja mindestens genauso schlimm wie kambodschanische.
Schließlich, so kann man als Leser von Friedemann Karigs Romandebüt "Dschungel" mitdenken, gibt es kein objektives Maß für die Schwere von Leidensdruck, nur die subjektive Empfindung. Und dass der Erzähler seine Probleme für gewichtig hält, daran besteht kein Zweifel. Karig, im Tagesjob Journalist, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, erzählt von der Suche des namenlos bleibenden Erzählers nach seinem Jugendfreund Felix. Der scheint bei einer Tour nach Kambodscha spurlos verschwunden zu sein. Felix' Mutter, eine zugleich unangenehm dominante und weinerlich-selbstgerechte Frau, überrumpelt ihn. Sie drückt ihm ein Flugticket in die Hand und schickt ihn mit dem Auftrag nach Südostasien, ihren Sohn zu finden. Es handelt sich um eine Reise, die auf emotionaler Erpressung und einem vagen Schuldgefühl des Erzählers beruht. Eine durchaus solide Prämisse, zumal in einem Land, das Schauplatz grausamer Kriegsverbrechen war, sich derzeit aber rapide zum Ziel junger Backpacker entwickelt. Die Fahndung nach Felix gibt Gelegenheit zu einem individualtouristischen Trip durch Hostels und Märkte, Polizeistationen und schließlich auch den titelgebenden Dschungel.

Die zähen Nachforschungen alternieren mit Erinnerungen an eine Neunzigerjahre-Jugend in Süddeutschland. Hier entsteht zunehmend das Bild einer ziemlich ungesunden Dynamik zwischen dem Erzähler - einem Beta-Männchen, wie es im Buche steht - und dem im Laufe der Erzählung immer unsympathischer werdenden Felix.
Die Beteuerungen, man könne diesem mit suizidalen Posen kokettierenden Egozentriker "einfach nicht böse sein", wenn er seine Freundin bei einer Schultheateraufführung auf offener Bühne bloßstellt oder den Freund nach einem etwas peinlichen Alkoholzwischenfall tagelang einfach links liegen lässt, überzeugen nicht so recht. Auch das Schuldgefühl, das den Erzähler antreibt, Felix aufzuspüren, wird nie durch das gerechtfertigt, was zwischen den beiden vorfällt. Die Freundschaft, die ihn mit Felix verbindet, ähnelt streckenweise freiwilligem Vasallentum.
Die Rückblenden sind Tableaus einer bundesrepublikanischen Mittelschichtjugend, irgendwo zwischen Max von der Grüns "Vorstadtkrokodilen" und Stephen Kings "Die Leiche" angesiedelt, inklusive idiotischen Kämpfen mit einer wohlmeinenden Französischlehrerin und zart knospender erster Verliebtheit. Angereichert ist das mit zahlreichen popkulturellen Zitaten aus Walt Disney's "Dschungelbuch", den "Simpsons" oder Radiohead-Lyrics.
Die permapubertäre Weltwahrnehmung, die sich beide Knaben auch später wie einen Schatz bewahren werden, unterminiert die implizite Behauptung des Romans, er führe ernsthafte Lebenskrisen vor. Nicht jeder Leser jedenfalls dürfte so leicht zu beeindrucken sein wie der Erzähler, der bewundernd Felix' Teenager-Allegorie über die Endlichkeit des Seins lauscht: "Irgendwann, ganz am Ende, macht man zum letzten Mal das Licht aus. Und stirbt. Dann ist man nur eins dieser Lichter, die man ausgemacht hat. Einfach weg. Wie nie da gewesen."
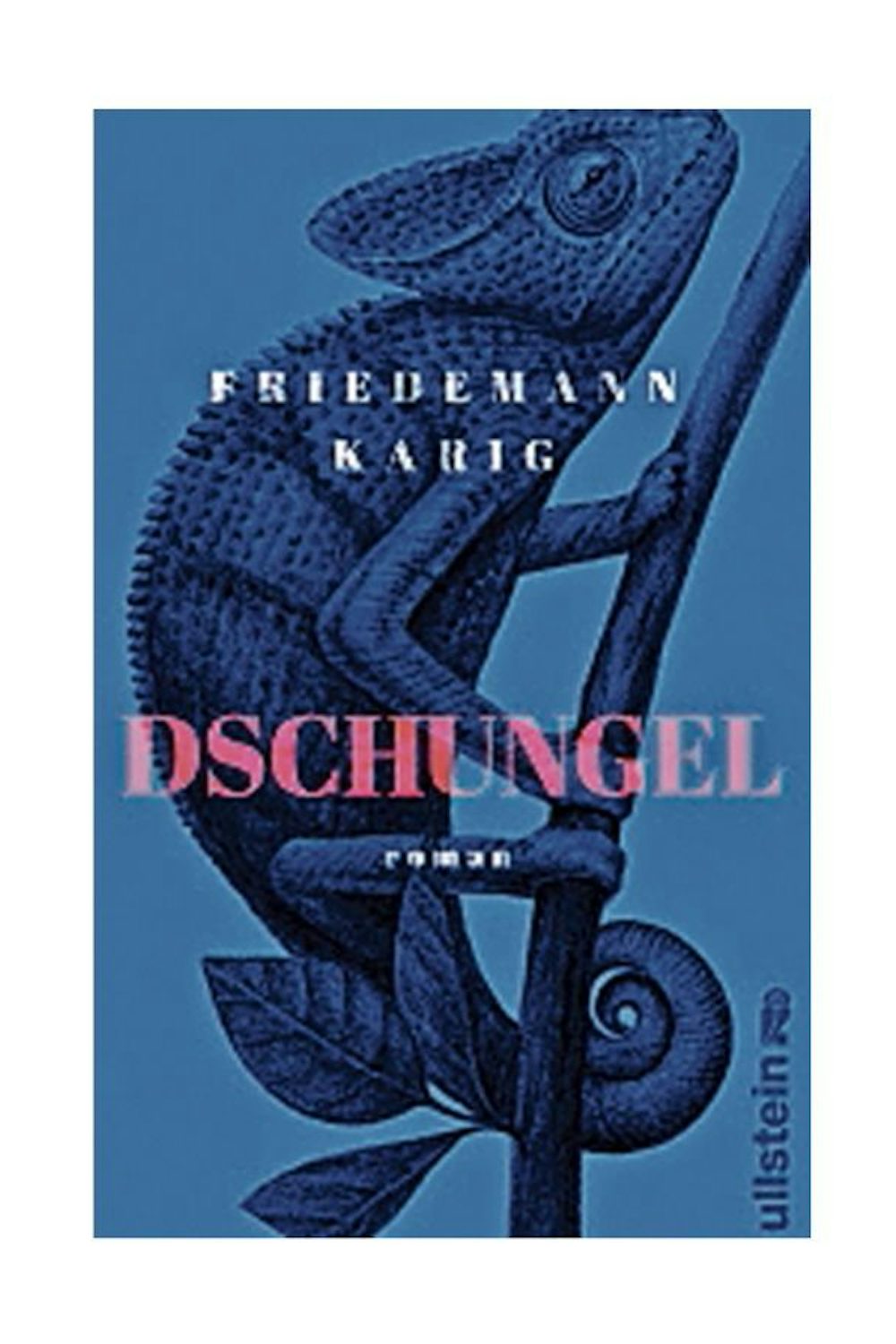
Elegant löst Karig in den kambodschanischen Szenen die Herausforderung, welche die Existenz des Smartphones an eine Geschichte stellt, in der es um früher schier unüberbrückbare geografische Distanzen geht. Potenzieller Fluch jeder zeitgenössischen Abnabelungserzählung, spielt es einerseits als Spur auf dem tastenden Weg zu Felix eine tragende Rolle, andererseits wird es zur Waffe gegen die Daheimgebliebenen - Felix' nervende Mutter, den erstaunlich geduldigen Arbeitgeber, die bedauernswerte Freundin des Erzählers. Durch selektive Kommunikation (und Kommunikationsverweigerung) hält er sie alle auf Distanz, nicht nur räumlich.
Die Landesbeschreibungen haben derweil streckenweise etwas von einem Condé-Nast-Traveller-Essay: Die Menschen "lächeln unablässig", "schwarzer, blauer, roter Müll" am Straßenrand, der so bunt leuchtet, dass er "fast fröhlich" aussieht.
Das wäre für sich genommen durchaus in Ordnung. Allerdings stehen diese Passagen wie Versatzstücke zwischen den bedeutungsschwangeren Reminiszenzen und Reflexionen, in denen der Erzähler sich ergeht. Unterschiedlich überzeugend sind auch die Interaktionen auf dem Weg zum flüchtigen Ziel namens Felix. Da sind flirtende spanische Abenteuerreisende und ein nervöser Drogenhändler, ein jovialer Hostel-Animator und ein berauschter Taxifahrer im Piratenlook, zwei Computerhacker-Aussteiger, die auf ihren Laptops herumtippen, und eine Frau, die sowohl als sexuelle Verlockung als auch als Katalysatorin seiner Gralssuche dient. So richtig warm wird der Erzähler mit keinem von ihnen, dafür ist er zu besessen - von Felix, vor allem aber von sich selbst.
Was bedeutet es, wenn Gewürze riechen "wie Lexikoneinträge ihrer selbst"?
Dass sich diese Einzelszenen dennoch flüssig weglesen, ist dem gekonnten Einsatz von Cliffhangern geschuldet, die immer dann in die Jugend nach Deutschland zurückschwenken, wenn es in Kambodscha spannend zu werden verspricht. Karigs Vergleiche und Metaphern aber wirken oft gesucht: Gewürze riechen "wie Lexikoneinträge ihrer selbst", der Hals des Erzählers ist "eine Wüste", "vom Klimawandel meines Lebens ausgedörrt", Pupillen weiten und verengen sich "wie die Kiemen eines Fisches an Land". Zudem ist der innere Monolog des Erzählers so dicht durchsetzt von vermeintlich richtungsweisenden Aha-Erlebnissen ("Und in diesem Moment verstand ich, dass der rosa Zettel völlig egal war."), dass sich ihr Effekt rasch abnutzt.
Eine kambodschanische Herbergsbetreiberin beschreibt als Problem des Massentourismus, dass "alle das Gleiche machen, das Gleiche sehen und deshalb auch das Gleiche erzählen". Das ist zugleich auch ein Problem der Literatur: Die Wohlstandsnivellierung erschwert Originalität. Selbst die Ereignisse in der Hippiekommune, in der Karigs Erzähler zwischendurch landet, wirken wie eine schaumgebremste Version von Alex Garlands "Der Strand".
Der angebliche Ernst der Probleme aber, die der Erzähler und sein absenter Freund Felix mit sich herumschleppen, erweist sich letztlich vor allem als Gradmesser ihres Unwillens, erwachsen zu werden. Die Rebellion gegen Eltern und Schule, die Flucht in die grüne Ferne und die beachtliche Egomanie, die sich als Opferbereitschaft tarnt, sind Vermeidungsstrategien zweier konsequent Unreifer. Es bleibt der Eindruck, dass hier Menschen weglaufen, weil es daheim irgendwie zu anstrengend wurde. Eine Reise ins Herz der Finsternis ist das nicht gerade.