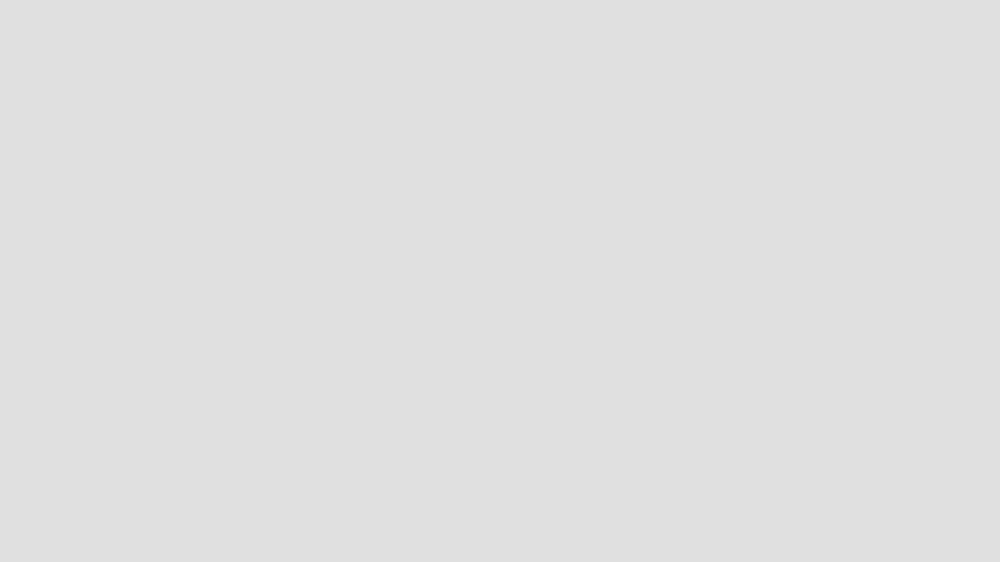Wie viele Buchseiten muss man vollschreiben, um eine ganze Welt zu erklären? Die Antwort ist: 5568. So viele brauchte der niederländische Schriftsteller J. J. Voskuil, als er sich von 1996 an daranmachte, minutiös die Umgebung zu schildern, in der er jahrzehntelang gearbeitet hatte. "Het Bureau" heißt sein siebenbändiges Romanepos, es ist ein arbeitshistorisches Monument, denn es dreht sich auf ganzer Länge nur um das Wesen des Büros und darum, was es mit den Menschen macht, die darin ihre Leben absitzen. Im Gegensatz zu seinen Protagonisten, die sich im ewig dämmernden Zustand der Nicht-Produktivität befinden, hatte Voskuil mit seiner Arbeit in den Niederlanden großen Erfolg ("Das Büro", auf Deutsch im Verbrecher Verlag).
Jenseits der Literatur aber scheint die Geschichte des Büros eine Geschichte voller Missverständnisse zu sein. Seit seinen modernen Anfängen (Kafka ging ja noch ins "Kontor") will es sich eigentlich von sich selbst befreien. Schon 1964 legten die amerikanischen Designer Robert Probst und George Nelson mit dem "Action Office" ein Büromöbel-Set vor, das den Angestellten lässig losgelöst im Raum positionieren und zu mehr Bewegung und Abwechslung verleiten sollte.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein - das ist nicht immer Zufall. In diesen fünf Schritten lassen sich berufliche Chancen kreieren und nutzen.
Seit mehr als 50 Jahren arbeiten sich die Gestalter an solchen Zielen ab, seitdem geht es beim Stichwort "innovativer Arbeitsplatz" immer um mehr Dynamik und weniger Bürogefühl. Denn das hat mit den Jahrzehnten massiv an Ansehen eingebüßt - nicht zuletzt seit TV-Hits wie "The Office" und "Stromberg" das Büro als Epizentrum des Stumpfsinns entlarvten und Therapeuten es als Keimzelle der Burn-outs ins Visier nahmen. Lange schien die fade Einheit von grauem Resopaltisch, Drehstuhl, Topfpflanze und tropfiger Teeküche trotzdem nur in Details veränderbar zu sein. Größer werden die Fortschritte erst, seit sich die Büroarbeit selbst rasant verändert hat. Seit sie digital, cloudbasiert und von nahezu überall zu erledigen ist, seit relativ kurzer Zeit also, bewegt sich etwas bei der Fahndung nach einer guten Büroumgebung.
Ein moderner Arbeitsplatz braucht keine Wände, sondern Kokons, Raumtrenner, Sofas
Wichtige Vorreiter sind dabei die Co-Working-Spaces, die zuletzt in den Metropolen der Welt entstanden sind. Sie dürfen als innovative und meist sehr interessant konzipierte Versuchsgelände einer neuen Arbeitswelt gelten. Und ein Chef der Zukunft, so die Annahme, wird ähnlich gut gestaltete Argumente brauchen, um die Mitarbeiter noch leibhaftig unter sein Firmendach zu locken. Dass diese Argumente auch mit Mitteln des Interieurdesigns geschaffen werden können, zu dem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Fraunhofer Instituts. In dem Papier wurde die Entwicklung weg von hergebrachten Einzel- und Großraumbüros hin zu zukünftigen Multispace-Umgebungen beleuchtet.
Multispace, das ist auch einer der vielen Kunstbegriffe, die auf der Orgatec-Büromesse im Herbst in Köln kursierten. Letztlich wollen all diese Wortschöpfungen etwas Ähnliches umreißen: die Auflösung bestehender Büroformen zugunsten einer luftigen Arbeitsumgebung, die parallel mehrere Aufgaben erfüllt und möglichst viele Hierarchien und Firmenbereiche einbezieht. Ergänzt wird so eine Multispace-Vision meistens noch um etwas, das die Fraunhofer-Wissenschaftler "non-territoriales Bürokonzept" nennen.
Dergleichen kennt man von den jungen Duz-Konzernen: Jeder Angestellte sitzt jeden Tag, wo er will, soll frei durch die Etage ziehen und dabei nach Laune und Bedarf unterschiedliche Plätze finden können. Darunter auch abgeschottete, eigene Bereiche, zum Telefonieren oder Konzentrieren.
Konsens der Objektausstatter und Architekten ist mittlerweile: Ein moderner Arbeitsplatz benötigt zwar zum einen Demokratie und deshalb gestalterische Offenheit. Ein moderner Arbeitsplatz erfordert aber zum anderen auch Privatsphäre - die das klassische Großraumbüro noch bekämpfte. Und deshalb braucht es weiterhin ein paar Wände. Das sollen aber nicht unbedingt die ollen Zimmerwände sein. Die Designer auf der Orgatec brachten stattdessen eine Vielzahl organischer Kokons mit, dazu innovative Raumtrenner, Sofas mit abschirmenden Seitenwänden, nachempfundene Telefonzellen oder lustig in den Raum gewürfelte Kuben.
Die Auftritte der großen Möbelhersteller und ihrer Designer auf der Fachmesse wirken übrigens immer ein wenig akrobatisch gespreizt. Einerseits wollen sie keinesfalls in den Ruch von Kantinenplan- und Stempelkarten-Tristesse geraten. Andererseits sind die Aufträge der Büro- und Objektausstattung weiterhin die lukrativsten in der Möbelbranche. 600 Stühle und Schreibtische, die eine Firma en gros für ihren neuen Standort ordert, muss man im Wohnbereich sehr mühsam einzeln verkaufen. Man versucht also in Köln immer progressiv, aber trotzdem für den Durchschnittschef verständlich die Zukunft zu möblieren.
Es waren diesmal auch auffällig viele namhafte Designer da - als Botschafter der Büro-Revolution sozusagen. Vitra, der Branchenprimus aus der Schweiz, demonstrierte seine Innovationsfreude dann auch mit einer ganzen Messehalle, wo eine futuristische "Work"-Ausstellung aufgebaut war. Bei deren Durchquerung hatte man allerlei Assoziationen (Atelier, Fitnessstudio, Dachterrasse, Open-Air-Kino), musste aber nie an die eigene Teeküche denken. Die renommierten britischen Produktdesigner Edward Barber und Jay Osgerby erklärten in der Vitra-Pressekonferenz, welche Orte ihnen als Vorbild für das neue Büro vorschweben: urbane Hotellobbys oder Airport-Lounges.

Viele Firmen erlauben keine Heimarbeit. Das Recht darauf muss die Koalition konsequenter angehen als das neue Teilzeitgesetz.
Im Eingangsbereich des coolen Ace Hotels in London-Shoreditch jedenfalls hätten sie beobachtet, wie Menschen arbeiten und gleichzeitig Teil einer inspirierenden Umgebung sein können. Den Schreibtisch im Büro halten die beiden Designer deshalb für ähnlich entbehrlich wie einst das separate Esszimmer im Eigenheim. Die Arbeitsgewohnheiten und technologischen Möglichkeiten hätten sich nun mal verändert. Und eine moderne Hotellobby spiegele genau das sehr gut: Kaffee trinken, sich unterhalten und Termine absolvieren; Mails schreiben, die Plätze beliebig wechseln und von der Umgebung in Schwingung versetzt werden - all das passiere dort bereits.
Deswegen stellte das Designerduo in Köln ein Bürosofa namens "Soft Work" vor, das vom Ruheort zur Arbeitsstation samt Strom, Bildschirm und Ablagetischen hochgerüstet werden kann. Und das vor allem zwangloses Lobby-Flair und kreatives Herumsitzen unterstützen soll. Die Multicouch!
Der Bürothron soll weg
Noch wilder war das Szenario, das Stardesigner Konstantin Grcic ein paar Meter weiter ausgetüftelt hatte. Sein "superflexibles Büro" war eigentlich ein unstrukturierter (man kann auch sagen: unaufgeräumter), weitgehend leerer Raum, bereit dafür, immer neu und für jeden Anlass bestückt zu werden. "Ähnlich wie eine Turnhalle, die ja für eine Vielzahl an Aktivitäten konfigurierbar ist", erklärte Grcic. Sein neuer "Rookie"-Bürostuhl macht dieses fragmentierte Büro ganz gut begreifbar: ein Stuhl, dessen Radikalität darin besteht, dass er simpel ist und reiner Sitz. Gegenentwurf zu Hightech-Bürostühlen, die in der Vergangenheit zu grotesken Ergonomie-Maschinen aufgemotzt wurden und damit das Bürohocken bis weit nach Feierabend zelebrierten. Der kleine Rookie lässt dagegen eher an volatile Arbeitshocker in Schulen oder Werkstätten denken. Kein Bürothron, sondern eine schnelle Sitzgelegenheit für jeden, der sie braucht.
Natürlich, die Messe mit ihren Zukunftskonzepten sagt noch wenig über den Ist-Zustand in deutschen Büros. Um die Fortschritte vor Ort zu erleben, muss man sich die aktuellen Arbeiten eines Büroausstatters wie zum Beispiel der Firma Designfunktion ansehen. Aus dem Münchner Unternehmen wurde in den vergangenen Jahren ein Vordenker in Sachen neuer Arbeitsumgebung. Für den Werbeplatzvermarkter Ströer etwa hat das Team in Berlin ein sehenswertes, sehr junges Office entwickelt, mit eigenem Turnraum und Birkenwald im Besprechungszimmer.
Einer der reizvollsten Aufträge der jüngsten Vergangenheit dürfte aber die Neuerfindung einer Sparkassenfiliale gewesen sein, die Designfunktion gerade in Weiden in der Oberpfalz abgeschlossen hat. Eine Bank-Zweigstelle ist ja stets der Prototyp des Nicht-Ortes gewesen, ein stilistisches Vakuum, in dem die Zeit in steriler Dienstleistungsumgebung und vor biederer Bausparkulisse stehen geblieben ist.
Umso erstaunlicher, wie die Bank in Weiden jetzt zum ersten Abbild der digitalisierten Sparkassenwelt mutierte. Futuristische Besprechungskapseln, Akustik-Vorhänge, flexible Sitzplätze, variable Wege für Kunden und Angestellte, Farben, Lichtbänder und organische Formen - vieles von dem, was auf der Messe in Köln Theorie war, gibt es in der kleinen Bank schon. Wenn die das schaffen, besteht auch Hoffnung für alle, die derzeit immer noch auf graue Stellwände schauen. Oder ihren öden Drehstuhl mit dem Brieföffner gegen den Kollegen verteidigen müssen.