Ganz vorne. Das ist die Position, in der Frank-Walter Steinmeier die deutsche Hilfe im Kampf gegen Ebola sieht. "Die Bundesregierung hat frühzeitig reagiert", schreibt der deutsche Außenminister in einem Beitrag auf der Website des Auswärtigen Amtes. Denn wer genau hinschaue, werde schnell merken "wie brandgefährlich die Lage ist". Steinmeier warnt vor Tatenlosigkeit. Und er hebt die vielen Hilfen hervor, die Deutschland den betroffenen Staaten in Westafrika "seit Monaten" habe zuteil werden lassen.
Unter deutschen Seuchenexperten trifft diese Einschätzung der Regierung allerdings auf wenig Zustimmung. Der Berliner Infektionsmediziner Norbert Suttorp etwa, der auf dem Virchow-Campus der Charité die bundesweit größte Isolierstation für Patienten mit hochansteckenden Krankheiten leitet und damit eine der potenziellen Anlaufstellen für die Behandlung Ebola-infizierter Helfer, zeigt sich enttäuscht von der zögerlichen Haltung der Verantwortlichen. "Ich kenne die Bedarfslage in den betroffenen Gebieten nicht im Detail, aber das ist doch eine humanitäre Aktion", sagt der Arzt. "Da könnte Deutschland Verantwortung übernehmen, Hilfe organisieren, es in die Hand nehmen, das Problem zu lösen. Aber davon kann ich bisher nichts erkennen".
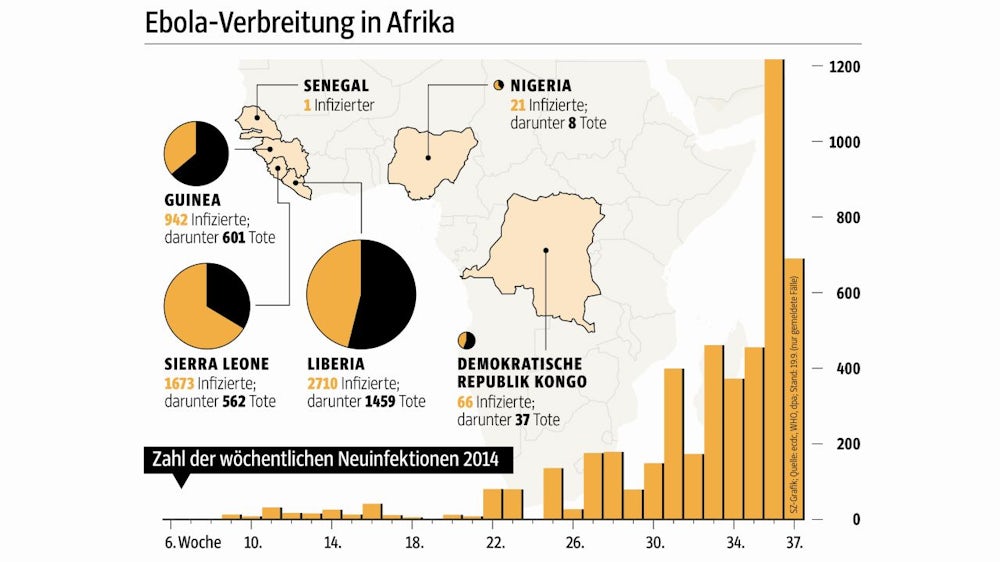
"Wir bräuchten so etwas wie ein Technisches Hilfswerk für Seuchen."
Die Mobilisierung freiwilliger Helfern aus der zivilen Versorgung hält Suttorp für schwierig, es gebe zu wenige Ärzte an den Kliniken, als dass diese einfach für ein paar Monate nach Westafrika gehen könnten - selbst wenn sie dies wollten. Überhaupt fehlen nach Ansicht des Mediziners ganz grundlegende Strukturen in Deutschland, um auf eine humanitäre Seuchenkrise zu reagieren. Für andere Katastrophen gebe es personelle und materielle Vorhaltungen, etwa für Erdbeben. Für Ausbrüche schwerer Infektionen dagegen nicht. "Wir bräuchten so etwas wie ein Technisches Hilfswerk für Seuchen", sagt Suttorp. Das sei eine Frage, die nach dieser Epidemie erörtert werden müsse.
Das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg hat für die kostspielige Ebola-Diagnostik nach Aussage von Institutsleiter Rolf Horstmann bislang noch keine gesonderte finanzielle Unterstützung erhalten. Experten des Instituts waren auf eine direkte Anfrage Guineas hin schon im Frühjahr nach Westafrika gereist, um beim Aufbau diagnostischer Labore zu helfen. Am Institut selbst werden seit Wochen immer häufiger auch verdächtige Proben aus noch nicht betroffenen Ländern auf das gefährliche Virus hin untersucht. Allein das Material für einen Test kostet 20 Euro. Hinzu kommen die Personalkosten, die sich selbst bei einem reduzierten Tagessatz von 100 Euro je Mitarbeiter auf mehr als 500 000 Euro belaufen - für ein Labor, das im Jahr 1000 Test durchführen kann.
Keiner der Experten vermag mehr einzuschätzen, was in den nächsten Monaten passiert
Bis November werden Schätzungen der WHO zufolge vermutlich zwanzig Mal so viele Tests nötig sein. Mit den exponentiell steigenden Fallzahlen in Westafrika wird der Bedarf auch danach weiter steigen. "Die Diagnostik spielt in den aktuellen Überlegungen bisher nur eine kleine Rolle, weil es da bislang einfach keine Probleme gegeben hat", sagt Institutsleiter Rolf Horstmann. Diagnostik sei aber essenziell dafür, die richtigen Maßnahmen einzuleiten. "Das ist Politikern glaube ich nicht ganz bewusst."
Auch der Tropenmediziner sieht den größten Bedarf derzeit allerdings beim medizinischen Personal. "Leer stehende Krankenhäuser gibt es in den Tropen häufig, aber ohne Ärzte und ausgebildete Helfer helfen auch die Betten nichts". Es sei zudem wichtig, dass diese Helfer unter allen Umständen die westlichen Hygieneregeln einhielten - und dass man ihnen eine Behandlung in Deutschland garantiere, sofern sie sich mit Ebola infizierten. Bislang existieren für solche Evakuierungen keine Protokolle. Es werde nun aber endlich mit Hochdruck daran gearbeitet, sagt Horstmann.
Wie sich die Situation in den kommenden Monaten entwickeln wird, vermag inzwischen keiner der Experten mehr wirklich einzuschätzen. Der Krisenerfahrene Virologe Christian Drosten, der vor elf Jahren maßgeblich am Kampf gegen die Pandemie des zuvor unbekannten Sars-Coronavirus beteiligt war, glaubt, dass letztlich die lokalen Strukturen über den Verlauf der Epidemie entscheiden. "Man muss die Information verbreiten", sagt der Forscher, der einen Ebola-Ausbruch selbst erlebt hat und heute an der Universitätsklinik Bonn forscht. "Und wenn man etwas für die Zukunft tun will, dann sollte man diese Kommunikation erforschen. Wie erzählen wir die Geschichte, ohne ein Verständnis des Erreger-Prinzips vorauszusetzen?" Kulturelle Hürden waren bereits zu Beginn der Epidemie als ein wesentliches Probleme im Kampf gegen Ebola benannt worden. Auch die 500 Bundeswehrsoldaten, die nun freiwillig nach Westafrika gehen, werden damit konfrontiert sein.
