Zeile um Zeile wird geschrieben, Zeichen um Zeichen gesetzt. Ein kleiner Fehler, und das gesamte Kunstwerk fällt in sich zusammen: Programmieren ist dem Schreiben von Texten nicht nur handwerklich ähnlich. Auch Schriftzeichen, die vom Computer und nicht vom Lektor gegengelesen werden, müssen sauber gesetzt und durchdacht sein. Wie in der Literatur können sie, zusammengesetzt und am Stück interpretiert, am Ende ein stimmiges Werk ergeben. Oder, und dies ist in beiden Welten weit häufiger der Fall, sie verbinden sich zu Trivialem oder Ärgerlichem: Wer mit Windows arbeitet oder schon mal in Frauenzeitschriften geblättert hat, weiß, wovon die Rede ist.
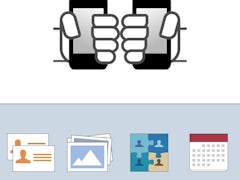
Ob Fahrplanauskunft, Fernbedienung oder Scanner: Erst die Apps machen das iPhone zum digitalen Schweizer Taschenmesser. Eine Auswahl der besten Programme
Aber in ihren allerbesten Momenten ist Software viel mehr als der Programmcode, aus dem sie besteht. Dann ist sie nämlich - und auch hier bleibt die Analogie zu einem guten Text bestehen - Auslöser für gesellschaftliche Prozesse, für politische Maßnahmen oder breite Debatten. So geschehen im Fall des kleinen Programmes iPhone-Tracker, das die beiden Programmierer Alasdair Allan und Pete Warden entwickelt haben. Der iPhone-Tracker war der Auslöser einer großen Welle der Kritik, gegen die sich Apple in den letzten Wochen behaupten musste.
Es ist eine schöne Software. Auf einer eleganten Weltkarte verzeichnet sie alle Orte, an denen ein iPhone-Besitzer in den letzten Wochen unterwegs war. Tel Aviv, Bukarest, Rom, Berlin und immer wieder zurück nach München. Mit der Veröffentlichung der Software war klar: Apple lässt Bewegungsdaten seiner Kunden speichern, nämlich in einer unverschlüsselten Datei auf dem Telefon selber und dem Computer des Besitzers, sobald dieser sein Telefon mit seinem Rechner verbindet. Diese Prozedur ist Standard, sofern man alle Funktionen des iPhones nutzen möchte.
Das eigentlich Erstaunliche an der Geschichte ist jedoch nicht die Aufzeichnung der Bewegungsdaten. Nein, erstaunlich ist eher, dass Apple über Nacht vom Heilsbringer der digitalen Welt zum Buhmann wurde. Das ist bedenklich, bedeutet es doch, dass viele, die jetzt in den Chor der Datenschützer einstimmen, sich mit den Funktionen ihrer Telefone niemals befasst haben. Eine der Standardfunktionen jedes iPhones ist zum Beispiel, sich die Bilder, die man mit dem Gerät aufnimmt (es verfügt über zwei Kameras), nach den Orten der Aufnahme sortiert auf einer Weltkarte darstellen zu lassen. Diese Funktion, die jeder Besitzer eines iPhones mehr als einmal gesehen hat, ist nahezu identisch mit dem, was der iPhone-Tracker macht.
Der Unterschied liegt, von der unverschlüsselten Speicherung der Daten in der Datei consolidated.db abgesehen, in der Wahrnehmung: Was als ortsbasierte Darstellungsform für Fotos gedacht ist, liefert eben gleichzeitig auch ein Bewegungsprofil des Nutzers. Das eine erleichtert das Leben, das andere bedroht die Privatsphäre. Der Pfad, auf dem man als Nutzer moderner Technologie zu wandeln gezwungen ist, ist schmal. Umso erstaunlicher, dass viele Menschen ihn mit einer Autobahn verwechseln.
Denn mit all den Millionen Funktionsmöglichkeiten, die ein findiger und fantasievoller Programmierer aus den Gadgets des Alltags herauszaubern kann, ganz egal ob Handy, Kamera, GPS-System im Auto oder Notebook, ist es so: Die Hardware, also das, was man anfassen und auseinanderschrauben kann, gibt die Möglichkeiten der Verwendung vor, die Software, also die Programme, die auf das Handy geladen sind, kombiniert sie möglichst sinnvoll. Nicht grundlos ist "Macht" in der Arbeit von Programmierern eine wichtige Kategorie.
Vereinfacht gesagt: Mit einem Notebook vom Aldi kann man ebenso gut Autorennen spielen wie eine Dissertation über den Einsatz ziviler Kräfte in den Beziehungen zwischen Europa und dem Nahen Osten schreiben. Oder man bricht damit in das zentrale Computersystem des US-Militärs ein und stiehlt Raketen-Codes. Entscheidend dafür sind das selbstgesteckte Ziel, technische Fähigkeiten und Fantasie. Ein richtiger Hacker versteht auch die erfolgreiche Verwendung eines Föns zum Zubereiten von Aufbackbrötchen als gelungenen Hack - es geht ausschließlich um Kreativität.
Das Problem dabei: Der durchschnittliche Nutzer kann sich nicht nur nicht vorstellen, was ein Bösewicht, ein Unternehmen, eine Regierung mit seinen Daten anstellen kann, was mit seinen Gadgets alles schief laufen kann. Wer seine Daten klauen kann, wer sie verkaufen kann, wer sie vielleicht schon seit vielen Jahren besitzt. Wer sein Leben kennt und kontrolliert. Er erfährt es erst, wenn es ihm ein Programm wie der iPhone-Tracker vor Augen führt, und auch diese wirkungsvolle Demos sind - ebenso wie die Datenschutzskandale der vergangenen Wochen von der Unesco bis zu Sony - nur kleine Ausschnitte aus dem Totaldesaster, das denkbar ist.
Die Politik kann hier nur bedingt helfen. Ein Auskunftsrecht, mit dem jeder von jedem Unternehmen erfragen kann, welche Daten gespeichert sind, gibt es längst im Bundesdatenschutzgesetz. Wünschenswert wäre auch, wenn Unternehmen die Datensätze permanent und ohne Nachfrage nicht nur offen legen müssten, sondern auch partiell oder vollständig löschbar machten. Geschähe dies nicht auf Basis eines Gesetzes, sondern als Selbstverpflichtung der Branche, könnte damit ein massiver Vertrauenszuschuss seitens der Kunden verbunden sein. Gleichzeitig könnte die Branche aufhören, ihre Erklärungen zum Datenschutz in unverständlichen Verträgen von gefühlten 300 Seiten Umfang bei Schriftgröße Neun zu verstecken.
Vor allem aber, und daran führt kein Weg vorbei, muss sich bei Nutzern und Kunden selbst etwas ändern. Es fehlt an Bildung und Sensibilisierung, und dies kann nicht durch einen an der Volkshochschule erworbenen "Computerfahrschein" geändert werden. Stattdessen muss ein grundlegendes technisches und intellektuelles Verständnis von den Geräten, die nahezu jeder Mensch täglich verwendet, geschaffen werden. Dazu gehört auch, sich mit den Grundzügen des Datenschutzes und den eigenen Rechten vertraut zu machen. Nur ein mündiger Nutzer kann sich entscheiden, welche Funktionen an seinem Computer er nutzen möchte, welche Handys er kaufen möchte, und welche Funktionen ihm zu gefährlich erscheinen. Niemand sollte sich darauf verlassen, dass die klugen Nerds im Chaos Computer Club uns alle retten.
Viele wären entsetzt, wenn sie nur ahnten, wie sich Menschen verhalten, die die Technik durchschauen. Hardcore-Datenschützer, die gleichzeitig zur digitalen Elite gehören, wie zum Beispiel die Sprecherin des Chaos Computer Clubs Constanze Kurz, telefonieren mit speziell verschlüsselten Spezialhandys, die ansonsten von Nachrichtendiensten genutzt werden. Kurz hat kein Profil bei Facebook und wechselt beim ganz normalen Surfen regelmäßig den Browser, also Programme wie Firefox, Internet Explorer oder Opera, um ihre Spuren im Netz zu verwischen.
Man kann das paranoid finden, aber ein Urteil sollte man sich erst erlauben, wenn man die Technik in der eigenen Hosentasche versteht. Dann ist es auch legitim, sich auf die andere Seite zu schlagen und die eigenen Daten bewusst und angstfrei an die Behörden und Unternehmen der Welt zu verteilen. Dann kann man sich auch für ein Handy entscheiden, das Bilder nach Ortsangaben auf Weltkarten einsortiert und bei jedem Druck auf die Menü-Taste ein Bildschirmfoto schießt. Oder man macht es wie Kurz und schickt auch Verabredungen zum Essen lieber verschlüsselt durch die Datennetze.
Doch solange viele Menschen den Hochleistungsrechner in ihrer Hosentasche für ein simples Telefon halten und digitale Systeme jeder Art, von Facebook über das Navigationsgerät im Auto bis zum Notebook auf dem Schreibtisch ohne kritische Distanz verwenden, gilt die alte Programmiererweisheit: Der Fehler sitzt in der Regel vierzig Zentimeter vor dem Bildschirm.