Auf jeder französischen Schulfassade steht dieselbe stolze Maxime "Liberté, Égalité, Fraternité". Vor den Eingangstoren der Schulen sind aber gegenwärtig Szenen wie diese zu beobachten: Aus kurz anhaltenden Autos springen Kinder auf den Gehsteig und verschwinden schnell im streng bewachten Gebäude - verschluckt und bis zum Abend behütet vor den Gefahren des Gesellschaftslebens draußen. Abgesehen von der Aussteigestelle vor dem Eingang sind die Schulgebäude oft großräumig mit Metallsperren umzäunt, ohne verabredeten Termin kommt kein Fremder hinein: So will es das landesweite Sicherheitsprotokoll nach den Pariser Terroranschlägen.
Die öffentliche Schule, mehr Utopie als Realort republikanischer Chancengleichheit, bleibt in der Krise der wichtigste Rückhalt, an den die Staatsbürgergemeinschaft sich reflexhaft klammert. Aufgrund ihres Prinzips laizistischer Neutralität will sie von religiösen, kulturellen oder sonstigen Herkunftsunterschieden nichts wissen und lässt gemäß dem Gesetz aus dem Jahr 2004 muslimische Mädchen gleich am Eingang das Kopftuch abnehmen. Für den Heimweg dürfen sie es dann wieder aufsetzen. Konfliktbewältigung durch formale Gleichstellung.
Ab sofort sollen die öffentlichen französischen Schulen noch mehr leisten, als einfach die angehenden Staatsbürger vor ihren eigenen Zugehörigkeitsforderungen zu schützen. Sie sollen Brutstätte für einen neuen Gemeinschaftssinn werden. Ein riesiges Mobilisierungsprogramm für die "Werte der Republik" ist von Erziehungsministerin Najat Vallaud-Belkacem nach den jüngsten Terrorakten lanciert worden. Bis zum April sollen tausend Freiwillige ausgebildet werden, um die 300 000 betroffenen Lehrer quer durchs Land auf die Vermittlung der Grundregeln republikanischen Zusammenlebens vorzubereiten. Eine "Woche der Erziehung gegen Rassismus und Antisemitismus" ist überdies an den Schulen für Mitte März angesagt und der 9. Dezember, das Datum des Gesetztes von 1905 zur Trennung von Kirche und Staat, soll fortan für die Schüler ein Gedenktag sein.

Irgendwie nicht sexy, außerdem ernst und schwierig: Das schlechte Image ist nur einer der Gründe, wieso die Lust an der französischen Sprache bei Deutschlands Schülern stetig nachlässt.
So lädt Frankreich seiner Éducation Nationale, diesem Pracht- und Frachtschiff des europäischen Bildungsideals, immer mehr auf. Das theoretisch weltweit beste Schulsystem, das seit Beginn der Dritten Republik tatsächlich manche Talente aus den hintersten Ecken des Landes in die Pariser Eliteschulen holte, ächzt heute unter der Last seiner Aufgaben und produziert oft das Gegenteil dessen, was beabsichtigt ist: eine "Noblesse d'État" einerseits, wie Pierre Bourdieu es nannte, und auf der anderen Seite immer mehr Orte, die statt Lern- nur noch Bändigungsanstalten für Schwererziehbare sind mit jungen unerfahrenen Lehrern, die schnellstmöglich wieder wegwollen oder an der Aufgabe zerbrechen. Die alte Verheißung, dass Berufserfolg mit Bildung und Ausbildung zusammengeht, gilt dort nicht mehr.
Neben den alljährlich 150 000 Schulabbrechern marschieren auch immer mehr Jugendliche mit ordentlichem Schulabschluss direkt in die Arbeitslosigkeit. Die Schule soll immer mehr migrationspolitische, wirtschaftliche und städtebauliche Fehlentwicklungen kompensieren, will aber gleichzeitig vom hohen Bildungsanspruch nicht lassen. Das Ideal soll ihr, so hofft sie hartnäckig, aus der Krise helfen. "Wir Lehrer sind die Musiker auf der Titanic, die bis zuletzt tapfer weiterspielen", schimpfte unlängst ein Gymnasiallehrer aus der Pariser Vorstadt Savigny-sur-Orge in einem Zeitungsinterview.
Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass momentan das gesamte französische Schulsystem infrage gestellt wird. Die Volksschule sei am Ende, schreiben unumwunden der Historiker François Durpaire und die Soziologin Béatrice Mabilon-Bonfils in ihrem Buch "La fin de l'école": Von den Lernprogrammen und Lehrmethoden bis zur Sitzordnung in den Klassenräumen müsse alles von Grund auf neu überdacht werden. Das Lesen und Schreiben werde von den "Digital Natives" nicht mehr auf der Schulbank gelernt, deren Kultur habe mit hierarchisiertem Wissen nichts zu tun und deren Gemeinschaftssinn entstehe statt über den altväterlichen Generationenvertrag des Weitergebens über die spontanen Emotionsaufwallungen unter Gleichgesinnten und Freunden.
Frech blicken die beiden Autoren auch über den Atlantik aufs dortige Gegenmodell zur Éducation Nationale und zitieren eine Prognose der amerikanischen Forschungsagentur "Education Futures": 2015, so heißt es dort, werde mit dem "Manhattan Project" das klassische Lehrer-Schüler-Verhältnis gesprengt und 2020 den Kindern der neuen "Knowmads"-Gesellschaft vom Schulbesuch abgeraten. 2023 würden dann im Staat New York vier Fünftel der Schulen geschlossen, 2030 werde der ungleiche Zugang armer und reicher Länder zu den neuen Lerntechnologien als akutes Problem in Erscheinung treten und 2032 würden die letzten Lehrer in den Ruhestand gehen. Sollten unsere bestehenden Bildungsanstalten diese Entwicklung verschlafen, so warnen die französischen Autoren, dann würde der Markt in der Bildungspolitik dem Staat das Heft aus der Hand nehmen, wie dieser es einst der Kirche abgenommen habe.
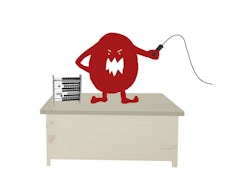
Durch deutsche Schulen geistern nicht nur hochmotivierte Fachkräfte, sondern auch viele anstrengende Lehrer-Typen. Autor Malte Pieper hat die zehn häufigsten ausgemacht.
Dieses Szenario mag reichlich spekulativ anmuten. Fakt ist, dass die Schule ihrem eigenen Anspruch, zugleich Wissensvermittlung, Berufsvorbereitung und Stiftung von Gemeinschaftssinn zu liefern und nebenbei noch kritisches Denken zu lehren, nicht mehr gerecht wird. Mit seinem Leistungs- und Elitekult hat das französische Bildungssystem auf der einen Seite jenes Modell mitgeprägt, das in manchen, vornehmlich ostasiatischen Ländern den schulischen Leistungsdruck auf die Spitze treibt. Auf der anderen Seite wird in den Problemvierteln, wo die Lernziele längst hinter dem Ziel der Bevölkerungsintegration zurückgetreten sind, genau diese Integration fast unmöglich gemacht, weil keine Inhalte mehr da sind, auf die sie sich stützen kann. Das ist unlängst deutlich geworden, als nach den Pariser Attentaten gegen Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt an allen Schulen eine Schweigeminute verordnet wurde.
Viele Lehrer standen der Weigerung ihrer Schüler, für die ermordeten Charlie-Zeichner still zu halten, ratlos gegenüber. "Bei jeder neuen Krise sind wir Lehrer allein in der ersten Reihe", konstatiert bitter Monique Gruneisen, die in einem Gymnasium der Pariser Vorstadt Antony Geschichte unterrichtet. Sie hatte in ihrer Klasse während der Schweigeminute zwar keine Probleme, musste ihren Schülerinnen nordafrikanischer Herkunft aber doch Rede und Antwort stehen, warum solche Gedenkminuten und Staatstrauertage nicht auch bei anderen Vorfällen stattfinden. Besser als eine Minute Schweigen wären drei Stunden Diskussion unter den Lehrern über konkrete Verbesserungen des Klimas gewesen, kommentiert trocken der Wirtschaftslehrer Philippe Watrelot aus einem anderen Vorstadtgymnasium.
So viel den Lehrern am Prinzip der "Égalité" liegt, so bereitwillig geben sie heute die wachsende reale Chancenungleichheit zu. Die Schüler aus den Problemvierteln mit zu großen Klassen seien dazu übergegangen, nicht mehr passiv als Opfer, sondern als freiwillige Akteure ihres Versagens aufzutreten: Das sei weniger demütigend gegenüber einer Gesellschaft, die sie schon abgeschrieben habe - sagt die Pariser Französischlehrerin Sophie Audoubert. Die Schwierigkeiten kommen aber auch aus dem System selbst durch die ständigen Lehrplanwechsel. Aus dem Geschichtsstoff "Mittelmeerraum im 12. Jahrhundert" sei für die Gymnasialstufe drei Jahre vor dem Abitur das Thema "Christliches Mittelalter" geworden, erklärt Monique Gruneisen - was bei den Schülern zwangsläufig die beleidigte Frage nach sich ziehe: Und wo bleibt der Islam? Die Schule der Republik darf darauf nur sachlich-historische Antworten geben. Für das fürs nächste Jahr angekündigte neue Unterrichtsfach "Moral und Staatsbürgerkunde" sind das nicht die besten Voraussetzungen.
