Es kam der Moment, in dem sich die Fassungslosigkeit mit einem Hauch Bewunderung mischte. Was für eine Chuzpe diese Chinesen doch hatten! Während Forscher aller westlichen Nationen noch über den Umgang mit der neuen, revolutionären Gentechnologie Crispr-Cas diskutierten, Warnungen in hochrangigen Journalen veröffentlichten und einen ethischen Rahmen für mögliche Anwendungen auszuloten versuchten, schafften chinesische Wissenschaftler Fakten. Mithilfe der erst drei Jahre alten Technologie manipulierten sie erstmals gezielt das Erbgut von menschlichen Embryonen. Technisch gesehen war es der erste Versuch zum direkten Eingriff in die Evolution des Menschen. Im Westen hätte sich das niemand so einfach getraut.
Chinas Wissenschaft hat mittlerweile viele solcher Momente zu bieten. Augenblicke, die einem den Atem rauben und dabei vielen westlichen Vorstellungen von Moral widersprechen. Das Land ist führend, wenn es um die Zahl von Affenversuchen geht. Auf dem Feld der Supercomputer, des Maschinenlernens und der künstlichen Intelligenz sind die Chinesen so weit, dass Maschinen Menschen am Gang erkennen können. 2017 wurde an der University of Science and Technology of China in Hefei das National Lab for Artificial Intelligence Technology gegründet. Das Topjournal Nature kürte den Leiter des chinesischen National Space Science Center, Wu Ji, zu einem der zehn wichtigsten Wissenschaftler 2016. In Shenzhen, einer Stadt nördlich von Hong Kong, befindet sich der Sitz der führenden Genomikfirma der Welt, des einst als Bejing Genomics Institute gegründeten Unternehmens BGI. Und wo ist der international größte Konzern für kommerzielle Drohnen zu Hause? DJI hat seine Zentrale in Shenzhen.
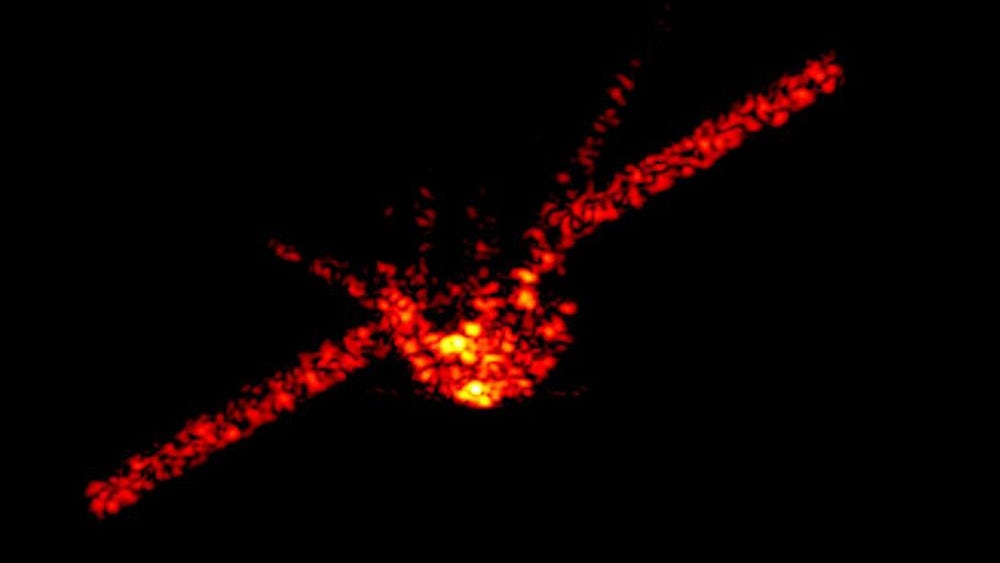
Und das alles ist nur die Spitze des technologischen Eisberges im bevölkerungsreichsten Land der Erde. Einer der Gründe für den Erfolg ist dabei sicher kulturell bedingt: Die Chinesen gelten als wissenschaftsaffin, als eifrig und leistungswillig. Zwölf-Stunden-Werktage sind so normal wie der Arbeitseinsatz am Wochenende. In Shenzhen werden vier Prozent des Bruttoinlandprodukts in Forschung investiert. Und schließlich ist die aufstrebende Elite des Landes im internationalen Vergleich sehr jung, viele studieren im Ausland. Später kehren sie oft in ihre Heimat zurück. Neben guten finanziellen Voraussetzungen finden Forscher dort ein politisches Klima vor, das ihnen zwar nicht zwingend das Leben, wohl aber die Arbeit, erleichtert. "Wir werden die Grundlagenforschung in den angewandten Wissenschaften stärken, große nationale Wissenschafts- und Technologieprojekte starten und Innovation in Schlüsseltechnologien, modernem Ingenieurwesen und disruptiven Technologien priorisieren", sagte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping im vergangenen Oktober auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas. Als Erfolg wertet es Xincheng Xie, Vizepräsident der National Natural Science Foundation of China, dass zunehmend Forscher nach China kommen. Sein Appell in Lindau: "Bitte gebt China eine Chance, wenn Ihr auf der Suche nach einer Forschungsstelle seid."
Das heißt jedoch nicht, dass der chinesische Weg keine Kritiker hätte, auch auf der eigenen Seite. So wechselte eine der frenetisch gefeierten Heimkehrerinnen, die Molekularbiologin Yan Ning, im vergangenen Jahr an die Universität in Princeton und entfachte damit eine nationale Debatte über die tatsächlichen Umstände eines Forscherlebens in China. Medienberichten zufolge wollen fast 70 Prozent derjenigen, die im Ausland studiert haben und nach China zurückgekehrt sind, das Land wieder verlassen - wegen der extremen Umweltverschmutzung, aber auch wegen des Bildungsangebots für Kinder, der Lage auf dem Wohnungsmarkt und der geringen Löhne.
Und dann gibt es in vielen Bereichen auch Kritik an der Forschung selbst. Die Studie zur genetischen Veränderung von Embryonen zum Beispiel löste zwar ein Raunen in der internationalen Forschungsszene aus. Bei näherer Betrachtung jedoch erwies sie sich jedoch als fachlich mangelhaft. Beobachter sagen, die Qualität der Forschung stehe zumindest in den Lebenswissenschaften nicht im Verhältnis zum personellen und materiellen Aufwand. Ob das so bleiben wird, ist womöglich nur eine Frage der Zeit. Zeit, die auch dafür genutzt werden könnte, einen ethischen Konsens mit den Chinesen zu suchen.