Sollte die Schlacht auf dem Feld der Meinungsmacher entschieden werden, dann sind die schwersten Geschütze inzwischen aufgefahren. Konkurrenten bekennen öffentlichkeitswirksam ihre Angst, Minister deuten die Möglichkeit der Zerschlagung an, EU-Beamte versprechen baldige "Disziplinierung". Und doch scheint der Kampf gegen Google nicht weiter voranzukommen. Vielleicht geht der Angriff, der die absolute Monopolstellung des Internet-Riesen schwächen soll, nicht ganz in die richtige Richtung.
Die historisch einmalige Vormachtstellung eines einzigen Anbieters - in Deutschland laufen 94 Prozent aller Suchanfragen bei Desktop-Rechnern über Google, bei Mobilgeräten gar 98 Prozent - kann niemand wünschen oder befürworten. So viel ist unbestritten. Wie genau man dagegen vorgehen will, das verschwimmt in den meisten Debattenbeiträgen aber sofort. Alle nur denkbaren Bedrohungsszenarien werden beschworen, die teilweise weit in der Zukunft liegen - bis hin zur künftigen Unterwanderung aller Haushaltsgeräte. Die Vorstellung, was eine politische Regulierung dagegen tun kann, muss notgedrungen diffus bleiben.
Hier soll es dagegen um eine klare Fokussierung gehen - auf das aktuelle Geschäftsgebaren des Konzerns, und zwar ganz aus der Sicht des Endkunden. Was unter anderem auch zu dem Verfahren geführt hat, über das derzeit das Wettbewerbskommissariat der Europäischen Gemeinschaft zu entscheiden hat. Der Vorwurf lautet, vereinfacht gesagt: Google manipuliert seine Suche zum Nachteil jedes Nutzers, der irgendein Produkt kaufen möchte und dabei gern den besten Anbieter finden würde.
Neben Google-Konkurrenten und EU-Beamten betrifft das nun wirklich alle, deshalb muss man es vielleicht noch einmal aufrüttelnder formulieren: Wenn du im Internet günstig etwas kaufen willst, ist Google seit bald zwei Jahren nicht mehr dein Freund, sondern dein Feind. Dies in einer Deutlichkeit zu kommunizieren, die wirklich bei jedem Internetnutzer ankommt, wäre aktuell der erste Schritt. Aber gerade das passiert nicht, oder nicht genug.
Das beste und günstigste Angebot? Nicht so wichtig
Der Grund ist nicht, dass Googles Praktiken nicht ausreichend dokumentiert oder kritisiert worden wären - seit den Änderungen des Geschäftsmodells in den Jahren 2012 und 2013 gibt sich da niemand mehr Illusionen hin. Wer mit seinem Produkt und seinem Preis bei Google ganz oben oder gut platziert am rechten Rand stehen will, muss seit Langem eine Textanzeige bezahlen.

Tausende Europäer wollen Informationen über sich aus der Google-Suche entfernen. Doch übereilte Löschanträge könnten sich noch rächen. Google erwägt, auf Seiten mit gelöschten Links Warnhinweise anzubringen.
Bezahlen muss seit Neuestem aber auch, wer - womöglich sogar prominent und mit Bild - in der Mitte bei den Ergebnissen von Google Shopping auftauchen will. Dieses Geschäft ist Google wichtig. Weniger wichtig scheint es dem Konzern zu sein, wirklich das beste und günstigste Angebot herauszustellen. Oft genug findet man es nicht einmal auf der ersten Seite der Suchergebnisse, sondern viel weiter hinten. Oder gar nicht.
Nun könnte man trocken feststellen, dass Google ein kommerzielles Unternehmen ist, dass seine Milliarden eben genau mit bezahlten Anzeigen verdient. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Groß geworden ist die Firma schließlich mit dem gegenteiligen Versprechen: jene Ergebnisse im Ranking nach oben zu stellen, die dem Suchenden den größten Nutzen bringen. In einer Zeit, als alle anderen Suchmaschinen noch eine Flut von nutzlosen Treffern angezeigt haben, konnte Google dieses Versprechen einlösen. Der beispiellose Aufstieg der Firma und ihre aktuelle Marktmacht - all das hängt mit dem Vertrauen zusammen, das mit der Erfüllung dieses Versprechens erworben wurde.
Und deshalb denken all die Google-Gegner, die nun im Staat und seinen Eingriffsmöglichkeiten die letzte Chance sehen, vielleicht zu apokalyptisch und fatalistisch. Vertrauen ist nämlich ein flüchtiges Gut. So mühsam man es erwerben muss, so leicht kann man es auch wieder verspielen. Die nächste Suchmaschine, das ist das Schöne am Netz, ist ja tatsächlich nur einen Mausklick entfernt. Wichtiger und erfolgsversprechender als Jammern und Wehklagen wäre es also, Googles gebrochenes Versprechen herauszustellen - und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.
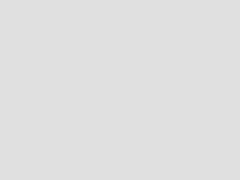
Meinung
Am Geschäftsmodell der Internetkonzerne hat sich den Snowden-Enthüllungen zum Trotz nichts geändert. Allerdings haben die Nutzer ihre Privatsphäre selbst in der Hand. Aber sind sie bereit, dafür auch Geld zu bezahlen?
Medienangebote, die Nützlichkeit verheißen, ihrem Geschäftsmodell nach aber von Anzeigen leben, sind ja wirklich kein neues Problem. Man kennt das Spiel, allerdings ohne die Monopolsituation, aus dem Printjournalismus. Dort wird es ebenfalls besonders heikel, wenn es um Shopping geht. Mode- oder Technikmagazine beispielsweise treten ja auch mit dem Versprechen an, ihre Leser bestmöglich zu informieren - und geraten regelmäßig in den Verdacht, diese Mission zu verraten, sobald Anzeigenkunden ihnen genügend Geld dafür bieten. Irgendwann bemerken die Leser die Manipulation und verlieren das Vertrauen - und wenn das erst einmal weg ist, kann man es kaum noch zurückgewinnen.
Wahre Nützlichkeit und bestmögliche Informationen, durch Anzeigen finanziert - gerade am Beispiel des Printjournalismus kann man sehen, dass dieses Geschäftsmodell zwar nicht grundsätzlich fragwürdig sein muss, aber auf sehr fragilen Grundlagen beruht. Und so titanisch und unbesiegbar Google im Moment erscheinen mag - ein Windhauch des Misstrauens, der zum Sturm wird, könnte seine Basis schwer erschüttern. Oder aber ein besseres, weil nützlicheres und glaubwürdigeres Angebot.
Bing-Manager machen zu viel nach
In diesem Zusammenhang wirkt es äußerst merkwürdig, dass Microsofts Bing, die nächstgrößere Suchmaschine nach Google, sich nicht stärker von ihrem Konkurrenten absetzt. Bing lässt sich ebenfalls längst für seine Shopping-Ergebnisse bezahlen - zumindest in den USA, und bald wohl auch in Europa. Die Bing-Manager machen Google in dieser Hinsicht alles nach. Das wirkt kurzsichtig, eine vertane Gelegenheit, den übermächtigen Gegner unter Druck zu setzen. Aber es verwundert auch nicht.
Das eigentliche Gegenmodell folgt nämlich einem radikaleren Prinzip. Es bietet Nützlichkeit und bestmögliche Information - aber ohne die Finanzierung durch Anzeigen, auf der Grundlage einer reinen Non-Profit-Philosophie. Wikipedia hat das für den Bereich der Lexika vorgemacht - aus dem Gefühl heraus, dass der Wissensschatz der Menschheit nicht in Verdacht geraten darf, durch kommerzielle Interessen manipulierbar zu sein. Trotz aller Probleme im Detail hat sich diese Idee umfassend durchgesetzt, auch weil sie in ihrer simplen, nichtkommerziellen Klarheit ziemlich unangreifbar ist.
Eine Art Wikipedia für Produkte
Nun kann man das Wikipedia-Prinzip nicht einfach auf den Bereich der Suchmaschinen übertragen, diese Vorstellung wäre naiv. Microsoft gab voriges Jahr zum Beispiel bekannt, dass es mit seinen Webangeboten, vor allem mit Bing, seit 2005 fast elf Milliarden Dollar verloren hat - bei dem nicht sehr erfolgreichen Versuch, halbwegs mit Google mitzuhalten. Umfassende Suchmaschinen verschlingen Geld, das niemand durch Spenden eintreiben kann, die technologischen Hürden sind enorm, und die Nutzerdaten, die Google inzwischen von uns allen gewonnen hat, bedeuten einen weiteren, schwer einholbaren Vorsprung.
Interessant wäre allerdings die Vorstellung von ein paar selbstlosen jungen Internet-Cracks, die eines Tages den Plan fassen, Google in einem einzigen schmalen Bereich anzugreifen - und zwar ausgerechnet dort, wo es am meisten wehtut. Das Prinzip ergibt sich aus den vorangegangen Überlegungen von selbst. Auf den ersten Blick klingt es absurd, auf den zweiten stellt es die Logik des Kapitalismus wunderbar auf den Kopf: ein reines Non-Profit-Shoppingportal - eine Art Wikipedia für Produkte.
Wahrscheinlich wird daran längst irgendwo gearbeitet, denn die Hürden sind sogar niedriger als bei Wikipedia selbst. Verlässliche und standardisierte Datenbanken, in die alle Hersteller dieser Erde ihre Produkte eintragen, gibt es längst. Und ein Interface, über das jeder halbwegs vertrauenswürdige Onlinehändler seinen besten aktuellen Preis mit diesen Daten verknüpfen kann, ohne dafür zu bezahlen - dafür braucht der richtige Programmierer vielleicht einen halben Nachmittag.

SZ Jetzt
"Google ist viel schlimmer", "Die sammeln ja nur Metadaten" oder "Wir müssen uns vor Terror schützen": Unser Autor hat zehn Argumente derjenigen auf sich wirken lassen, die Überwachung gar nicht so schlimm finden.
Wohlgemerkt würde bei diesem Service nichts verkauft, es ginge nicht einmal um Produktempfehlungen - zentral wäre die faktische Information, der Charakter einer unbestechlichen Liste von Anbietern. Eine Preisvergleichsmaschine, aber eben ohne eigenes kommerzielles Interesse. Sobald sich dieser freie und unmanipulierte Service und die Philosophie dahinter herumgesprochen hätten, würde die Preissuche im Internet hier beginnen - und enden.
Noch interessanter wäre dann nur die Frage, was Google dagegen tun könnte. Verschweigen, unterdrücken, ausklammern? Der Widerstand aller kommerziellen Suchmaschinen wäre wahrscheinlich enorm, weil so ein kostenloser Service geradezu lebensbedrohlich ist, wenn man sein Geld mit Anzeigen und bezahlten Klicks verdient. Aber das Internet wäre nicht das Internet, wenn sich eine derartige Killerapplikation nicht auch gegen alle Hindernisse um die ganze Welt verbreiten würde.
Das bessere Prinzip, das nützlichere Angebot, das klarere Versprechen schlägt im Web am Ende doch alles andere. Durch dieses Gesetz ist Google zum Giganten aufgestiegen, durch dieses Gesetz kann Google auch wieder an Macht verlieren. Man müsste es nur besser nutzen. Und wenn die Politik dabei mithelfen will, ist sie sicherlich herzlich eingeladen.
