Die Explorationsschiffe sind auf dem Rückweg. Die Noble Discoverer hat dieser Tage abgedreht, ebenso die Polar Pioneer. Vor der Küste Alaskas haben sie nichts mehr zu suchen.
Was den Klimaschutz angeht, ist das seit Monaten die erste gute Nachricht von der Ölindustrie. Ende September gab Shell die Pläne für das Burger-J-Feld in der Arktis auf. Zu klein seien die Mengen, zu hoch die Kosten und zu gering der Erlös. Denn seit der Ölpreis in den Keller gefallen ist, lohnen sich aufwendige Tiefseebohrungen immer weniger, noch dazu in so unwirtlichen Gegenden wie der Arktis. Ein fallender Ölpreis ist für die Umwelt ein Vorteil.
Jahrzehntelang galt knappes, teures Erdöl als gutes Argument für den Klimaschutz. Wer sparsamer mit Energie umgehe, so argumentierte auch die deutsche Bundeskanzlerin, tue nicht nur Gutes im Kampf gegen die Erderwärmung, sondern wappne sich auch für die kommenden Zeiten knappen Öls. Doch wenn an diesem Montag in Bonn abermals die Delegierten zusammenkommen, um eine Woche lang die wichtige Klimakonferenz in Paris vorzubereiten, werden sie auf dieses Argument verzichten müssen. Als die Staaten 2009 die - letztlich gescheiterte - Konferenz von Kopenhagen vorbereiteten, standen sie unter dem Eindruck eines Rekordhochs von 148 Dollar pro Barrel. Vor der Konferenz in Paris liegt der Ölpreis nun um die 50 Dollar. In weniger als einem Jahr fiel er damit um 40 Prozent.

Schon fürchten Klimaschützer, der niedrige Ölpreis könnte Anstrengungen für mehr Energieeffizienz zunichtemachen. "Der niedrige Ölpreis kann uns um Jahre zurückwerfen", sagt Martin Kaiser, der für Greenpeace die internationalen Klimaverhandlungen verfolgt. "Er nimmt nötigen Druck von der Pariser Konferenz."
In Deutschland geht der Verbrauch auch bei fallenden Preisen zurück
Allerdings sind die konkreten Folgen bisher höchst unterschiedlich. Als die US-Energiebehörde EIA unlängst den Zusammenhang zwischen Ölpreis- und Verbrauch maß, war das Ergebnis klar: Je billiger der Sprit, desto mehr wird getankt. In Deutschland allerdings ist die Entwicklung anders. Der Mineralölabsatz geht zurück, auch in Zeiten günstigen Öls. Seit dem "Allzeithoch" von 1999 sei der Benzin- und Dieselabsatz stetig zurückgegangen, heißt es bei der Mineralölwirtschaft - von damals 59 auf zuletzt 55 Millionen Tonnen. Bei Heizöl sehe das ähnlich aus.
Der Hauptgrund: effizientere Fahrzeuge. Andererseits registriert das Kraftfahrt-Bundesamt seit einiger Zeit einen Anstieg bei der Zulassung durstiger Fahrzeuge: Jedes fünfte neue Auto war im September ein SUV oder ein Geländewagen, mit steigender Tendenz. In der Kalkulation über ein neues Auto fällt die Spritrechnung immer weniger ins Gewicht. Die saubere Alternative, das Elektroauto, dagegen wird weniger attraktiv. Selbst in der Chemieindustrie, so erwartet das Umweltbundesamt, könnten neue Ersatzstoffe nun länger auf sich warten lassen.

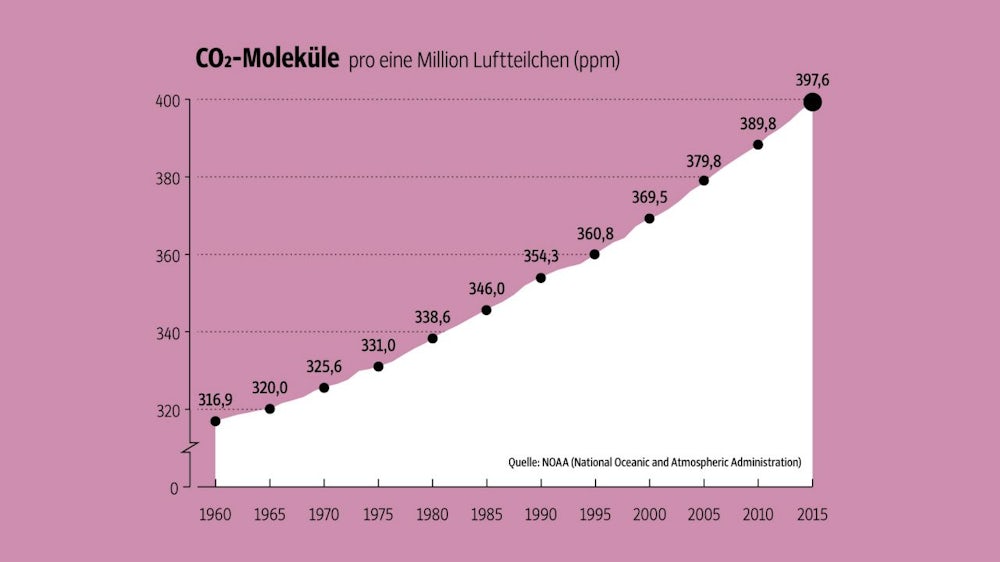
Ähnlich könnte es bei der Sanierung von Gebäuden sein, denn neue Fenster und Heizungen rentieren sich schneller, wenn Heizöl oder Gas teuer sind. Doch zumindest die staatseigene Förderbank KfW gibt Entwarnung: Es wird dennoch saniert. Zwar gebe es einen leichten Rückgang. Den aber sehe man "nicht als einen Einbruch, der vielleicht angesichts der Ölpreisentwicklung zu erwarten gewesen wäre", heißt es bei der Frankfurter Bank.
Das hilft dem Klima aber noch nicht genug. Soll die Pariser Klimakonferenz im Dezember ein Erfolg werden, müssen die Staaten noch mehr im Kampf gegen den Klimawandel unternehmen. Die Folge wären strengere nationale Umweltauflagen. Sie erzwängen etwa sparsamere Autos und besser gedämmte Häuser. Doch Ökonomen meinen, das führe zu noch weiter fallenden Ölpreisen. Solche Auflagen kämen einer "angekündigten Marktvernichtung" gleich, argumentiert etwa der Chef des Münchner Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn. "Die Anbieter weichen ihr durch ein Vorziehen der Verkäufe aus, was die heutigen Preise wie bei einem Schlussverkauf purzeln lässt." Die Folge könnte eine höhere Nachfrage nach fossilen Energien sein. In einem Buch nannte Sinn das vor Jahren mal das "grüne Paradoxon". Nur viel verdienen ließe sich mit dem Öl nicht mehr.
Doch die Ölkonzerne kommen längst auch von anderer Stelle unter Druck: von den Finanzmärkten. Ende September, just einen Tag nachdem Shell sich aus der Arktis zurückzog, trat in London Mark Carney ans Rednerpult, der Gouverneur der Bank of England. Sein Thema: der Klimawandel und die Stabilität der Finanzmärkte. Nehme man die Berechnungen des Weltklimarats IPCC ernst, dürfte höchstens ein Drittel der globalen Reserven an Öl, Gas und Kohle je gefördert werden, rechnete er vor. "Wenn diese Schätzung auch nur annähernd richtig ist, erweist sich der weit größte Teil der Reserven als buchstäblich unverbrennbar", sagte Carney. Kurzum: Die Konzerne sitzen auf Reichtümern, die sie nie werden fördern dürfen. Je später und abrupter Anleger darauf reagierten, so warnte Carney, desto mehr bedrohe das die Stabilität der Märkte. Die Ölriesen werden zum Finanzrisiko. Das ist neu.
Eine neue Bewegung ist schon im Gang, sie nennt sich englisch "divestment". Vor allem Pensionsfonds haben nach Schätzungen schon 2,6 Billionen Dollar aus fossilen Energien abgezogen, stießen ihre Aktien ab. Derweil versuchen die Ölkonzerne, den Widerspruch zwischen ihrem Geschäftsmodell und dem Klimaschutz aufzulösen. Vorigen Freitag traten sie in Paris vor die Presse, um öffentlichkeitswirksam dem globalen Kampf gegen die Erderwärmung beizutreten, darunter Multis wie BP, Shell, Total, Statoil und die saudische Saudi Aramco. Jede Branche müsse sich am Kampf gegen die Erderwärmung beteiligen, erklärten sie, so auch sie selbst. Künftig wollten sie darauf achten, ihr Erdöl effizienter zu fördern. Über die Menge sagten sie nichts.