Klein stoppt im Halteverbot, Warnblinker an. "Hilft manchmal", sagt er und hetzt in den vierten Stock. Er reißt die Bürotür auf und stürmt zum Schreibtisch. Nervös ruckelt er mit der Maus, acht Bildschirme leuchten auf. Klein starrt auf Tabellen und fallende Kurven, hektisch tippt er ein paar Zahlen in die offenen Felder. Stille. "Oh, Mann." Das war's, nicht einmal zwei Millisekunden hat die Software zum Handeln gebraucht. Klein kann wieder entspannen.
Wenn er, einsneunzig groß, die braunen Haare gegelt, auf einer Party gefragt wird, was er beruflich macht, antwortet Klein irgendwas mit "Schuhgeschäft". Er zeigt dann seine cognacfarbenen Lederslipper und spricht vom bodenständigen Handwerk. Gelogen ist das nicht, Klein lässt Slipper für Herren designen und Sneaker für Frauen. Jedes halbe Jahr neue Styles.
Sich kreativ auszutoben, das sei es, was ihn an der Branche fasziniere. Die ganze Wahrheit ist die Sache mit dem Schuhgeschäft aber auch nicht, denn das große Geld verdient der gebürtige Chemnitzer mit etwas anderem. Und diese Arbeit ist für Laien kaum greifbar. Seit zwanzig Jahren ist Klein Hochfrequenzhändler. Seinen Job - einer der schnellsten der Welt - muss er fast immer erklären.
Hochfrequenzhändler, das sind dem Ruf nach die Bösen an der Börse, die Zocker und Gewissenlosen. Sie kaufen zum Beispiel eine Aktie für 13,00 Euro und stoßen sie für 13,02 Euro wieder ab. Dabei verdienen sie nur auf den ersten Blick Centbeträge, denn ihre Hochleistungsrechner handeln massenhaft. Und sie handeln verdammt schnell. Es ist ein Pokerspiel um Sekundenbruchteile, nicht immer geht es gut. Hochfrequenzhändler werden verantwortlich gemacht für Börsencrashs, bei denen Leitindizes schon mal um tausend Punkte fallen und die Aktien von Firmen Millionen an Wert verlieren.
"Ich war zu langsam", sagt Klein. Sein Verdienst: nur 2500 Euro
Vor ein paar Jahren befragte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Hunderte Finanzmarktexperten zur Sicherheit des Hochfrequenzhandels. Ein Drittel gab an, dass der computergesteuerte Handel die Stabilität der Finanzmärkte bedrohe. Erst im April nahm die Polizei einen 36 Jahre alten Mann in einem Londoner Vorort fest: Navinder Singh Sarao soll 2010 von seinem Elternhaus aus den "Flash Crash" an der New Yorker Börse mitverursacht haben. Für ein paar Stunden verloren die Aktien Hunderte Milliarden Dollar an Wert. Den Speed der Maschinen und die Komplexität der Algorithmen, so die Kritiker, könne kaum mehr jemandnachvollziehen. Geschweige denn kontrollieren.
Der nächste Crash sei programmiert. Früher, also im Zeitalter des Normalfrequenzhandels, flitzten Börsenhändler über ein echtes Parkett, der Kauf eines Wertpapiers dauerte Minuten. Heute jagen programmierte Befehle von einem Hochleistungsrechner zum nächsten, schneller als ein Wimpernschlag. Es sind Softwareprogramme, die sich gegenseitig ausspielen und den Preis verändern. Mittlerweile sollen fast 40 Prozent des europäischen Aktienhandels über Hochfrequenzhandel laufen, Tendenz steigend. In den USA sind es bereits deutlich mehr. Das Treiben der neuen Händler, sagen Kritiker, gehe auf Kosten der Kleinanleger. Die können mit dem Tempo nicht mithalten.
Klein wiederum kann mit dieser Angst nichts anfangen. Ist seine Art zu handeln zu schnell, die Software nicht mehr kontrollierbar? "Das mit dem Tempo ist eine ganz natürliche Entwicklung", sagt er ruhig. "Wir kämen auch nie auf die Idee, noch Postkutsche zu fahren."

Es ist eine sehr eigene Welt, in der dieser Mann lebt. Sein Büro in Zürich gleicht einer Kommandozentrale: eine Wand aus acht Monitoren, davor zwei Smartphones, zwei Festnetztelefone, drei Tastaturen. Falls mal was ausfällt. Tempo und Sicherheit gehen selten zusammen. Klein probiert es trotzdem. Er beugt sich vor, kaut an den Fingerspitzen, fixiert den Bildschirm unten rechts. Die Beträge der Wertpapiere steigen in Sekundenbruchteilen hinter dem Komma, 24, 25, 26. Die Felder blinken erst rot, dann grün. "Ich war zu langsam", sagt Klein. Sein Plus nach diesem Handel? 2500 Euro. Läppisch. An guten Tagen verdient er 60 000 Euro, an schlechten verliert er ein paar Tausend. Etwa zehn Prozent der Fonds, die er verwaltet, gehören ihm selbst.
Im Grunde wartet ein Händler wie Klein jeden Tag darauf, dass eine Katastrophe passiert, oder wenigstens eine Überraschung. Er hat sich auf den Handel mit Nachrichten spezialisiert, mehrmals am Tag wertet seine Software Meldungen von Bloomberg und Reuters aus. Um 8.30 Uhr sind die Arbeitsmarktzahlen dran, um 10 Uhr folgt der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo Instituts, um 15 Uhr die russische Inflationsrate. Klein macht Gewinn, wenn sich solche Daten anders entwickeln, als Volkswirte es erwartet haben. Dann bewegt sich der Markt, und wer zuerst darauf reagiert, verdient.

Ein Beispiel. An diesem Tag hat der Nachrichtendienst Bloomberg die Lagerbestände an Rohöl in den USA gemeldet. Ein Minus von 1,5 Millionen Barrel hatten Experten vorhergesagt, "-6,812 Millionen" steht jetzt auf dem Monitor. Eine klare Abweichung, gut für Klein. Seine Software hat für die Berechnung 1,5 Millisekunden benötigt. Sinn oder Unsinn einer Nachricht, erklärt er, seien irrelevant für den Markt. Die Wirtschaftsteile der Zeitungen wälzen, den Economist lesen - das müsse gar nicht mehr sein. "Wenn Reuters eine falsche Nachricht raushaut, reagieren alle auf diese falsche Nachricht. Dann kann ich trotzdem Gewinn machen."
Kleins Weg zur eigenen Kommandozentrale fängt bescheiden an. Er studiert BWL an der Fachhochschule in Mittweida, einem Kaff in Sachsen in der Nähe von Chemnitz. In Frankfurt am Main besteht er 1995 die Prüfung zum Börsenhändler, da ist er 21 Jahre alt. Wenn er heute über diese Zeit spricht, erzählt er von zig Praktika bei Banken, von kleinen Aufgaben, die mit der Zeit größer wurden. Vor elf Jahren gründet er schließlich seine eigene Firma, in einer Garage in Frankfurt. Zwei Laptops und zwei Telefone, mehr hätten er und ein Freund nicht benötigt. Das Selbstbewusstsein ist schon damals groß genug. Ihre Firma benennen die Junghändler nach einem Universalgelehrten - Da Vinci. Klein lacht.
Auch heute wirkt der Börsenhändler, inzwischen verheiratet und zweifacher Vater, zunächst wie jemand, der sich um sein Ego keine Sorgen machen muss. Da ist der feine Seidenanzug, die markige Sprache, die Raserei im Sportwagen. Allein im vergangenen Jahr musste Klein Strafzettel für knapp 10 000 Euro begleichen, ein Drittel davon, weil er zu schnell unterwegs war.
Er läuft auch, aber natürlich nicht auf Langstrecke. Einen Marathon? Nie versucht. 100 Meter, das ist seine Distanz. Schnell starten, Tempo anziehen, Finish. Wenn der Brustkorb bebt, sagt er, dann fühle er sich gut. Zugleich ist Klein aber auch ein auffallend höflicher Mensch. Im Auto fragt er als erstes, wie weit er nach vorne rutschen soll mit seinem Sitz und ob die Musik gefällt.
Mittagspause. Klein steht am Zürichsee, den Rücken durchgestreckt, die Schultern breit. Ein Kajak-Vierer kämpft gegen den Wind. Klein kann von seinem Büro aus arbeiten, oder von hier, vom Café aus. Oder aus Miami. Entscheidend sei nicht, wo er sich befindet, erklärt er. Entscheidend sei, wo die Maschine steht, mit der er sich einloggt.

Früher sollte der Weg kurz sein zwischen dem Telefon und dem Händler am Parkett. Heute bauen Banken, Fondsgesellschaften und Privatunternehmen ihre Computer gleich in der Nähe der Hauptrechner der jeweiligen Börse auf. Wo genau das ist, wissen nur wenige. Zu groß ist die Angst vor einem Terroranschlag.
Die neuen Händler können überall arbeiten, auch am Seeufer
Eine andere Sache, die kaum einer weiß: Was passiert eigentlich noch an der guten , alten Börse, wenn Händler wie Hendrik Klein ihre Deals längst am Seeufer abschließen können? Sicher, bei jedem größeren Börsengang laufen im Fernsehen noch die Bilder von Vorstandschefs, die zum Handelsstart die Parkettglocke läuten. Aber sonst? Zeit für einen Abstecher nach Frankfurt - dorthin, wo sich in den Neunzigerjahren an guten Tagen noch 350 nach Schweiß riechende Männer auf dem Parkett gedrängelt haben.
Wer hier früher mithalten wollte, musste vor allem breit und sportlich sein. Und laut. "Telekom! 3 bei 50!" Nicht ein Wort zu viel. Der Handel war schon immer ein Spiel um Zeit. Aber verglichen mit dem heutigen Tempo waren die brüllenden Parketthändler Schnecken im Anzug. Von ihrer Welt ist fast nichts geblieben.
Der Bulle und der Bär vor der Börse, jene in Bronze gegossene Symbole für das Auf und Ab der Kurse, werden zwar immer noch gerne fotografiert und gefilmt. Aber drinnen gleicht der Ort einem Museum. Die Telefonzellen in den alten Händlerräumen sind mit Apparaten in Moosgrün und Beige bestückt, Relikte einer Zeit, als die Frankfurter Postleitzahl noch 6000 war. Heute ist es still. Nur die Schautafel über dem Parkett klackert unermüdlich die Kurse vor sich hin. Geht ein Täfelchen kaputt, findet sich nur noch schwer Ersatz. "Börse Frankfurt - mein Platz zum Handeln" prangt in weißen Lettern unter der Dax-Kurve. Platz zum Schlafen wäre passender.
Kritiker bedauern, dass die Kleins dieser Welt das Geschäft mehr und mehr übernommen haben. Dass es nicht mehr Menschen sind, die den Ton angeben, sondern Maschinen, die von überall auf der Welt die Kurse diktieren. Die Börse, sagen sie, habe ihren Sinn als Marktplatz verloren. Einer der härtesten Kritiker ist ausgerechnet der Mann, der noch immer "Mister Dax" genannt wird. Dirk Müller, ehemaliger Börsenhändler. Sein Lachen, aber auch sein Stirnrunzeln flimmerten in den Neunzigerjahren über die Fernsehmonitore, wenn die Kurse stark stiegen oder fielen. Diese Kameraeinstellung bot sich an, er saß damals direkt unter der Anzeigetafel.
Händler sind schneller als Kontrolleure
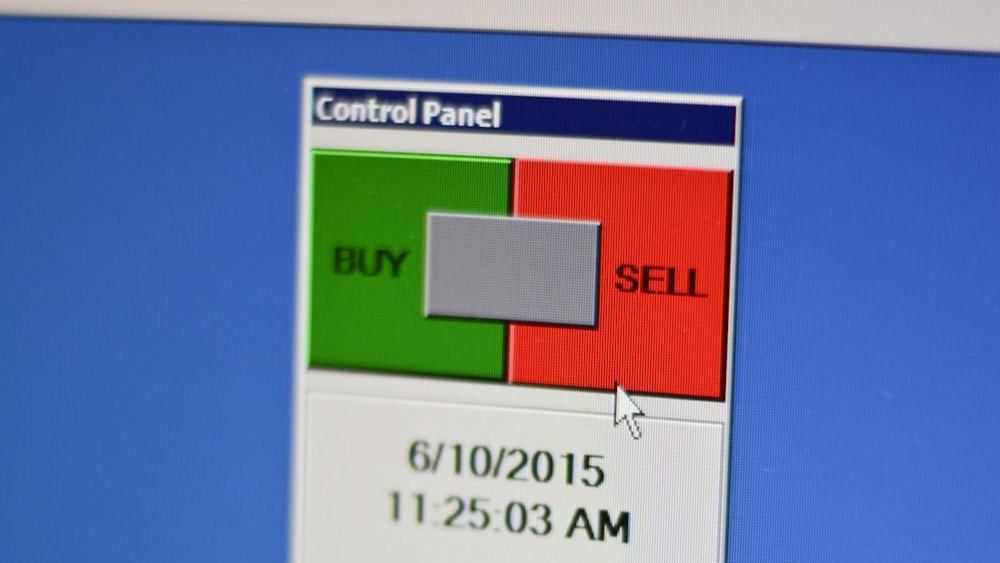
Heute schreibt Müller Bücher mit Titeln wie "Cashkurs: Der Kampf um Europa und unser Geld", er hält auch Vorträge. "Mittlerweile gaukeln sich die Computer gegenseitig etwas vor", schimpft er. "Wenn ich jetzt sagen würde: Ich will 5000 Daimler-Aktien. Ah, nee, doch nicht. Und das immer und immer wieder. Das wäre doch lächerlich." Aber so laufe der Hochfrequenzhandel.
Wer etwas kaufen wolle, der täusche immer wieder ganz schnell einen Verkauf an, so dass andere verunsichert ihre Aktien abstoßen. "Das ist Zockerei. Das kann niemand mehr kontrollieren", sagt Müller. Das Tempo werde weiter anziehen. "Und die Händler werden immer schneller sein, als die Kontrolleure." Sie seien besser ausgebildet und würden mehr Geld in die Technik stecken. Die Ethik? Hätten viele Händler schon verloren - weil man sich nicht mehr in die Augen sehen muss.
Stimmt das? Fühlt sich Klein als Zocker? Der Mann in Zürich hat die alte Frankfurter Börsenwelt noch kennengelernt. Auch er ist früher nach Feierabend hin und wieder mit Kollegen bei zwei oder drei Ebbelwoi in der Kneipe versackt. Und klar, die Leute am nächsten Tag wiederzusehen, habe eine Nähe geschaffen, die verpflichtet hat. "Aber auch heute muss man zu seiner Order stehen", sagt er. Das stimmt. Wer trickst und dabei erwischt wird, wie er gleichzeitig kauft und verkauft, den strafen Kontrolleure mit Gebühren und Verboten ab. Kritiker finden die Maßnahmen allerdings zu lasch.
Und was wird aus dem Menschen, Herr Klein? Braucht's den noch? "Die Hardware wird noch besser, die Software auch", sagt der Händler trocken. Und das sei gut so. Schließlich arbeiteten Computer effizienter, Autoteile fertige heute doch auch keiner mehr von Hand. Weil der Mensch die Fehler mache und nicht die Maschine, werde er auch im Hochfrequenzhandel noch unwichtiger. Noch unwichtiger?
Drohnen für die Zeitersparnis
Schon jetzt, sagt Klein, brauche es nur einen Datenanalysten und einen Programmierer; studierte Physiker und Mathematiker, die die Algorithmen wieder zum Laufen bringen, wenn sie mal haken. Und ja, das Tempo werde noch schneller werden. "Es gibt Versuche mit Mikrowellensendern, um die Übertragung über den Atlantik zu beschleunigen." Auch ein Netz aus solarbetriebenen Drohnen könne helfen, um Zeit zu sparen. Noch seien es etwa 40 Millisekunden, die ein XML-Code via Glasfaserkabel von New York nach Frankfurt benötige. Wenn Klein das sagt, klingt er nicht, als gehe ihm das zu schnell.
Wie lang steht man dieses Rennen durch? Hochfrequenzhandel, sagt Klein, sei wie Leistungssport. Viele seiner Kollegen seien mit Mitte 40 ausgebrannt. Auf Rechner zu starren und nicht zu wissen, ob man in Millisekunden viel gewonnen oder alles verloren hat, das zehre enorm an den Nerven. Für ihn selbst seien seine Kinder der wichtigste Ausgleich.
Wenn der Sohn am Wochenende bei den Kantonsmeisterschaften auf den zweiten Platz sprintet und er selbst hinter der Zielgeraden jubelt, das lenke ab. Oder mit der Familie samstags am Seeufer dösen, herrlich. Den Kindern Gute-Nacht-Geschichten vorlesen, das heißt auch, dass der Papa zur Ruhe kommt. Und während er erzählt, wie er sich dann am Montagmorgen wieder auf den Nervenkitzel seines Jobs freuen kann, fällt ihm ein: der Wagen!
Klein stürmt die Treppe runter auf die Straße. Zu spät. Hinter dem Scheibenwischer klemmt ein Ticket. Klein schaut auf den Betrag, steht da, noch etwas außer Atem, dann zieht er kurz die Schultern hoch. "Geht ja", sagt er. "Nur 120 Franken."
