Man muss keine Biene sein, um die Hamburger Insel Kaltehofe zu mögen. Das Kleinod im Osten der Hansestadt ist herrlich industrieromantisch platziert in der Elbe - sattgrüne Natur hinter Brücken, Damm, Containern, Heizkraftwerk und einer alten Filtrieranlage. Früher wurde hier städtisches Trinkwasser aufbereitet, heute ist es ein Biotop mit Park, Lehrpfad und Museum. Die Bäume, Sträucher und Wiesen gefallen Enten, Zugvögeln und vereinzelten Ausflüglern. Und nun will Stephan Iblher sehen, wie die Botanik in diesem Außenreich des zweitgrößten Hafens Europas seine Königinnen und Arbeiterinnen nährt.
Es ist ein ausnahmsweise schöner und heißer Tag. Ideales Bienenwetter nach der anstrengenden ersten Jahreshälfte mit all den Mäusen und Plagen der bienentötenden Varroa-Milbe. "Hervorragende Tracht", sagt Iblher, Tracht ist das Fachwort für blühende Bienennahrung. Der Stadtimker trägt seine weiße Schutzjacke sowie eine Kopfmaske, die an einen Degenfechter erinnert, und schiebt eine Schubkarre voller Gerät. Am Ziel zieht er mit bloßen Händen die Holzrahmen mit den Waben aus sechs Kisten für die Bienenbrut unten und den Honig oben. Zehntausende Bienen umfasst jedes seiner durchnummerierten Völker. Iblher reinigt und prüft, ob die Bienen bei der üppigen Flora gut ernten, ob sie ordentlich brüten, fliegen und saugen. Er schimpft bei den einen: "Schwaches Volk." Und lobt bei anderen: "Die Alte ist fleißig." Auf den Behältern klebt das Logo seiner Imkerei "Elbgelb": "Hamburger Lagenhonig. So schmeckt die Stadt."
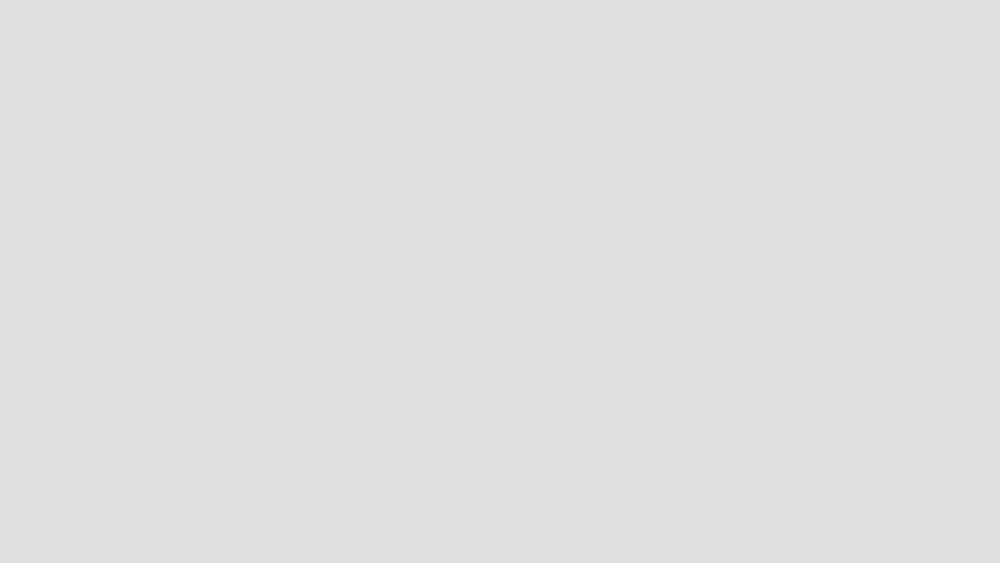
Wie die Stadt den Bienen von der Insel Kaltehofe schmeckt, muss sich erst noch zeigen. Bald wird geerntet, geschleppt, geschleudert, abgefüllt und abgeschmeckt. Der Erzeuger und seine Kunden werden danach befinden, ob das Aroma vielleicht an Zitrusfrüchte erinnert, ob es malzig oder eher herb schmeckt, ob der Honig hellgelb wird oder dunkelgelb, sehr süß oder dezent, ob also das Eiland Kaltehofe honigmäßig anders schmeckt als die anderen Zonen dieses urbanen Experiments. "Jeder Standort hat seinen Reiz", sagt Iblher, "mich interessieren solche Stadtmarken." Die Honigsorten des Imkers lesen sich wie ein Hamburger Stadtplan. Mal heißen sie nach Vierteln, mal nach Parks, sie stammen aus dem Stadtgarten oder aus dem Niendorfer Gehege und sogar vom Ohlsdorfer Friedhof. Auch auf dem Dach eines Hotels am Michel, Hamburgs Wahrzeichen, unterhält Iblher ein Volk. Insgesamt zehn Orte seiner Heimatstadt hat der Nebenerwerbsimker mit Bienenstöcken besetzt; ihren Honig verkauft er in seiner Wohnung und in zwei Supermärkten. "Eppendorfer Zartbitter 2013" steht da auf dem Etikett, "Frühling in Uhlenhorst 2013", "Winterhuder Sommerseite 2013" , "Frühlese im Niendorfer Gehege 2014" oder "Sommerblütenlese in Planten un Blomen", dem früheren botanischen Garten in der City.
Tatsächlich schmeckt jede Honigsorte anders, und wenn jedes Viertel sein eigenes Aroma habe, dann liege das natürlich auch an der Flora, erklärt Iblher. Der Imker kann ausgiebig von den fetten Brombeerhecken entlang mancher Alsterfleete in Winterhude schwärmen, oder von der Pflanzenvielfalt auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Und wenn man ihn so reden hört, dann könnte man fast vergessen, dass er da von Innenbezirken einer Großstadt mit fast zwei Millionen Einwohnern spricht.
Nun ist Stadthonig nicht neu, schon vor Jahren las man erste aufgeregte Berichte von amerikanischen Hobbyimkern, die Dächer von Wolkenkratzern mit Bienen bevölkerten. Zu den Avantgardisten der Szene gehören ein Pariser Theaterdekorateur und ein Ex-Busfahrer aus Manhattan. Chefkoch David Garcelon hielt sich gar Bienen auf dem New Yorker Waldorf-Astoria.
Doch die Zahl solcher Projekte hat seither erstaunlich zugenommen. Allein Berlin meldet mehr als 800 Stadtimker. Früher galten Bienenfreunde als ältere Herren, die ihre Rente mit eigenem Honig versüßen. Mittlerweile ist von einem bienenzüchtenden DJ die Rede, und die taz hält Bienen auf ihrem Redaktionsgebäude. Geimkert wird in Parks, auf Terrassen, an Gräbern und in Höfen. Apis mellifera, die Honigbiene, fliegt längst millionenfach durch Wien, Nürnberg, Frankfurt oder Dortmund. Ihre Kästen stapeln sich in Charlottenburg, im Wedding, in Schwabing, Untermenzing oder auf dem Pfarrheim St. Maximilian. In den Foren tauschen sich die Honigfans aus, und Vorträge oder Verkostungsseminare, wie auch Iblher sie anbietet, sind gut besucht.
Doch warum hat Honig aus Parks und von Verkehrsinseln mit Feinstaub belasteter Straßen solchen Erfolg? "Stadthonig ist geschmacklich spannender als Honig vom Land", erläutert Stephan Iblher. "Die Qualität ist besser." Das muss nicht in jedem Fall stimmen, und es klingt seltsam, wenn man an die Abgase und den Dreck denkt. Doch Studien beweisen tatsächlich, dass Stadthonig in den Zeiten bleifreien Benzins unbelastet ist, weil die verborgenen Saftdrüsen in der kurzen Blütezeit kaum der Luft ausgesetzt sind. Auch Spuren von Feinstaub waren nicht zu entdecken. Die freie Wildbahn dagegen leidet oft unter Monokulturen und Agrochemie. Bienen finden vielerorts weniger Futter oder fallen rätselhaftem Massensterben zum Opfer, das nicht allein mit Viren, Milben und altersschwachen Königinnen zu erklären ist - allen Entwarnungen der Industrie zum Trotz.

Die Deutschen lieben Honig, etwa 1,1 Kilo isst jeder jährlich im Schnitt. Doch 80 Prozent wird importiert, das meiste ist Massenware. Da ist es wohl folgerichtig, dass auch die Honigbiene in die Stadt gewandert ist, wo die anspruchsvollere Klientel sich schon im ökologischen Gemüseanbau engagiert und das Bier in der Mikrobrauerei um die Ecke ordert.
Außerdem ist es zwischen den Häusern gewöhnlich wärmer, und irgendwo wächst zwischen Frühling und Spätherbst in der Stadt immer etwas. Deshalb geht es selten um den beliebten sortenreinen Honig wie Raps, Akazie, Klee oder Linde. Denn statt eines dominierenden Gewächses stehen den Bienen ja meist mehrere Trachten als Flugziele zur Auswahl. Es geht um blumig klingende Variationen wie "Sommer am Kuhmühlenteich" (Elbgelb, Hamburg) oder "Glockenbach-Frühlingshonig" (Die Honigpumpe, München). "Klar ist das Marketing", sagt Stephan Iblher, er lacht. "Der Honig braucht eine Geschichte." Wenn Honig aus bestimmten Stadtvierteln ein bisschen wie Wein oder Gin an den Erfolg der Regionalisierung von Produkten anknüpft, dann ist das nicht von Nachteil.
Reich wird man damit sowieso nicht bei so geringen Mengen und acht Euro pro Glas. "Das machst du nicht für Geld, eher zum Glücklichsein", sagt Iblher, ein enorm unterhaltsamer Hanseat von Anfang 50. Von Beruf war der Stadtimker eigentlich Tischlermeister, ehe er seine Schreinerei zumachte und sich den Kindern widmete, weil seine Frau besser verdiente. Als die Kinder dann größer waren, suchte er sich eine neue Beschäftigung und entdeckte die Bienen.

Auf diese Weise wurde er wie andere Stadtimker auch Botaniker und Location Scout. An manche Lagen wird Iblher gebeten, aus anderen vertrieben. Beim Altenheim bei ihm um die Ecke kannten sie den Mann in Weiß mit dem Netzschleier, aber nun entsteht dort eine Flüchtlingsunterkunft, die Bienen müssen weichen. Und der Norddeutsche Rundfunk wollte ihn gar nicht auf seinem Gelände haben. Anderswo wird beim Hausmeister sturmgeklingelt, wenn Iblhers Völker loslegen, weil Mütter um ihre Kinder fürchten. "Die Leute können Bienen nicht von Wespen unterscheiden", vermutet Iblher. Für ihn sind Bienen viel harmloser als kratzende Katzen oder beißende Hunde, an die Stiche hat er sich gewöhnt wie ans Kistenschleppen.
Er erzählt in Schulklassen, dass Bienen selbst Honig brauchen, "als Heizöl und Flugbenzin". Er erklärt, dass 80 Prozent der Bienen im Prinzip faul seien, "so Strandperlentypen", die Strandperle ist eine beliebte Bar an der Elbe. Käufer freuen sich, wenn die Bienen für ihren Honig möglicherweise mal bei ihren Topfpflanzen auf dem Balkon vorbeigeschaut haben. Einen Honig vom Friedhof nannte Stephan Iblher "Kalte Sophie" - im Grab neben seinen Bienenstöcken ruhte eine Sophie.
Am Abend sitzt er in seiner Küche und probiert mit seinem Gast stundenlang Honig. Löwenzahnhonig rieche nach Urin, findet er, und Buchweizenhonig nach Schweinestall, er liebt dennoch beide. Oder der "Eppendorfer Zartbitter", dieses lang anhaltende Aroma. "Zartbitterer, an Kräuter erinnernder, mittelsüßer, weichkörniger Sommerhonig", verspricht die Binde am Deckel. Oder "Vierländer Sommerernte Lage am Rieck Haus", auch an dieser reetgedeckten Attraktion in der Vorstadt ist die Imkerei Elbgelb aktiv. "Ich behaupte, da ist eine Butternote", sagt Iblher. "Man kann's schmecken. Oder sich einbilden."