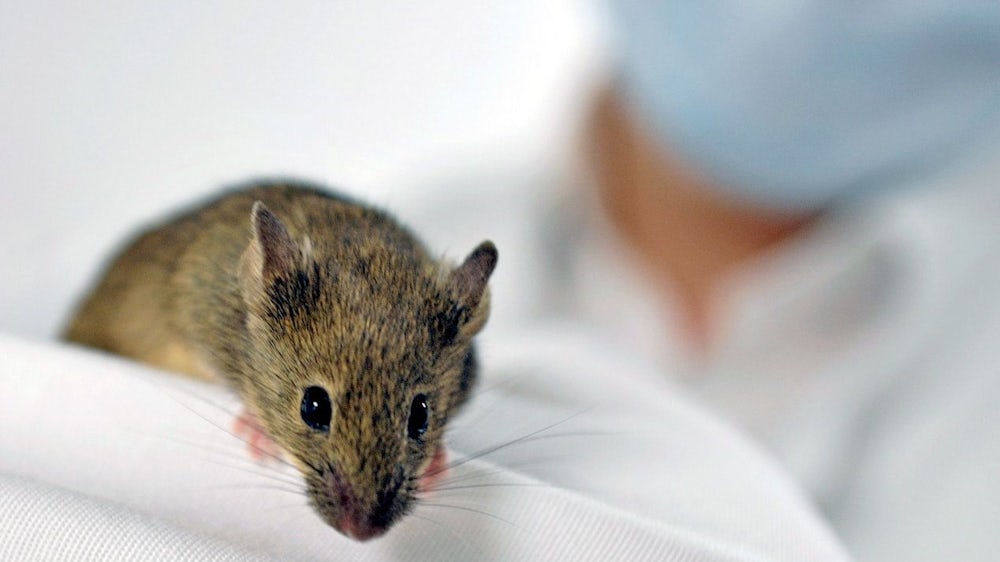Es fängt schon beim Begriff an: "Tierversuch", das klingt nach Affen, denen Elektroden ins Gehirn gesteckt werden, oder nach Mäusen, die so gezüchtet sind, dass in ihnen Krebsgeschwüre wachsen. "Tiermodell" hingegen klingt irgendwie abstrakter und damit freundlicher. Deshalb sagt der Mediziner von der Technischen Universität (TU) München zunächst: "Um Krebs besser behandeln zu können, brauchen wir Tiermodelle." Doch das Wort setzt sich nicht durch, auch nicht im Sprachgebrauch der Menschen, die an Tieren forschen. Ein paar Sätze später spricht dann auch der Mann, der für seine Arbeit werben will, von "Tierversuchen", ohne die man "leider" nicht auskomme.
Es tut sich zur Zeit einiges bei der Forschung mit Tieren in München. Das liegt vor allem an zwei großen Neubauten der TU und der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), in denen Tierversuche stattfinden werden: Die TU plant am Klinikum rechts der Isar das so genannte Translatum, die LMU errichtet bereits das Bio-Medical Center (BMC) in Martinsried. Beide Zentren sind so ausgelegt, dass dort jeweils Zehntausende Wirbeltiere gehalten werden können. Sie werden im Namen der Forschung Leiden ertragen müssen - und in den Zentren sterben.
2011 wurde an 2,9 Millionen Wirbeltieren geforscht
"Tierversuchshochburg München: Stoppt Laborneubauten" - mit diesem Slogan kämpft das Bündnis Bayerischer Tierrechtsorganisationen, zu dem etwa der Landesverband des Deutschen Tierschutzbundes und der Verein Ärzte gegen Tierversuche gehören, gegen das BMC und das Translatum. Vor einem Monat gab es eine Demonstration in Haidhausen. Am Bau der Zentren wird das nichts mehr ändern. Doch den Tierversuchsgegnern geht es auch darum zu propagieren, warum diese Art von Forschung aus ihrer Sicht grundsätzlich verboten gehört.
In welchem Ausmaß an Tieren geforscht wird, das macht eine Zahl deutlich: 2,9 Millionen Wirbeltiere seien im Jahr 2011 in Deutschland "für Tierversuche und andere wissenschaftliche Zwecke" eingesetzt worden, meldet das Bundeslandwirtschaftsministerium. Neuere Zahlen gibt es noch nicht. Aber seit es durch die Fortschritte in der Genetik möglich ist, Tiere mit gewissen Merkmalen auszustatten und dann an ihnen zu forschen, steigt die Zahl der Versuchstiere von Jahr zu Jahr.
Die Statistik erfasst Eingriffe von der Blutentnahme über die Organentnahme bis zum Arzneimitteltest. 70 Prozent der Tiere waren Mäuse. Es kommen aber auch Schafe, Hunde und Affen zum Einsatz. Wie viele Tiere im Großraum München verwendet wurden, darüber kann die Regierung von Oberbayern, die Tierversuche beaufsichtigt, nach eigenen Angaben keine Zahlen liefern. Es sind aber nicht nur die Universitäten, die mit Tieren forschen. Das Helmholtz-Zentrum unterhält in Oberschleißheim ein Mäuse-Forschungszentrum, Max-Planck-Institute arbeiten mit Tierversuchen. Und nach Berichten der Tierschützer arbeiten etwa auch die Pharmakonzerne Roche (Penzberg) und Merck (Grafing) in ihren Dependancen in der Region mit Tieren. Die Firmen ließen Anfragen dazu unbeantwortet.
Die Argumentation der Tierversuchsgegner lässt sich in zwei Stränge teilen. Der eine zielt auf die wissenschaftliche Notwendigkeit. "Die Frage ist: Können Tierversuche überhaupt in zufriedenstellendem Maße das leisten, was von ihnen erwartet wird, nämlich die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Menschen?", sagt Roman Kolar. Er ist stellvertretender Leiter der in Neubiberg ansässigen Akademie für Tierschutz, einer Einrichtung des Deutschen Tierschutzbundes. Seine Antwort ist: Nein.
Er verweist auf eine Studie, derzufolge 90 Prozent der Arzneien, die sich im Tierversuch als wirksam erwiesen haben, danach im Test am Menschen durchgefallen seien. Kolar zitiert den Pharmakologen Thomas Hartung von der John-Hopkins-Universität in Baltimore: Der Mensch sei nun einmal keine "70-Kilo-Ratte". Silke Bitz, Sprecherin von Ärzte gegen Tierversuche, ergänzt, dass die Ergebnisse von Tierversuchen sogar oft irreführend seien. Penicillin zum Beispiel sei "für Hamster oder Meerschweinchen schädlich bis tödlich". Auf der anderen Seite gebe es jedes Jahr Zehntausende Tote durch Arzneimittel, die vorher an Tieren getestet wurden.
Den Gegnern zufolge könnte man auf Tierversuche verzichten, wenn nur die Alternativmethoden intensiver genutzt würden. "Man müsste die Ergebnisse aus der Arbeit mit menschlichen Zellen und Biochips kombinieren mit Computersimulationen mit menschlichen Daten", sagt Bitz. "Das wären sinnvolle Methoden, die sich am Menschen orientieren." Kolar sagt, die USA hätten Europa bei der Suche nach Alternativmethoden längst überholt.
TU-Präsident Wolfgang Herrmann schart eine Gruppe hochrangiger Forscher um sich, um über Tierversuche, einen der heikelsten Bereiche universitärer und damit auch staatlich finanzierter Forschung, zu sprechen. Sie verbinden das aber mit einer Bitte: Sie möchten "im Interesse der eigenen Sicherheit und Unversehrtheit und auch der ihrer Familien" nicht namentlich genannt werden. Es habe in der Vergangenheit öfters Anfeindungen und Angriffe gegen Forscher und ihre Angehörigen gegeben, nachdem deren Namen in Medien aufgetaucht waren.
Details über die Art der Angriffe nennt die TU nicht, es sollen wohl unter anderem radikale Tierschützer dahinter gesteckt haben. Die LMU berichtet von dem gleichen Problem, dort will überhaupt kein Forscher über Tierversuche sprechen. Es handle sich um "eine grundsätzliche Übereinkunft der Wissenschaftler". Fragen beantwortet die LMU nur schriftlich.
Die Befürworter berufen sich gern auf die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die in einem Grundsatzpapier von 2004 Tierversuche für unverzichtbar erklärt hat. Dass das allein womöglich zu wenig ist, ahnen die TU-Forscher: Einer gesteht ein, dass "wir eine Bringschuld für aufklärende und angstmindernde Transparenz haben. Die haben wir in der Vergangenheit nicht immer erfüllt". Allerdings gebe es "auch einen Kreis von Menschen, die für Argumente nicht besonders zugänglich sind. Der Prozess ist nicht einfach."
Einen breiten Konsens zu Tierversuchen wird es nie geben
Inzwischen hat die TU nach eigenen Angaben den Grundsatz, Tierversuche nicht mehr für ergebnisoffene Grundlagenforschung einzusetzen, sondern vor allem für "krankheitsnahe Forschung". "Wir verstehen Krankheiten einfach noch nicht genug", sagt ein Forscher. Es gehe darum, auf molekularer Ebene die Auslöser zu verstehen und dann möglichst gezielt Medikamente zu entwickeln. Die Entwicklung von Krebsgeschwüren etwa lasse sich nicht komplett an menschlichen Zellen in einer Petrischale nachvollziehen. Um zu verstehen, wie der Tumor wächst, müsse man ihn in einem Organismus beobachten.
Die LMU erklärt, Tierversuche seien auch nötig, um "Nebenwirkungen bereits etablierter Medikamente und mögliche neue Anwendungen dafür zu erforschen. (...) Viele dieser Versuche sind vom Gesetzgeber vorgeschrieben". Zur Statistik, dass so viele Medikamente nach dem Tierversuch im Test am Menschen durchfallen, heißt es in der TU: Das zeige, wie streng die Zulassungskriterien seien. Im Übrigen könne man 70 Prozent der Nebenwirkungen von Medikamenten beim Menschen schon vorher im Tierversuch herausfinden und damit Menschen vor Schaden bewahren.
Ein heikles Thema ist immer auch die Frage, an welchen Tieren geforscht wird. Mäuse erwecken beim Menschen weniger Mitleid als Schafe oder Affen. Doch an der TU experimentieren Chirurgen mit Herzklappeneingriffen an Schafen. Und im Klinikum der LMU werden Pavianen Organe anderer Tiere eingepflanzt. Das geschehe "pro Jahr nur vereinzelt", erklärt ein Sprecher. Dahinter steht die Hoffnung, eines Tages auch Menschen tierische Organe einpflanzen zu können, ohne eine Abstoßung auszulösen - und damit dem Problem der fehlenden menschlichen Spenderorgane entgegenzuwirken.
Doch macht das überhaupt einen Unterschied, ob man einen Affen oder eine Maus hernimmt? Da ist man beim zweiten Argumentationsstrang der Tierversuchsgegner: der ethischen Dimension. Tierschützer Kolar macht keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Mäusen und Affen. "Wir wissen, dass die Leidens- und Schmerzfähigkeit eines Tieres der des Menschen sehr nah kommt", sagt er. Letztlich liege dem Tierversuch ein Prinzip zu Grunde, so Kolar, das im menschlichen Miteinander verpönt sei: "das Recht des Stärkeren". Da geht es nicht mehr um Prozentwerte und Alternativmethoden, sondern um die Frage, wie der Mensch mit anderen Lebewesen umgehen will und darf.
Der TU-Mediziner, der anfangs von "Tiermodellen" gesprochen hatte, sagt: "Einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu Tierversuchen wird man wohl nie erzielen können."