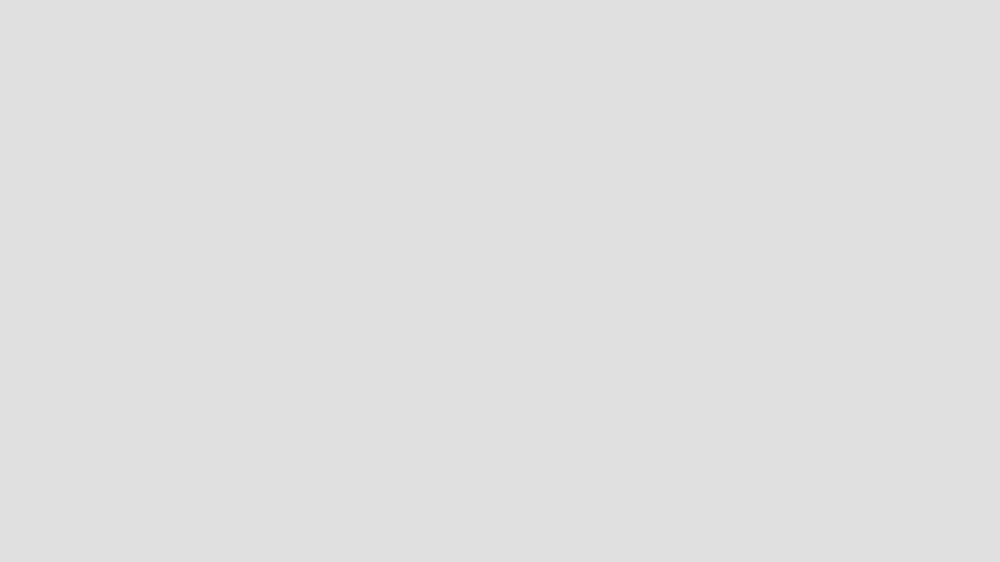Jahrelang wurde in der Öffentlichkeit kaum über das Thema Abtreibung gesprochen. Mitte der Neunzigerjahre fand der Bundestag einen Kompromiss, mit dem sowohl liberale als auch konservative Kräfte einigermaßen leben können. Doch in den vergangenen Monaten verschärfte sich die Debatte wieder. In mehreren Prozessen stehen Ärztinnen vor Gericht, weil sie gegen den Paragrafen 219a verstoßen haben, der jegliche Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Radikale Abtreibungsgegner nutzen diesen Gesetzespassus, um gerichtlich gegen Ärzte vorzugehen. An diesem Mittwoch wird vor dem Amtsgericht in Kassel erneut ein solcher Fall verhandelt. Eine der beiden angeklagten Gynäkologinnen hat vorher mit uns gesprochen.
SZ: Frau Szász, Sie und Ihre Kollegin Natascha Nicklaus stehen vor Gericht. Was genau ist der Grund für die Anklage?
Nora Szász: Es geht um unsere Website. Dort sind die zwölf Operationsverfahren aufgelistet, die wir in einer unserer Praxis nahegelegenen Tagesklinik anbieten. Darunter eben auch der Schwangerschaftsabbruch, operativ oder medikamentös. Es ist dieser eine Spiegelstrich im Internet, dessentwegen wir vor Gericht stehen.
Ihr Fall ist ähnlich gelagert wie der von Kristina Hänel, jener Ärztin aus Gießen, die Ende vergangenen Jahres zu 6000 Euro Geldstrafe verurteilt wurde , weil sie Patienten per Mail Informationsmaterial zu Schwangerschaftsabbrüchen zur Verfügung stellte.
Frau Hänel und wir beide stehen in Verbindung und tauschen uns regelmäßig aus. Ich war damals auch im Gerichtsaal und war fassungslos über die Begründung für die Verurteilung. Wir glauben, wir haben daraus gelernt, haben viele Argumente gesammelt und gehen mit einer anderen Verteidigungsstrategie in die Verhandlung.

In Deutschland gibt es immer weniger Mediziner, die Abtreibungen vornehmen, auch im Studium ist der Eingriff kaum ein Thema. Zurück bleiben Frauen in Not.
Mit welcher?
Frau Hänel hatte sich vor Gericht auf Anraten ihrer Anwältin nicht zu Wort gemeldet, obwohl sie eine brillante Rednerin ist. Frau Nicklaus und ich werden uns äußern. Wir wünschen uns, dass der Richter mit unvoreingenommenem Blick auf diesen Paragrafen schaut. Denn man kann ihn anders interpretieren, als das die Richterin in Gießen getan hat.
Wie interpretieren Sie ihn?
Es ist ein Passus, der aus dem Jahr 1933 stammt. Er passt überhaupt nicht mehr in unsere Zeit, in unser Informations- und Internetzeitalter. Eine Ärztin darf ihre medizinischen Leistungen nicht verheimlichen. Das ist mit dem Informationsrecht meiner Patientinnen nicht vereinbar. Bei jedem medizinischen Eingriff muss ich detailliert über die Vorgehensweise, mögliche Risiken und Nebenwirkungen informieren - und das ist auch richtig so. Da dürfen Schwangerschaftsabbrüche keine Ausnahme sein.

Wie viele Schwangerschaftsabbrüche nehmen Sie und ihre Kollegin pro Jahr vor.
Wir behandeln insbesondere Frauen, die ein Kind erwarten, Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch und Krebspatientinnen. Schwangerschaftsabbrüche sind nur ein sehr kleiner Teil unserer Arbeit. Es sind etwa ein Dutzend Patientinnen pro Jahr. Wir mussten diese Zahl erst aus den Akten heraussuchen, nachdem vor einem Jahr die Anzeige einging, mitten aus dem Nichts, obwohl unsere Website schon seit Jahren online war. Ich musste ja sogar den Wortlaut des 219a nochmal nachlesen, der hatte uns bis dahin nicht sonderlich interessiert.
Ach nein?
Dieser Paragraf lag nach 1945 jahrzehntelang brach, bis 2001. Da wurde einer der sogenannten Lebensschützer darauf aufmerksam und nutzt ihn seitdem, um Ärztinnen und Ärzte einzuschüchtern. Hunderte Anzeigen hat er seitdem eingereicht, doch es kam nur zu einer Handvoll von Prozessen.
Woran liegt das?
Viele Kolleginnen und Kollegen geben klein bei, bevor es zu einer Verhandlung kommt. Sie streichen das Wort Schwangerschaftsabbruch einfach von ihrer Website. Das war auch das, was die Staatsanwaltschaft in unserem Fall vorgeschlagen hat. Aber das wollten wir auf keinen Fall. In Deutschland gibt es etwa 100 000 Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr, alle werden von Ärzten und Ärztinnen vorgenommen und das ist richtig so. Wir wollen nicht in die Zeit der Engelmacher zurück, mit höchstem Risiko für die Frauen. Die Einschüchterungstaktik der sogenannten Lebensschützer darf nicht aufgehen. Schon heute gibt es Landstriche, in denen kein Arzt mehr Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Ich respektiere es, wenn Kolleginnen und Kollegen das aus ethischer, moralischer und religiöser Überzeugung heraus nicht tun können, aber ich richte auch einen Appell an unseren Berufsstand: Wir dürfen ungewollt schwangere Frauen nicht im Stich lassen.
Was fordern Sie von der Politik?
Wir brauchen dringend eine neue Regelung. Sowohl die Justiz, die die vielen Anzeigen bearbeiten muss, als auch die verunsicherten Ärzte und natürlich die betroffenen Frauen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die große Koalition nach der bayerischen Landtagswahl im Oktober einen Gesetzentwurf vorlegt. Seitdem der Fall von Frau Hänel öffentlich wurde, hat sich in der Debatte einiges getan. Selbst konservative Menschen, die mit Schwangerschaftsabbrüchen ihre Probleme haben, finden es falsch, dass man wegen einer bloßen Information auf der Website vor Gericht gestellt wird und sogar ins Gefängnis kommen kann.
Mit welchem Ergebnis rechnen Sie in dem Prozess?
Es kann gut sein, dass wir verurteilt werden. Aber wir wünschen uns einen Freispruch, weil wir uns unschuldig fühlen. Und wir sind überwältigt von der Unterstützung, die wir erfahren haben. Der Mann einer Patientin sagte neulich: Im Grunde haben Sie ja schon gewonnen. Das hat mir Mut gemacht.