Vielleicht sehen die Amerikaner das mit dem Nationalstolz zu verbissen, eines muss man ihnen lassen: Sie haben gute Ideen. Eine davon kam in dieser Woche aus Portsmouth in Virginia: Als Reaktion auf die Ausschreitungen in Charlottesville, wo Alt-Right-Anhänger gegen die geplante Entfernung der Statue eines Südstaatengenerals aufmarschierten, startete dort ein Bürger eine Petition mit dem Ziel, das Konföderierten-Denkmal durch eine Statue der aus Portsmouth stammenden Rapperin Missy Elliott zu ersetzen. In dem Aufruf, der auf der Aktivismus-Plattform Change.org bis Dienstag bereits 27 000 Unterschriften zählte, heißt es in Anlehnung an einen ihrer brillanten Hip-Hop-Hits der frühen Nullerjahre: "We can put white supremacy down, flip it and reverse it." Das weiße Überlegenheitsdenken niederschlagen, zurückspulen und neu machen: warum nicht mit einer Reiterstatue im ehemaligen Sklavenstaat von jener schwarzen Rapperin, die das Wort "Bitch" im Hip-Hop zum Synonym für "toughe Frau" machte? Wo wir gerade dabei sind: Für Deutschland ließe sich die Idee übernehmen: Wie wäre es mit dem Rapper Marteria in Bronze vor dem Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen? Am Sockel die Inschrift: "Wir sind Aliens!"
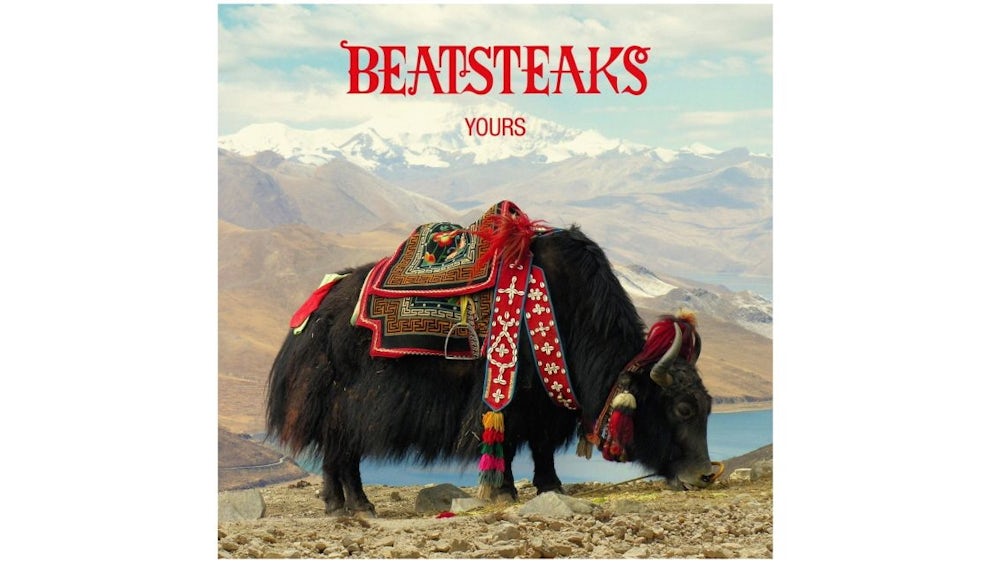
"L auf der Stirn" (Warner) heißt die neue Single der Beatsteaks, und sie ist eine Art letzter, spätsommerlicher Versuch, in Gemeinschaftsarbeit mit Deichkind doch noch eine Alternative zum karibischen Li-La-Laune-Hit "Despacito" zu etablieren. Die Cool Kids brauchen auch einen Sommerhit. Und dieser hier gibt wenigstens zu, dass im Leben "nicht immer alles California" ist. Das Interessante an der Single: Sie ist vor allem ein guter Deichkind-Song und steht den wohl berlinerischsten unter den Berliner Punkrockpoppern in ihrer Leichtigkeit trotzdem erstaunlich gut: der tropisch federnde Beat, die verträumten Dunst-Gitarren, ein kleiner verzerrter Saxofon-Einsprengsel, und immer wieder die nordisch genuschelte Frage: "Warum krieg' ich das alles nicht hin, ha?" Die schönste Stelle verpasst man aber fast: "Immer auf der Jagd nach dem Money. Sonst bleibt's immer nur beim Zwanni", rappt Porky, und aus dem Songunterbau blubbert eine leise Stimme: "Ja, immerhin!" Merke: Mehr braucht man an einem guten Sommertag eh nicht.

Genau zwei drängende Fragen wirft "Villians" (Matador), das neue, siebte Album von Josh Hommes Band Queens Of The Stone Age auf. Für all diejenigen, die den ledrigen Wüsten-Hardrock der Amerikaner schon immer zu schätzen wussten, ist die erste: Hat der Goldjunge Mark Ronson den alten Stone-Age-Sound kaputtgebügelt? Ausgerechnet Ronson, der als Experte für Retro-Radiohits hinter Songs von Amy Winehouse, Adele oder Bruno Mars steht, hat die Platte nämlich produziert. Entgegen allen Befürchtungen klingt "Villians" aber wieder böser, lauter, sogar glamiger als der nachdenkliche, irgendwie Eagles-hafte Vorgänger "... Like Clockwork". Mit Bruno Mars hat das also sehr viel weniger zu tun als mit Led Zeppelin'schen Rockismen. Frage Nummer zwei für alle anderen: Ist das Titelthema der Platte - "Schurken" - die große Abrechnung mit Trumps Amerika? Homme sagt Nein; er hätte nur das Wort fantastisch gefunden. Und so geht es also um den üblichen Rockquatsch, der sexy, aber auch abgegrast ist. Ein bisschen Irrsinn steckt trotzdem mit drin: "Is love mental disease or lucky fever dream?", fragt Homme, also: Ist Liebe eine psychische Erkrankung oder ein seliger Fiebertraum?
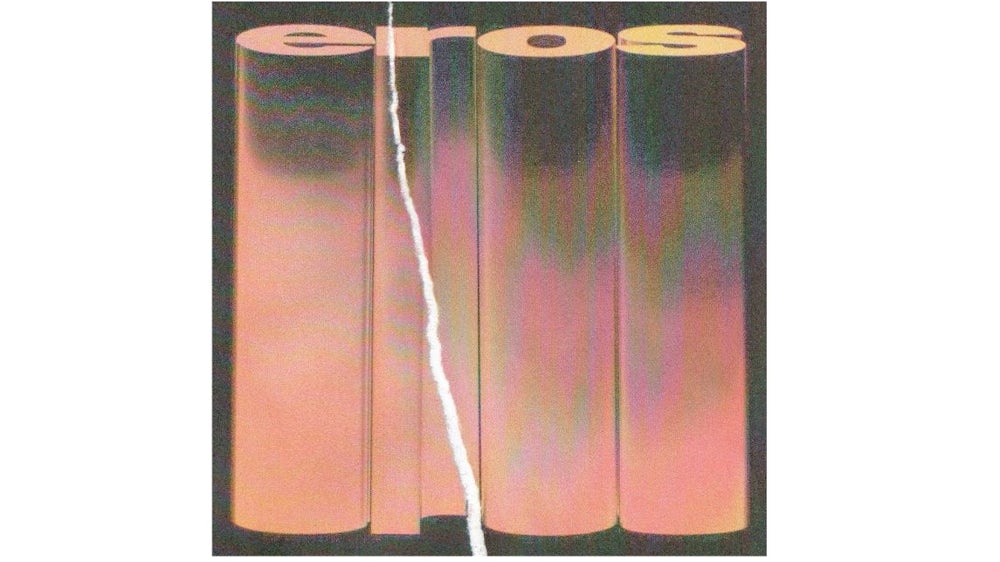
Ein weiteres Anzeichen dafür, dass 2017 in der deutschsprachigen Popmusik eine neue Hip-Hop-Welle richtig Fahrt aufgenommen hat, ist das Debütalbum von Rin. Es heißt "Eros" (Division) und wird von dicken Auto-Tune-Effekten, umnebeltem Sprechgesang und der psychotisch-berauschten Katerstimmung verschleppter Cloud-Beats dominiert. Rin tendiert eher zum amerikanischen R&B und Trap als zu deutschem Gangster-Gepolter. Überhaupt ist diese Musik ein angenehmes Gegenmodell zum Authentizitäts- und Männlichkeitsfimmel im Deutsch-Rap. In den eher dadaistischen Texten geht es um Langweile und die Abgründe der modernen jugendlichen Seele: gesprungene Handy-Displays, Nachrichten an die Ex, Online-Shopping, Pillen gegen die Einsamkeit und Herz-Emojis. "Ich will, dass du mich brauchst" besteht praktisch nur aus Wiederholungen der Titelzeile, tröpfelnden Billo-Keyboards und dystopischem Dröhnen. Klingt erst mal albern. In Wirklichkeit aber hat sich schon lange niemand mehr so elegant durch die Zwickmühle der nachwachsenden Generation geschlängelt: mitten durch die Lücke zwischen Leistungs-Popmusik und reiner Stinkefingergeste, hin zum Zeitgeist.