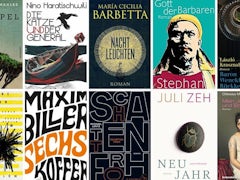Ingeborg Bachmann und Hans Magnus Enzensberger haben wenig miteinander zu tun. In der heutigen Wahrnehmung verkörpern sie größtmögliche Gegensätze: die an den zeitlosen Problemen von Ich und Welt laborierende schwerblütige Dichterin hie, der alerte und wendige Virtuose des Literaturbetriebs da. Dennoch war es unvermeidlich, dass sie in den Fünfzigerjahren aufeinanderstießen. Die Treffen der Gruppe 47 boten all denen ein Forum, die sich abseits des herrschenden Konsenses bewegten - und dieser bestand vor allem in der Verdrängung der Nazizeit und einem Begriff von Literatur als etwas Höherem, das sich über krude Alltagsprobleme und politische Fragen hinwegsetzt.
Enzensberger lernt Bachmann bei einem solchen Treffen 1955 als 26-Jähriger kennen, sie ist drei Jahre älter und bereits ein gefeierter weiblicher Star. Bachmann gilt als lyrische Diva, die sich auch als solche inszeniert, aber gleichzeitig große Schwierigkeiten im Umgang mit der Öffentlichkeit hat. Enzensberger hingegen ist gerade dabei, sich in die Rolle eines angry young man hineinzuarbeiten und die Medien geschickt für sich zu instrumentalisieren. Dass er Ende November 1957 zum ersten Mal an Bachmann schreibt, hat etwas damit zu tun. Er möchte den frühen Ruhm der Dichterin für seine Zwecke nutzen, das führt zu ihren Ungaretti-Übersetzungen für sein berühmtes "Museum der modernen Poesie" - ein glänzender Effekt.

Diese Woche eröffnet in Leipzig ein Reclam-Museum. Der Initiator Hans-Jochen Marquardt erklärt, warum so etwas der Stadt gefehlt hat - und warum er nicht aufhören kann, die kleinen Hefte zu sammeln.
Als Enzensberger am 1. März 1959 sein Stipendium an der Villa Massimo in Rom antritt, spitzt sich die Sache zu. Rom ist der Fluchtpunkt für Ingeborg Bachmann, sie lebt mit Unterbrechungen seit sechs Jahren in Italien, und der stürmische Jungschriftsteller schreibt ihr deshalb, natürlich in aufmüpfiger Kleinschreibung: "ich werde mich verirren wenn sie nicht da sind." Recht schnell merkt er, dass die Villa Massimo ein "miserables kunstghetto" ist, "hier halte ichs nicht aus", und mietet kurzerhand ein idyllisches Haus im Umland. Zwischen Ende Mai und Juli passiert dann etwas. Nach einem Abstand von mehreren Wochen setzt der Briefwechsel wieder ein, und der der Ton hat sich abrupt geändert - Enzensberger spricht Bachmann plötzlich mit "du" an, und mit was für einem Du! Es ist etwas Intimes dazwischengekommen, und der sich gerade abbrühende Medienprofi wird dem kaum Herr: "seit deiner abreise steht die zeit still".
Die in deutlichen Anspielungen und vor allem in den Leerstellen des Briefwechsels dokumentierte Liebesaffäre der beiden ist zwar nicht das Wichtigste an diesem Band - aber sie ist natürlich geeignet, das Bild Ingeborg Bachmanns spekulativ und sensationsheischend in noch grelleres Licht zu rücken. Sie lebte gerade mit Max Frisch zusammen, und das Liebesverhältnis mit Paul Celan, an dem sie immer noch laborierte, lag noch nicht lange zurück.
Eine weibliche, ebenbürtige Intellektuelle, war in der damaligen Gesellschaft nicht vorgesehen
Schon die Zeitgenossen waren damit überfordert, diese merkwürdig flirrende, ein offenbar selbstbestimmtes Leben anstrebende Dichterin in ihrer Eigenart zu erkennen. Von Anfang an gibt es widersprüchliche Deutungen ihrer Person. In ihren Suchbewegungen, ihrem Spiel mit verschiedenen Selbstbildern und Rollenzuweisungen ist sie nur vor dem Hintergrund ihrer Zeit zu verstehen, Kurzschlüsse aus heutiger Sicht sind fahrlässig. Eine weibliche Person wie sie, als eine ebenbürtige Intellektuelle, war in der damaligen Gesellschaft und in der damaligen Männerperspektive nicht vorgesehen, und es gab - gerade bei Ingeborg Bachmann - keine Vorstellung dafür, wie eine "Emanzipation" in den Fünfzigerjahren konkret umzusetzen wäre. Während ein Dichter wie Gottfried Benn, der diverse Liebschaften auch parallel unterhielt, damit als "homme à femmes" glänzend wegkommt, wird mittlerweile bei Ingeborg Bachmann etwas Haltloses suggeriert, mit vorschnellen Konstruktionen aus der Psychopathologie.
Dass von dieser Dichterin etwas Faszinierendes ausgegangen sein muss, wird auch in den Briefen Enzensbergers deutlich. Nach ihren gemeinsamen Tagen in Italien schreibt er atemlos, in kurzen Abständen, und erschrickt zugleich darüber. Es ist charakteristisch, wie sich Enzensberger aus dieser Situation, die er nicht mehr steuern zu können glaubt, zu befreien versucht. Er spricht von "deiner barschen abreise" (sie muss zurück zu Max Frisch, der erkrankt ist), und dann folgen merkwürdig klarsichtige, sehr bezeichnende Abgrenzungsversuche. Enzensberger betont die Unterschiede zwischen ihren literarischen Auffassungen. Die Aufforderung des "Cherubinischen Wandersmanns" von Angelus Silesius aus der Barockzeit, wonach der Mensch "wesentlich" werden müsse, habe er nie geteilt - das zielt mitten in Bachmanns Ästhetik.
Enzensberger provoziert auch damit, dass er gern Kinderreime und ähnliche Fingerübungen schreibe, und er polemisiert gegen Bachmanns Bestrebungen, nur "hinterlassungsfähige gebilde" im Sinne Benns zu produzieren, nur das zu schreiben, "was auch gedruckt werden" könne. Diese rigide Haltung zur Kunst "macht dir überhaupt das leben schwer", lautet seine Analyse. Das weist auf fast schon unheimliche Weise in die Zukunft.
Mit solchen Reflexionen, so lässt sich vermuten, schafft er es, eine Distanz zwischen sich und Bachmann zu schaffen und sich von der Affizierung zu lösen, die ihm durchaus zusetzt. Es gibt einige Passagen, die Enzensberger tatsächlich ungewohnt unironisch, ungeschützt zeigen. Sie sind eine beeindruckende poetologische Quelle. Enzensbergers Fähigkeit, Bachmanns Ästhetik, ihre Verschmelzung von Literatur und Leben genau nachvollziehen zu können und dies gleichzeitig für sich selbst zurückzuweisen, zeigt seine ureigenen Qualitäten auf bestechende Weise.
Die frühsommerliche Affäre des Jahres 1959 war von vornherein nicht auf Dauer angelegt, Enzensberger nennt es "unseren gemeinsamen pakt". Unter den Mechanismen des Literaturbetriebs leiden sie gleichermaßen, aber höchst unterschiedlich. Enzensberger macht es Spaß, sich ins Getümmel zu stürzen, einmal setzt er Bachmann auseinander, die Zeiten seien doch sehr günstig - "es geht uns gut!" Postwendend kommt ihre Antwort: "Es geht uns nicht gut." Sie quält sich in der gerade entstehenden Konsumgesellschaft, fühlt sich als "displaced person" - eine offizielle Bezeichnung vor allem für überlebende Juden direkt nach dem Krieg! - und sie meint bestimmt nicht die konkrete Person Enzensbergers, wenn sie einmal schreibt: "und ich fühle mich nur mehr sicher in der Liebe." Es ist ihre verzweifelte Utopie.
Enzensbergers Utopie scheint konkreter zu sein, sie hat mit Kuba, mit der Sowjetunion und dann mit dem Jahr 1968 zu tun. Es ist dennoch verblüffend, wie groß die politische Nähe zwischen den beiden ist. Ingeborg Bachmann hat bereits 1958 gegen die atomare Aufrüstung der Bundeswehr demonstriert, sie beteiligt sich an den Protesten gegen den Vietnamkrieg der USA und verabscheut die "Realpolitik" Henry Kissingers. Sie unterschreibt Resolutionen der Gruppe 47, macht Wahlkampf für die SPD Willy Brandts und trennt sich vom Piper-Verlag, weil dieser einen durch seine Aktivitäten in der Nazizeit diskreditierten Übersetzer beschäftigt.
Enzensberger kämpfte jahrelang darum, Gedichte von Bachmann ins "Kursbuch" drucken zu können
Bachmann zeigt sich zwar innerlich immer mehr zerrissen, sie sperrt sich gegen modische Politikströmungen, aber verficht umso offensiver ihre Kulturkritik. Sie hat Enzensbergers Zeitschrift "Kursbuch" keineswegs als eine "rabiate kulturkritische Umgebung" abgelehnt, wie der Herausgeber dieses Briefwechsels mutmaßt. Überhaupt betont er eine literarische Nähe zwischen den beiden Briefschreibern, die es so nicht gab, und spielt zugleich ihre politischen Gemeinsamkeiten herunter.
Sehr spannend ist der jahrelang währende Kampf Enzensbergers darum, einige späte Gedichte Bachmanns, die dem Schreiben von Lyrik eigentlich abgeschworen hat, im "Kursbuch" abdrucken zu können. Ihre vier berühmten Gedichte, die dann in der umstrittenen Nr. 15 im Jahr 1968 endlich erscheinen, haben eine bewegte literarisch-politische Vorgeschichte, mit zum Teil grotesken Arabesken und komödiantischen Einlagen. Einmal bekennt sie, an der "österreichischen Krankheit" zu leiden und fühlt sich "irresponsabel" - wie der "Schwierige" bei Hugo von Hofmannsthal, einem geheimen Bezugspunkt. "Die Schwierige" - einige Akte dieser ins Tragische kippenden Tragikomödie bietet auch dieser Briefwechsel.