Marcus Garvey, Panafrikanist, Politiker, Organisator einer Reederei, deren Schiffe die afroamerikanische Bevölkerung nach Afrika zurückbringen sollten, Charismatiker und dubioser Geschäftsmann, hatte vor hundert Jahren eine Vision: Wenn sich die Siebenen begegnen ("when the sevens clash"), wird es ein großes Chaos geben. Am 7.7. 1977 blieben daher in Jamaika, wo der ansonsten ein wenig vergessene Garvey sich vor allem bei den Rastafarians nach wie vor großer Beliebtheit erfreute, viele Geschäfte und Institutionen geschlossen. Die Gruppe Culture veröffentlichte daraufhin 1977 das Album "Two Sevens Clash", eines der einflussreichsten Reggae-Alben aller Zeiten, das auch für die kulturelle Konvergenz von Reggae und Punk in Großbritannien wichtig wurde. Der Filmemacher und Musiker Don Letts würdigte diesen Zusammenhang vor wenigen Jahren in einer Doku. Es ist einer der ganz wenigen großen Auftritte der Jahreszahl 1977, die sich Philipp Sarasin in seiner großen, enzyklopädischen Studie zu Wirkung und Nachwirkung dieses Jahres entgehen lässt.
John Dos Passos, Roger Martin du Gard und Alfred Döblin, also Säulenheilige modernistischer Prosa, haben Romane um Jahreszahlen gebaut, um Jahre wie 1914, 1918 und 1919, die von der Geschichtsschreibung längst als bedeutsam ratifiziert worden waren. Die zahlreichen Essayisten und Wissenschaftler hingegen, die es seit ein paar Jahren unternehmen, von einem einzelnen Jahr aus, Umwälzungen und Einschnitte zu kartografieren, die weit über dieses hinausgehen, suchen sich lieber exzentrische Einschnitte: 1913 (Florian Illies) oder 1926 (Hans-Ulrich Gumbrecht) sollen uns mehr zu sagen haben als die offensichtlichen Daten 1914 (Beginn des Ersten Weltkriegs) oder 1929 (Weltwirtschaftskrise). In dem für mich bisher überzeugendsten dieser Jahrbücher - "1967 - Pop, Grammatologie und Politik" von Robert Stockhammer - erklärt der Autor, mehr über 1968 im Jahre 1967 finden zu können, einem Jahr, das weder "Gegenstand der Geschichtswissenschaft" noch "Mythos" geworden sei, ein Jahr, in dem noch am Leben war, was im nächsten Jahr schon begradigt und mythifizierbar gemacht worden war.
Die "Talking Heads" servierten in ihrem Song "No Compassion" die kalte Absage an das Psycho- und Selbsterfahrungsgelaber der Zeit
Bei Sarasin kann eine solche Methode nicht am Werk gewesen sein. Die Entscheidung für 1977 muss nicht gegen Verdacht auf Originalitätszwang verteidigt werden. Das Jahr, in dem Punk auf allen Ebenen die kulturell dominierende Linke und ihre esoterischen Geschwister in der Hippiekultur entweder nihilistisch zurückweisen oder radikal überbieten wollte, zudem in Deutschland das Jahr von Stammheim, bietet sich fast zu sehr an, auch wenn man noch nie von der Prophezeiung Marcus Garveys gehört hat, sondern bisher nur das Album "Talking Heads 77" den Soundtrack zu dieser Umwälzung gespielt hat.
Doch Sarasin geht es nicht um einen Einschnitt. Er beginnt jedes Kapitel mit einem Nachruf auf eine 1977 gestorbene Persönlichkeit, von Anaïs Nin bis Ludwig Erhard. Sie stehen jeweils für Bereiche, die 1977 oft schon ein langes Leben haben, sei es die sexuelle Selbstverwirklichung oder die kapitalistische Wirtschaftspolitik. Damit scheint er die Lesart vom Wendejahr 77 selbst zu entkräften: Das alles gab es schon viel länger. Und tatsächlich macht er kein Hehl daraus, dass seine Entscheidung für das Jahr ziemlich beliebig war.
Es geht um alle möglichen kulturellen, medientechnischen, ökonomischen und politischen Entwicklungen, die nicht nur über eine lange Dauer verfügen, sondern in entscheidender Weise die Physiognomie der globalen Gegenwart prägen. Kalifornische Hippie-Esoterik beginnt ihren Erfolgszug spätestens mit der Gründung des Esalen-Instituts um 1960, das Internet entsteht je nachdem viel früher oder später als 77; um Hip-Hop schon 77 beginnen zu lassen, muss man hingegen einen Embryo von einer klandestinen Szene gewaltig aufblasen. Schwarze "Identitätspolitik" fängt dafür spätestens bei W.E.B. Du Bois im frühen 20. Jahrhundert an - und so fort.
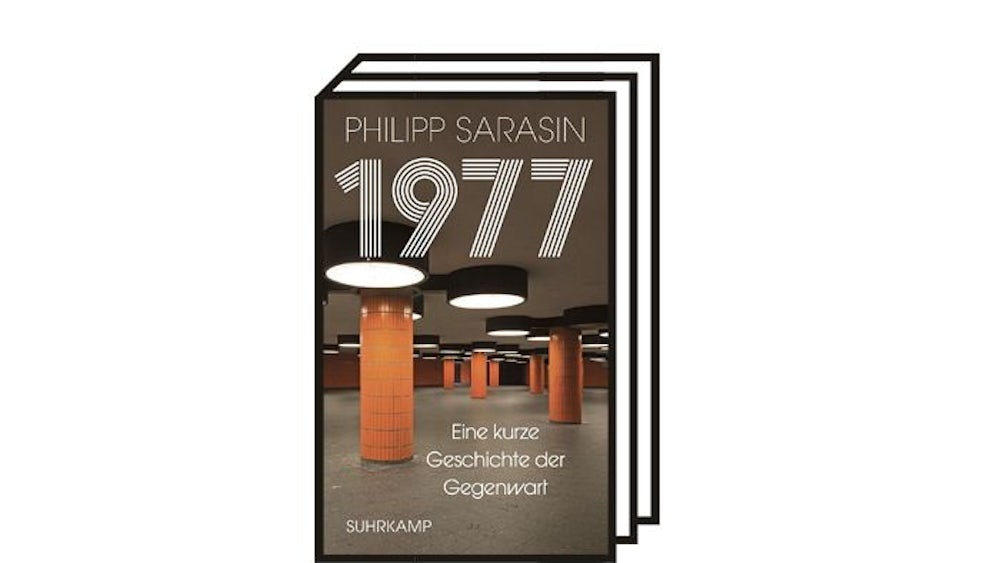
Die kontingente Aufladung von Sarasins Suche nach Anfängen und Vorläufern gegenwärtiger Lagen durch die dramatische, Spannung erzeugende Verengung der Perspektive auf ein einziges Jahr wird stattdessen geologisch begründet: Tiefenbohrungen sollen freilegen, was zu einem gegebenen Zeitpunkt gleichzeitig läuft. Und jedes hier freigelegte Flöz hat eben auch dramatische Momente im Jahr 1977. Von diesen berichtet der Schweizer Historiker und Foucaultianer dicht, engagiert - obwohl man nie genau weiß für was, und dieses Nichtwissen ist durchaus einer der Sogkräfte der Lektüre - und voller Pointen. Dabei besitzt er die Großzügigkeit, auch das Material auszubreiten, das seinen Behauptungen eher widerspricht. Es trägt aber auch ein bisschen zu einer gewissen Bröseligkeit der Erzählung bei, was sich andererseits natürlich ganz gut damit verträgt, dass die Zerbröselung der wohlbekannten "großen Erzählungen" seine übergeordnete Idee besser trifft als Einschnitt, Ende oder Untergang.
Ein Problem dieser vergnüglichen Tiefenbohrungen ist aber, dass die jeweils entdeckten Bewegungen und Verschiebungen auch eher geologisch konstatiert werden, als dass handelnde Subjekte auftreten, die das, was sie tun, für und gegen etwas unternehmen. Der mit viel Gespür zu Recht als symptomatisch hervorgehobene Song "No Compassion" von der erwähnten LP "Talking Heads 77" bleibt unvollständig erzählt, wenn man dessen kalte Absage an Psycho- und Selbsterfahrungsgelaber als ernstgemeinten Sozialdarwinismus liest und nicht ganz konkret als Angriff auf eine Kultur, die gerade hegemonial zu werden droht und die Sarasin ein paar Seiten weiter ebenfalls freilegt - die Therapie und Meditationswelt zwischen Buddha und Bhagwan. Würde er aus manifesten Gründen geführte Kämpfe sehen können und nicht nur das Auseinanderdriften des alten Allgemeinen, käme nicht immer wieder eine Nähe zum Kulturpessimismus auf, die ihm selbst erkennbar unangenehm ist und gegen die er auch immer wieder angeht.
Die Graffiti-Künstler machen sich lesbar, aber zu ihren Bedingungen, nicht zu denen von weißen französischen Soziologen
So referiert er durchaus zweifelnd Baudrillards Graffiti-Theorie, die Tags als Aufstände der Zeichen gegen jeden Sinn liest, die sich nicht auf reale Personen und Verhältnisse beziehen ließen. So stehen bei Sarasin dieser Aufstand und seine Unverständlichkeit in die Welt setzenden Separierungen und die Relativierung von Baudrillards Darstellung nebeneinander: Wollten die, die sich per bizarre Tag-Pseudonyme auf U-Bahn-Wagen eintrugen, nicht vielleicht doch ganz klassisch von sich und ihrer Existenz reden? Müsste man aber nicht viel weiter gehen? Baudrillard hat nicht nur übertrieben und zugespitzt, er liegt grundfalsch.
Solche Graffiti-Writer sind eben gerade nicht auf dem von Sarasin immer wieder beschriebenen Exodus aus dem Allgemeinen, sondern definieren als immer schon Ausgeschlossene ihre Beitrittsbegründungen: Erst mal brauchen wir eine neue Orthografie. Sie machen sich lesbar, aber zu ihren Bedingungen, die nicht das Wissen des weißen französischen Soziologen sein können. Schon 1969 erzählt der amerikanische Erziehungswissenschaftler Herbert Kohl in einem der ersten Texte, die je über Graffiti erschienen sind, von dem lernschwachen Johnny Rodriguez, der keine Sätze richtig lesen kann, wohl aber Hunderte Tags, Graffiti-Pseudonyme und Codes dechiffrieren und seinem Lehrer ihre Grammatik erklären kann.
Sich die Teilhabe am Allgemeinen zu eigenen Bedingungen zu erkämpfen ist nicht nur nicht dasselbe wie Essenzialismus und eine Politik des Identitären: Es ist das Gegenteil. Sarasin unterscheidet zwar afroamerikanische "Identitätspolitik" sorgfältig von rechtem Ethnopluralismus, sortiert jene aber dennoch bei Politik der Differenz ein. Dabei sind Bezugnahmen auf eigene (individuelle oder kollektive) Ausschluss- oder Benachteiligungserfahrungen seit Jahrhunderten das täglich Brot emanzipativer und damit aufs Allgemeine bezogener Bewegungen - nur dass sie nicht vom universalistischen Ideal ausgehen, sondern von dessen bezeichnenden Misslingen unter den konkreten Machtverhältnissen - um sich so aber in doppelter Negation wieder auf das Ideal zu beziehen.
Sarasin macht es sich allerdings im Einzelfall nie leicht und ist immer bereit, solche und andere Differenzierungen aufzunehmen. In diesem rundum spannenden Buch werden keine Großmütter für die Knackigkeit von Thesen verkauft. Im Hintergrund rumoren allerdings eher monolithische Grunddiagnosen. Über weite Strecken unterscheiden die sich nicht so sehr von dem, was man schon 1990 oder 2002 über die Zeit nach der Moderne, über Neoliberalismus, Gig-Ökonomie, Sub- und Nischenkulturen (die Vorläufer der Filterblasen) dachte.
Eher unverbunden treten später Problemhorizonte hinzu, die man als jüngere Reaktionen auf die rechten Machtübernahmen (Bolsonaro, Duterte, Trump, Putin, Erdoğan, Orbán) und die Pandemie deuten kann: dass die Gleichwertigkeit von wissenschaftliche Fakten und (religiösen oder verschwörungstheoretischen) Glauben mittlerweile durchgesetzt sei und dass selbst große Mächte von Personen und Institutionen gesteuert werden, die in einem epistemologischen Niemandsland leben. Doch kann man das nicht mehr dem Jahr 1977 in die Schuhe schieben, da müsste dann noch ein anderes Schwellenjahr her. Gegen die heute vorherrschende schlechte Alternative aus Neotraditionalismen (Evangelikalen, Trumpisten, Islamisten etc.) und neoliberalem, aufgeklärtem Zynismus könnte helfen, dass aus dem unter Wert als "Identitätspolitik" verkauften dekolonialen Denken eben kein Tribalismus und kein Ethnozentrismus geworden ist, sondern von Sylvia Wynter bis zu Saidiya Hartman ein neues Denken des Allgemeinen.

