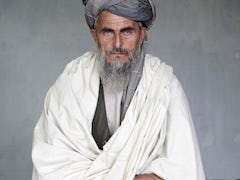Kurz nach dem 11. September und dem Kriegsbeginn in Afghanistan stieg das Thema "Frauen im Islam" in den USA und im Westen zu nationaler Wichtigkeit auf. Auf höchster Ebene wurde es zum ersten Mal thematisiert, als First Lady Laura Bush am 17. November 2001 eine Radioansprache hielt. "Zivilisierte Menschen auf der ganzen Welt sind entsetzt", sagte sie, "nicht nur, weil wir mit den Frauen und Kindern in Afghanistan mitleiden. Sondern auch, weil wir an Afghanistan sehen können, wie die Welt aussieht, die uns Terroristen aufzwingen würden . . . der Kampf gegen Terroristen ist auch ein Kampf für die Rechte und die Würde der Frauen."

Zwei Tage später gab Cherie Blair, die Frau des britischen Premierministers, ein ähnliches Statement ab. Angefeuert von diesen Stichworten begannen auch die Medien den Afghanistan-Krieg als Kampf für eine gerechte Sache darzustellen - für die Rettung der Frau.
Ein britischer Journalist schrieb, die Burka werde zur "Schlachtfahne", in den folgenden Monaten waren die Medien voll von Berichten über die Rechtlosigkeit von Frauen in Afghanistan, die im Subtext oft vermittelten, dass der Islam seit jeher Frauen unterdrücke. Vor allem die Verschleierung der Frau in jeder ihrer Formen - Burka, Hijab oder Niqab - wurde danach zur Staatsangelegenheit westlicher Nationen erklärt, Frankreichs Kopftuchverbot in den Schulen im Jahr 2004 markierte den Anfang.
Die Strategie, den Kampf gegen die Unterdrückung der Frau als eine Rechtfertigung für Krieg und Vorherrschaft einzusetzen, ist natürlich ein Trick, den vor allem britische und französische Imperialisten in der Vergangenheit schon häufig benutzt haben - gegen Muslime, Hindus oder wen auch immer. Es ist genau diese Rhetorik, die Gayatri Spivak in ihrem berühmter Satz so beschreibt: "Weiße Männer retten dunkelhäutige Frauen von dunkelhäutigen Männern."
Wer die Geschichte des Imperialismus kennt, war überrascht, dass dieser alte Trick wieder eingesetzt wurde - und noch überraschter, dass er tatsächlich funktioniert hat. Bald war es allgemeiner Konsens, dass unsere Truppen in Afghanistan seien, um die Frauen dort vor der Gräueltaten der Taliban zu schützen - Taten, die man dem Islam zuschrieb.
Feindselige Gefühle gegen den Islam
In meiner Forschungsarbeit untersuche ich die Folgen dieses Denkens: in Berichte muslimischer Frauen in Amerika im Kontext einer neuen Islamphobie, in der neuen Rhetorik zum Thema "Frauen im Islam" - und in der Flut an Büchern einer bestimmten Art, die in den vergangenen Jahren von Frauen mit muslimischem Hintergrund veröffentlicht wurden. Diese Bücher, die das Stereotyp der angeblich einzigartigen und schrecklichen Unterdrückung der Frau im Islam bestätigen, wurden tatsächlich sehr schnell zu Bestsellern.
Die heftige Kritik der Wissenschaft an diesen Büchern will zeigen, das die Sympathie für diese muslimischen Frauen sehr feindselige Gefühle gegen den Islam und islamische Männer hervorbringt - Gefühle, die dann wiederum eine muslimfeindliche Politik begünstigen. Bemerkenswert ist, dass eine Öffentlichkeit, die sich gern mit unterdrückten muslimischen Buchautorinnen solidarisiert, sich zugleich nicht daran stört, wenn unzählige muslimischen Frauen und Kinder bei den Kriegshandlung im Irak und in Afghanistan ihr Leben verlieren.
Wenn ich auf die Geschichte des Themas "Die Unterdrückung der Frauen im Islam" zurückblicke und untersuche, für welche Zwecke es heute benutzt wird, ist mein Fazit klar: Es ist an der Zeit, dieses Thema aus unserem Repertoire zu entfernen. Es ist tatsächlich nicht mehr als eine Rhetorik ohne Bedeutung und Inhalt, die wir aus imperialistischen Zeiten übernommen haben. Jetzt ist es Zeit, diese Rhetorik fallen zu lassen.
Es wäre offensichtlich absurd, wenn irgendjemand heute pauschal von der Unterdrückung der Frau durch das Christentum sprechen oder schreiben würde - und dabei die Situation von christlichen Frauen in Nigeria, Indien, Argentinien, Russland und Italien nicht weiter differenzieren würde. Genau so jedoch wird die Unterdrückung der Frau im Islam im gängigen Diskurs pauschalisiert. Tatsächlich aber unterscheiden sich die Lebensbedingungen muslimischer Frauen in Saudi-Arabien, im Iran, im Indonesien, in der Türkei, in Frankreich und in den USA stark voneinander - und es wäre nichtssagend, sie in einen Topf zu werfen.
Wenn ich sage, dass es Zeit ist, die überkommende imperialistische Rhetorik fallen zu lassen, leugne ich nicht, dass es im Islam Haltungen und Gesetze gibt, die Frauen tatsächlich schrecklich benachteiligen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Aspekte im Westen momentan zu stark betont werden. Es hilft nicht, den Islam generell zu verunglimpfen. Vielmehr muss man diese Gesetze und Sitten, die Frauen diskriminieren, einzeln und direkt bekämpfen.
Ein weiterer Aspekt, wie sich der 11. September auf die Situation der muslimischen Frauen in den westlichen Gesellschaften ausgewirkt hat, soll hier noch ergänzt werden - die Initiativen, die religiöse muslimischen Frauen im Westen und vor allem in Amerika derzeit ergreifen.
Diese Frauen, von denen viele den Hijab tragen, streben heute sehr aktiv nach Führungspositionen in muslimischen Organisationen. Sie reinterpretieren alte Texte, auch den Koran. Ihre Versionen fordern all jene heraus, die Männer ins Zentrum aller religiösen Interpretation stellen. Manche von ihnen entdecken alte Texte über den Hijab neu, schlussfolgern, dass er nicht zwingend sei - und bleiben doch überzeugte Muslime.
Sicherlich ist es denjenigen Frauen, die den Hijab tragen, klar, dass in den westlichen Ländern, in denen sich Frauen kleiden können, wie sie möchten, nicht mehr das Patriarchat herrscht, wie in den meisten Ländern mit muslimischer Mehrheit. Als ich Frauen zu diesem Thema interviewte, erklärte mir zum Beispiel eine, dass sie gar nicht glaube, dass der Hijab von der Religion vorgeschrieben sei; dass sie ihn aber trage, um die Menschen in unserer westlichen Gesellschaft auf sexistische Botschaften hinzuweisen - so zum Beispiel auf den Druck, so dünn sein zu müssen, dass es ungesund ist.
Stolz auf die muslimische Identität
Eine andere Frau erklärte mir, sie trage ihn aus demselben Grund, aus dem auch eine ihrer jüdischen Freundinnen die Jarmulke trage: er mache die Anwesenheit einer religiösen Minderheit sichtbar, die dieselben Rechte wie alle Bürger habe. Andere trugen den Hijab, um ihren Stolz auf ihre muslimische Identität auszudrücken - wie es in den sechziger Jahren die Afroamerikaner taten, die eine Afro-Frisur trugen.
Wenn nun in einigen europäischen Ländern die Diskussion darüber andauert, den Hijab zu verbieten, ist es wichtig daran zu erinnern, dass Verschleierungsverbote normalerweise Fehlzündungen waren. Dagegen haben wir jetzt in Amerika, wo es solche Verbote nicht gibt, eine Gruppe religiöser muslimischer Frauen, die nach eingängiger Lektüre des Koran den Hijab ablegen - weil sie zu dem Schluss gekommen sind, dass er für ihren Glauben irrelevant sei.
Die Autorin ist Professorin in Harvard. Ihre Bücher "Women and Gender in Islam" und "A Quiet Revolution. The Veil's Resurgence from the Middle East to America" untersuchen die Geschlechterdebatte in der arabischen Welt.
Aus dem Englischen von Antonia Kurz