Bonaparte - "Was mir passiert" (Columbia d/Sony Music)

"Wann ist ein Mann ein Mann?", fragt Tobias Jundt - und ergänzt die klassische Zeile sofort um die Frage "Wann ist eine Frau eine Frau?" Grönemeyers Hit ist jetzt 35 Jahre alt, aber plötzlich steht der Ohrwurm in neuem Kontext, und man fragt sich, hätte der Text nicht eigentlich immer schon so lauten müssen? So was kann Jundt, der seit Jahren als Bonaparte Berlin unsicher macht, gut: bekannte Versatzstücke von früher so einsetzen, dass daraus etwas ganz Heutiges entsteht. Er kann das sogar mit Menschen - im Song "Big Data" überlässt er Farin Urlaub und Bela B je eine Strophe, und so wie hier hat man die beiden Ärzte noch nie gehört. Von der punk-nahen Überdrehtheit, für die man Bonaparte - vor allem live - liebt, ist auf dem neuen Album "Was mir passiert" (Columbia d/Sony Music) nichts zu hören, stattdessen Gemurmel und versonnene Lebensbetrachtungen, Jundt singt darüber, wie er wartet, "dass der Sinn des Lebens mir begegnet". Am schönsten wird's, wenn er für "Dene wos guet geit" die Sängerin Sophie Hunger zum Duett bittet, zwei Schweizer unter sich. Manche der Songs sind an der Elfenbeinküste entstanden, gut zu hören, afrikanische Rhythmen, perlende Gitarren, immer etwas Fernweh drin, bis hin zum sonnenuntergangswarmen Abschluss "Is OK (Lieben For Life)".
Noel Gallagher's High Flying Birds - "Blackstar EP" (Sour Mash/Indigo)

Nächster Zwischenstopp im Gallagher-Großprojekt "Nachhaltige (Oasis-)Fan-Verstörung": Dancepop! Angedeutet hat sich das schon länger, in Songs wie "In The Heat Of The Moment" oder "Ballad Of The Mighty I". Jetzt hat Noel Gallagher, der Rockhymnen-Autor der Neunziger, mit der Single "Black Star Dancing" eine leicht verkratze Yacht-Rock-Verdichtung des Oeuvres von Sade veröffentlicht. Ein sanft geföhnter Disco-Hoppser mit klug ausgespartem Basspuls, Synthie-Geschwirr und ein paar zart zickigen Gitarren. Nutzerhinweis: Cabrio-Fahrt an der Côte d'Azur mit 30 Km/h. Höchstens. Dazu gibt es auf der gleichnamigen EP (Sour Mash/Indigo) einen Sechziger-Bossa auf gutmütigem LSD ("Rattling Rose") und mit "Sail On" so etwas wie ein Hipster-Seeräuber-Lied, das eine junge Frau im Batik-Trägertop singen sollte. Und zwei Remixes. Eine befremdliche Mischung, die dann aber von einer angenehm schwülen Wärme doch zusammengehalten wird. Irgendwie. Anders gesagt: Nach allem, was man über Musik von Menschen im fortgeschrittenen Pop-Alter so weiß, müsste "Black Star Dancing" eine 25-minütige Peinlichkeit sein. Noel Gallagher schert sich inzwischen aber mit derart routinierter Nonchalance so immens wenig um Dinge wie Peinlichkeit, dass er eine ganz neue Coolness entwickelt.
Calexico/Iron & Wine - "Years To Burn" (City Slang)

Es ist ein paar Jahre her, da veröffentlichte die Band Calexico einige Songs mit Sam Beam, der unter dem Namen Iron & Wine auftritt. Calexico und Iron & Wine gaben auch Konzerte zusammen, es war die Rede von einem Album. Jetzt, Jahre später, hat es doch nur zu einer zweiten EP gereicht. Zum Trost: Die siebeneinhalb Country-Songs auf "Years To Burn" (City Slang) verbreiten so viel Atmosphäre, dass man beim Hören die Zeit leicht vergessen kann. Zart gestreichelte Akustik-Gitarren, Sam Beams sanfter Gesang, ein sachtes Fließen aus Akkorden, in allem ein Hauch von Wüstenromantik. Man darf das Lagerfeuermusik nennen. Andererseits: Würde man das Album an einem Lagerfeuer hören, es könnte fast ein bisschen untergehen gegen das Knacksen der Holzscheite.
Two Door Cinema Club - "False Alarm" (Pias/Prolifica)

Vergangene Woche hat der große Neil Hannon mit The Divine Comedy ein etwas unbefriedigendes Album veröffentlicht, weil er sich plötzlich am Sound der Achtziger versuchte. Vielleicht hätte er sich am Two Door Cinema Club orientieren sollen. Die drei Musiker sind Nordiren wie er, sie machen genau die Art von Achtziger-Synthie-Pop, die Hannon im Hinterkopf hatte, aber sie bekommen den Sound verblüffend originalgetreu hin. Das neue Album trägt den passenden Titel "False Alarm" (Pias/Prolifica) und manchmal muss man unvermittelt lachen, weil alles so sehr nach Abifeier 1989 klingt. Aber wie es eben immer ist mit epigonaler Musik: Dass es alles schon mal gab, darf denen, die für die Originale zu jung waren, selbstverständlich völlig egal sein. Wen dieser Sound jetzt packt, den packt er eben jetzt, wer braucht da Diskussionen über Originalität und Anspruch. Aber es wäre schon ein Spaß, bei einem Konzert der Band mal heimlich "C'est La Vie" von Robbie Nevil (1986) über die Anlage laufen zu lassen - das Publikum würde keinen Unterschied bemerken.
Eagles of Death Metal - "The Best Songs We Never Wrote" (Eagles of Death Metal)

Die Eagles Of Death Metal waren mal eine amüsante Hardrock-Band, Fuzz-Gitarren und Falsettgesang, überdreht selbstironische Inszenierung, ein großer Spaß aus dem Umfeld der Queens Of The Stone Age. Dann das Konzert im Pariser Bataclan 2015, der Terroranschlag, all die Toten, all die Gewalt, all der unfassbare Hass. Plötzlich war die Band mehr als nur eine Band, sie wurde zum Symbol des Kampfs gegen den Terror. Das war viele Nummern zu groß für die Gaudibrüder. Und dann redete der Sänger Jesse Hughes in Interviews viel Unfug, verbreitete Verschwörungstheorien, und die Welt erkannte, was er immer schon war: ein ziemlich irrer Redneck und Waffenfreund. Bei der Wiedereröffnung des Bataclan 2016 verweigerten ihm die Betreiber den Einlass. Dann: Stille. Jetzt erscheint "The Best Songs We Never Wrote" (Eagles of Death Metal), das erste Studioalbum seiner Band seit damals. Vermutlich wusste niemand, wie man die richtigen Worte für dieses Comeback finden sollte, also wurde es eine Sammlung von Cover-Versionen. Mal ganz lustig (Mary J. Bliges "Family Affair" als Garagenrock), mal ziellos (Steve Millers "Abcadabra", einfach runtergeschrubbt), mal völlig uninspiriert ("High Voltage" in einer Rock-Version, die gegen das AC/DC-Original nicht den Hauch einer Chance hat). Als Vorlage für unbeschwerte Live-Konzerte wäre das alles schon in Ordnung - aber wie soll ein Konzert der Eagles Of Death Metal jemals wieder eine unbeschwerte Angelegenheit sein?
Madonna - "Madame X" (Universal Music)

Fast alle wollen Madonnas neues Album "Madame X" (Universal) mies, misslungen, peinlich finden. Dabei klingt sie zum ersten Mal seit Jahren so, als habe sie endlich wieder Spaß am Musizieren, am Ausprobieren, als habe sie - statt aus kreativer Ratlosigkeit dem aktuellen Charts-Sound hinterher zu hecheln - auf ihren inneren Groove gehört. Der sagte: Ja, okay, mach ein bisschen Trap, aber mach vor allem ein Weltmusik-Album ohne Weltmusik-Klischees. Mach so etwas wie "La Isla Bonita", erweitert um Portugal und Südamerika, Fado und Baile Funk. Mach etwas total Dystopisches ("Dark Ballet"!), aber vergiss nicht den Reggaeton mit dem hübschen jungen Papi, "one, two, cha-cha-cha". Na gut, nicht alles auf "Madame X" ist toll: In der ersten Strophe von "Killers Who Are Partying" betont Madonna, dass sie schwul sein will, wenn Schwule "verbrannt" werden und dass sie Afrikanerin sein will, wenn Afrika "dichtgemacht" wird. Ihre Empathie in allen Ehren: Man ahnt dann schon, dass Madonna, wenn der Refrain vorbei ist, auch noch Muslima, Israelin, missbrauchtes Kind und so weiter sein will. Listen in Songs abarbeiten: dramaturgisch fast immer unschlau! Aber "Madame X" ist endlich mal wieder ein Madonna-Album, an dem man sich so richtig abarbeiten, über das man gut streiten, das man hassen aber eben auch: verteidigen kann. Hier geht es zur ausführlichen Kritik.
Bruce Springsteen - "Western Stars" (Sony Music)

Weniger hemdsärmelig geschrabbelte E-Gitarren, dafür mehr sanft wogende Streicher und Bläser. Der dramatische Traditionsbruch, der hier und dort vermutet wurde (was dem Meister selbst sogleich die Ankündigung abverlangte, schon ganz bald wieder mit seiner E-Street-Band zusammenzuarbeiten), ist das 19. Studioalbum Bruce Springsteens dann doch nicht wirklich. Weiter beherrschen sehr wenige Sänger so vollendet die Kunst, nostalgisch zu sein, ohne die Vergangenheit zu verklären. Will man "Western Stars" (Sony) allerdings ganz uneingeschränkt genießen, hilft es, wenn man auch noch das Pathos sehr liebt, das bei diesem Stunt als Emoleim unverzichtbar ist.
Alle Farben - Sticker on My Suitcase (B1 Recordings)

Viele Reisende haben dank der Klimakrise inzwischen Flugscham, aber Frans Zimmer alias Alle Farben gehört nicht zu ihnen: "Sticker On My Suitcase" (Sony) heißt sein neues Album, weil er es schön findet, jeden Tag woanders aufzutreten und sich jeweils ein Andenken an die Stadt auf den Koffer zu kleben, "Barcelona, Copenhagen, Capetown", und so weiter. Man könnte sagen: Immer noch besser, wenn der Künstler zum Publikum fliegt, als wenn die Fans zu Tausenden zum Künstler nach Berlin fliegen. Aber auch dann würde es helfen, wenn er irgendwie interessante Musik machen würde! Auf dem neuen Album gibt es - von "Arrival" bis "Departure" - den üblichen Schnittmengen-Schema-F-Strahlemann-Tanz-Pop, der sich für den Sundowner in der Camp-David-Strandbar an der Ostsee genauso eignet wie für die Enthüllung des neuen SUVs auf der Automesse. Es ist Musik mit Ekstase-Anspruch, aber sehr viel heuligem Singsang, Kontrollverlust ausgeschlossen. Oder: Musik, die sehr aggressiv macht. Obwohl sie so nett gemeint ist. Und obwohl die Gastsängerinnen und Gastsänger, die scheinbar danach ausgewählt sind, dass sie jeweils ein bisschen so klingen sollen wie Stars aus den Charts, nichts falsch machen. James Blunt singt auch mit. "What Was I Drinking?", heißt ein Track, und es kann nichts mit Alkohol gewesen sein. Tomatensaft?
Juju - "Bling Bling" (Jinx Music)

Bei SXTN fragten sich ja immer alle: Ist das jetzt feministisch und cool, wenn zwei junge Frauen genau dieselben Schimpfwörter benutzen und Prol-Posen performen wie die Machorapper? Oder reaktionär? Oder nur doof? Auf jeden Fall hatten die beiden sichtlich Spaß beim Verstören des Publikums - und Ermächtigung reimte sich bei ihnen hervorragend auf Gemächt. Dann kam die Trennung und nun erscheint "Bling Bling" (Jinx Music), das Debütalbum von Juju, die schon vergangenes Jahr gemeinsam mit Capital Bra einen Hit landete ("Melodien"). Was soll man sagen? Da sind die Trapbeats, da sind die Posen, da ist - wohl eine Pointe der Dialektik des Rumgangsterns - sogar Henning May von AnnenMayKantereit, der René Pollesch als biodeutsches Authentizitätsscheusal in seinen Alpträumen verfolgen könnte. Und da ist jede Menge charttaugliche, menschenfreundliche Stinkefingerigkeit. Die besten Punchlines sind schließlich die, die über sich selbst zu lachen scheinen. Und im Jahr 2019 noch Songs zu machen, die das Saufen feiern, ist ungefähr so zeitgemäß wie filterlose Gitanes auf Kette und hat schon deshalb Respekt verdient. Wer dann noch Zeilen wie "vielleicht muss ich mich bald runterficken / weil sonst heb ich ab" rappt, dem - pardon: der - mögen alle Herzemojis der Welt zufliegen.
Kate Tempest - "The Book of Traps and Lessons" (Republic Records)
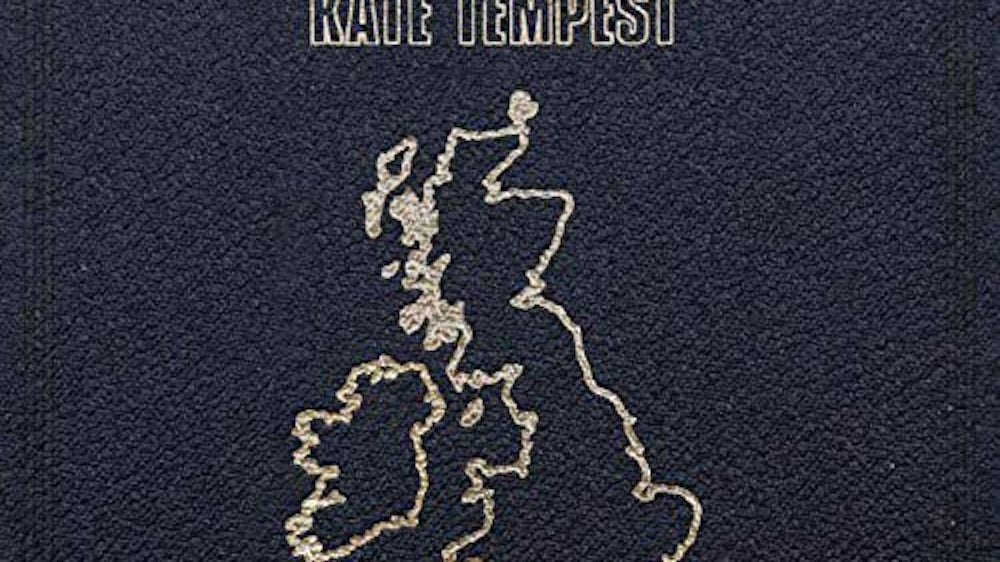
Liebe, soviel ist sicher, durchdringt fast jede Zeile von Kate Tempest - und sei es als Mangel. Tempest öffnet die Sprache, nimmt sie auseinander und fügt sie, von ihrer Stimme fein nuanciert, zu einer welthaltigen Poesie zusammen, haltbar gegen die realexistierende Welt. Mit "The Book of Traps and Lessons" (Republic Records), produziert von Rick Rubin und zum großen Teil schon vor ihrem vorangegangenen Album entstanden, blickt sie nach Innen, auf die Momente der seelischen Leere, der gefährdeten Liebe, des "Trotzdems". Ein bißchen Anti-Konsum-Predigt und Pathos der melancholischen Revolutionärin gibt es zwar auch. Aber wenn sie über immer heller und weltallkälter kreiselnde Synth-Arpeggien "my ears have grown numb to the Song in All Things" klagt, glaubt man ihr jedes Wort. Und da draußen ist immer noch Trost: "Even when I'm breaking / I stand weeping at the train station / `cause I can see your faces // I love peoples faces".