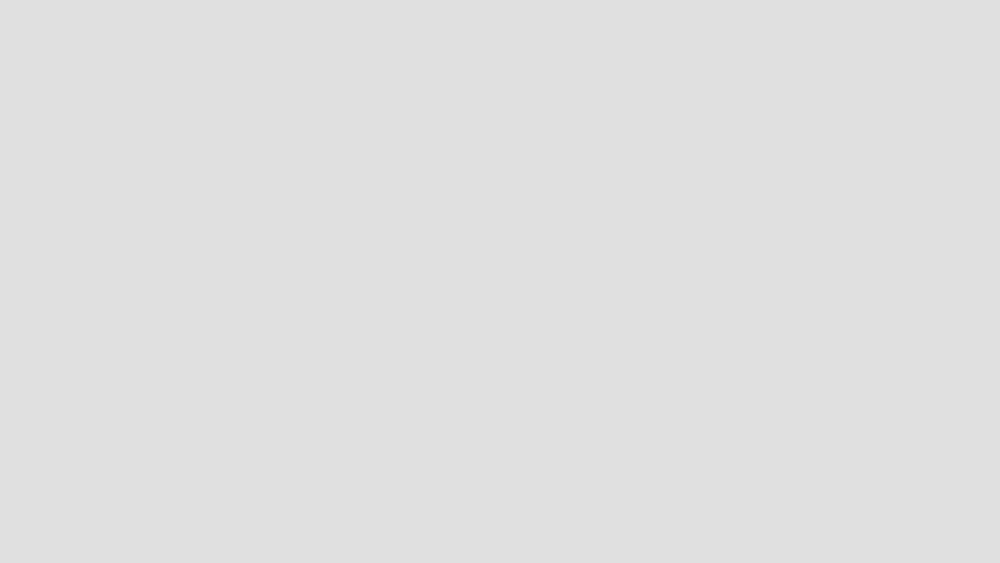Filmregisseure müssten ihnen besonders dankbar sein, sind sie doch das ideale Requisit, um menschliche Begegnungen zu inszenieren. In fast jeder Jane-Austen-Verfilmung legt der Besucher seine Karte aufs Silbertablett, das ihm der Butler an der Tür reicht. Sie wird dann umständlich als Passierschein bis zur Herrschaft weitergetragen. Oder jene Szene in "American Psycho", in der die jungen Wallstreet-Snobs am Konferenztisch erst ihre Maßanzüge vergleichen und sich dann streiten, welche ihrer Business Cards die edlere Typografie hat und den geschmeidigeren Beigeton ("Eierschale" oder "Knochen"). Am Ende triumphiert "zartes gebrochenes Weiß plus Wasserzeichen".
Visitenkarten haben einen zeitlosen Charme
Doch auch in profaneren Kreisen und Situationen sind Visitenkarten nach wie vor unentbehrlich. Kaum eine geschäftliche Zusammenkunft, und mag sie noch so locker ablaufen, in der nicht irgendwann er in die Brust- oder sie in die Handtasche greift und ein Kärtchen zückt.
Aber wie kann das überhaupt noch sein, heutzutage, im digitalen Zeitalter, wo man Geschäftskontakte ratzfatz über Netzwerke wie LinkedIn oder Xing einsehen und austauschen kann, wo nur noch gewischt und getippt wird, wo alles Papierene und Gedruckte wie von gestern wirkt? Weil Visitenkarten einen zeitlosen Charme haben. Sie zu reichen, ist ein diskreter Akt. Er ersetzt die heikle Frage nach der genauen Position in der Firma, die Antwort liegt sogleich buchstäblich auf der Hand - genauso wie der akademische Grad und die Schreibweise des Namens.
Die beiläufige Art der Kommunikation
"Visitenkarten ermöglichen es, auf sehr schnelle und beiläufige Art zu kommunizieren und viele Informationen gleichzeitig zu geben und zu bekommen", erklärt Ludwig Eichinger, "ohne sich aufzudrängen und ohne penetrant sagen zu müssen: Notieren Sie sich mal meine Adresse." Eichinger ist Germanist an der Universität Mannheim und Direktor des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim. Zu seinen Studien zählen auch die kulturellen Aspekte der im Durchschnitt 85 mal 45 Millimeter großen Kärtchen.
Die Spuren des digitalen Zeitalters
Sie bleiben ein gefragter Bestandteil des Geschäftslebens. Der Kommunikationsdesigner Peter Ostenrieder, der in seiner Agentur im oberbayerischen Peiting auch Visitenkarten entwirft, kann das bestätigen: Die Auftragslage sei seit Jahren stabil.
Trotzdem hinterlässt das Digitalzeitalter seine Spuren auch auf den bedruckten Kärtchen - einfach weil der vernetzte Mensch aus immer mehr einzelnen Kontaktdaten besteht, was den Gestaltern wiederum immer mehr Kopfzerbrechen bereitet: "Früher gab es nur Postadresse und Telefonnummer", sagt Ostenrieder, "inzwischen gibt es Angaben zu E-Mail und allen möglichen sozialen Netzwerken." All diese Einzeldaten muss er nun irgendwie gut lesbar und übersichtlich unterbringen.
Immer mehr Informationen - das gehe auf Kosten so mancher optischer Gags, meint Ostenrieder. Gott sei Dank, möchte man sagen, die Zeiten, in denen die Karte mit aller Gewalt die Branche wiedergeben sollte (die Fischstäbchenform für den Tiefkühlkostvertrieb, die Trompeten-Umrisse beim Orchestermitglied), haben sich überlebt. Schnickschnack wird seltener, und auch das Foto des Inhabers auf der Rückseite ("oft peinlich", so Ostenrieder) wird heute lieber mit einer Anfahrtsskizze ersetzt.
Eben weil sie ein papierenes Alleinstellungsmerkmal bekommt, verlangen die Auftraggeber nach Edlerem: Karten, die stärker, stabiler sind, die sich rauer anfassen oder aufgemotzt sind mit Lackierung oder Sperrholz. "So etwas hebt sich der Empfänger auf, die wagt man nicht wegzuschmeißen. In Asien gilt die Visitenkarte als zweites Ich, das man beim Kunden oder Geschäftspartner hinterlässt", sagt Ostenrieder, dahin gehe auch bei uns der Trend.
Die Ursprünge liegen in China. Oder doch in Ägypten?
Ach ja, Asien, die Region, in der die Kärtchen Kultcharakter haben. In Japan übertrifft das strenge Reglement des Kartenaustauschs das einer Teezeremonie (nur mit beiden Händen geben und nehmen, keinesfalls ungelesen weglegen und schon gleich gar nicht in die Hosen- oder gar Gesäßtasche stecken). In China des 15. Jahrhunderts soll ihr Ursprung liegen, heißt es, manche Historiker wähnen ihn auch im Alten Ägypten. Jedenfalls ging es seinerzeit immer darum, seinen Besuch (französisch "Visite") per Karte anzukündigen.
Im 17. Jahrhundert wurden die "Besuchskarten" dann auch im französischen Adel üblich, schnell an allen europäischen Höfen, versehen mit Namen und Adresse - für den Fall des Gegenbesuchs. Man übergab sie dem Diener, der sie dann auf einem Tablett der Dame oder dem Herrn des Hauses überbrachte.
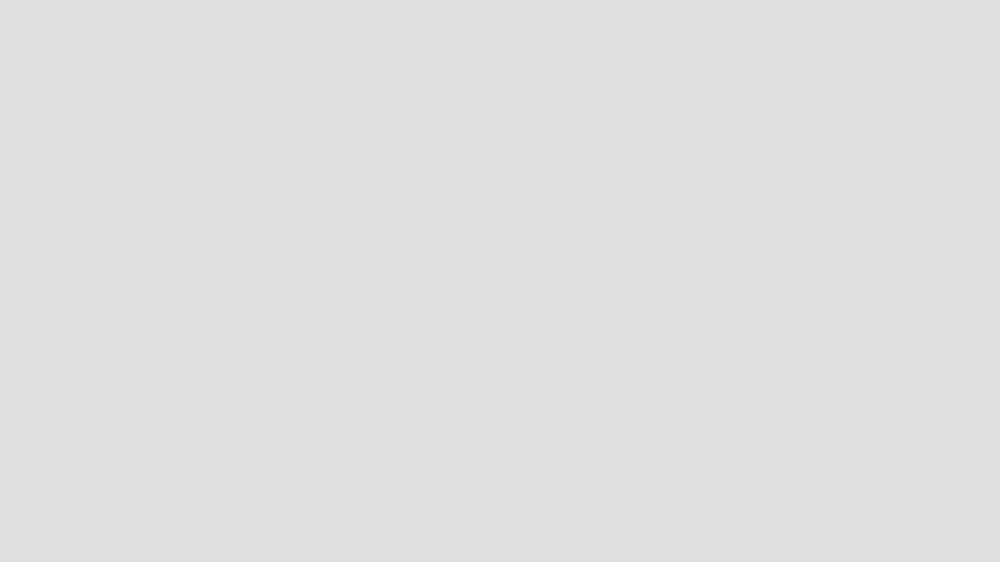
Die - vermeintliche - Bedeutung der eigenen Person stand im Vordergrund, und dieser Zweck hält sich bis heute. In vielen Firmen gelten sie nach wie vor als unentbehrlich für die Corporate Identity. Visitenkarten stärken das Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter, sie sind gut für Unternehmenskultur und Wir-Gefühl - und somit für die Motivation.
Früher ging es um Präsentation, heute um Erreichbarkeit
Aus diesem Grund legt Ludwig Eichinger als Direktor eines wissenschaftlichen Instituts mit 110 Mitarbeitern großen Wert darauf, jeden Neuling sofort mit einem Satz Karten auszustatten. "Früher ging es darum, die Person zu präsentieren in ihrer Hauptfunktion", erklärt Eichinger, "heute spielen echte Kontaktaufnahme und Erreichbarkeit eine Rolle."
Scherzkekse, die "Lebenskünstler" unter den Namen drucken, oder, wie es Facebook-Gründer Mark Zuckerberg laut Economist vorübergehend tat, "I'm CEO, bitch", haben längst, nun ja, schlechte Karten. Wer es besonders elegant und diskret mag, hat eh zwei Sätze: einen für berufliche Bedürfnisse, mit allen Funktionen und Titeln. "Aber das ist im halb-offiziellen, privaten Kontext übertrieben", sagt der Germanist Eichinger, "oft genug geht es einfach nur darum, wer man ist. Da reicht der Name." Bei der zweiten, privaten Variante fügt man je nach Bedarf und Gegenüber eben per Notiz Infos hinzu.
Visitenkarten haben eine Zukunft
Mit manchen Apps kann man virtuelle Business Cards austauschen, "Bump" heißt eine solche. Mit anderen scannt man Karten sofort ein und sortiert sie auf dem Smartphone. Solche Apps kommen und gehen, die Papierkärtchen bleiben. Wird es sie in zehn Jahren noch geben? Ja, meinen sowohl der Wissenschaftler wie der Praktiker. "Allein durch die Globalisierung nimmt die Verwendung zu", sagt Eichinger, "wir kommen stärker in Kontakt mit Ländern, die eine ausgeprägte Visitenkartentradition haben."
Business Lunch, Konferenz oder eben Handschlag plus Kartentausch: In einer Geschäftswelt, in der immer mehr digital und anonym abläuft, kommt der persönliche Kontakt einem Vertrauenstest gleich. "Mit der Karte gebe ich meinem Gegenüber eine Wertigkeit, und zwar physisch", sagt Ostenrieder. Und dann ist da noch ein Vorteil: Sie braucht keinen Strom. Das Handy mag den Datentransfer verweigern, weil der Akku leer ist, die Visitenkarte lässt sich immer zücken.