Am Anfang waren es nur zwei - die ängstliche Shirley und die lustige Peggy Lou. Die Woche darauf stellte sich Vicky in der psychoanalytischen Praxis vor und berichtete wiederum von Peggy Ann. Doch die Therapeutin Cornelia Wilbur fragte immer weiter: Gibt es noch mehr Persönlichkeiten? Was ist sonst noch in Ihrer Kindheit passiert? Und so zählte Wilbur schließlich 16 verschiedene Persönlichkeiten, die alle im Gehirn ihrer zu Beginn der Therapie 30-jährigen Patientin Shirley Mason lebten und sich abwechselnd zu Wort meldeten. Sie seien entstanden, so vermutete Wilbur, als Reaktion auf bizarre Misshandlungen und sexuelle Übergriffe in der Kindheit.
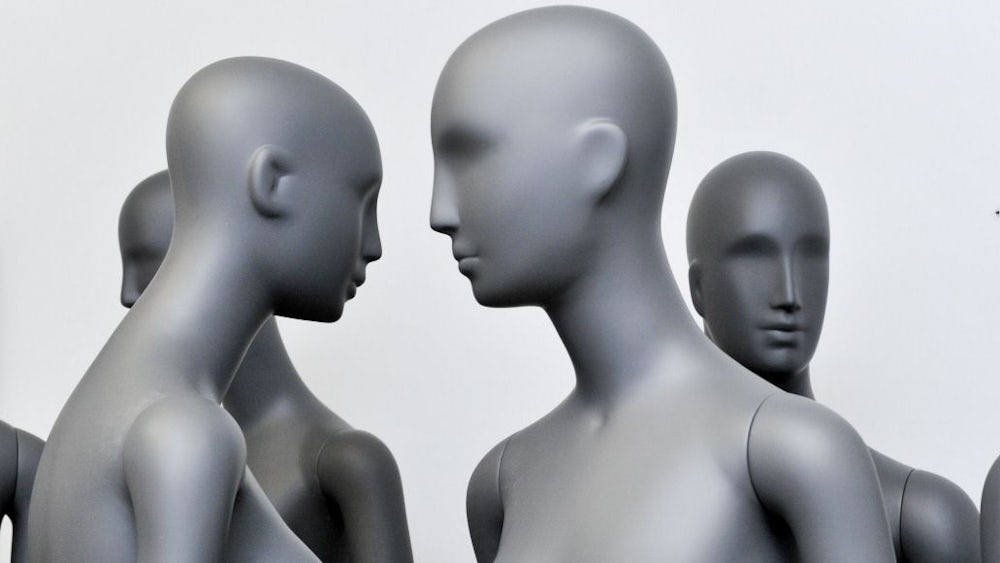
Die Geschichte von "Sybil" - so das Pseudonym der Patientin - wurde eine der berühmtesten und einflussreichsten Erzählungen der modernen Psychiatrie. Ihr Leben wurde als Roman und als Spielfilm unter das Publikum gebracht. Vermutlich trugen die Werke mit dazu bei, dass die sogenannte multiple Persönlichkeitsstörung 1980 Eingang in den offiziellen psychiatrischen Diagnosekatalog fand und dann eine steile Karriere machte: Bis 1980 fanden sich in der Fachliteratur gerade einmal 200 Fälle, deren Symptomatik unter Umständen zu der neuen Erkrankung passen könnte. Sechs Jahre später waren allein in den USA 6000 Menschen als gespaltene Persönlichkeiten diagnostiziert.
Doch hat die Geschichte von der zersplitterten Seele der Sybil einen entscheidenden Nachteil: Wahrscheinlich hat sie sich nie so abgespielt, wie es später von ihrer Analytikerin berichtet worden war. Bereits 1994 hatte Herbert Spiegel, der Shirley Mason ebenfalls gelegentlich behandelt hatte, erste Zweifel angemeldet. Jetzt wirft die amerikanische Autorin Debbie Nathan in ihrem Buch "Sybil exposed" einmal mehr die Frage auf, was jenseits von Beeinflussung und Nachahmerei an dieser so erstaunlichen Symptomatik überhaupt dran ist. Könnte es wirklich sein, dass es Erkrankte mit mehr als 4000 Persönlichkeiten oder -fragmenten gibt, wie der frühere Vorsitzenden der internationalen Gesellschaft für das Studium von Trauma und Dissoziation, Richard Kluft 1988 berichtete? Sind die Berichte über Patienten, die Hunde, Panther, Schildkröten oder Hummer als Teile ihrer Persönlichkeit betrachteten mehr als bizarre Possen?
Solche Beschreibungen waren Steilvorlagen für die Kritiker der Diagnose, denen die Multiple Persönlichkeitsstörung ohnehin nur als Hirngespinst galt, entsprungen aus dem unglücklichen Zusammentreffen von kulturell beeinflussten Patienten und bewusst oder unbewusst manipulierenden Therapeuten. Für pure Phantasieprodukte hielten sie sowohl die separaten Persönlichkeiten als auch die traumatischen Kindheitserlebnisse, die als Ursache der Störung gelten. Auf der anderen Seite fochten Ärzte und Psychologen für ihre Überzeugung, wonach die Spaltung in verschiedene Persönlichkeitsteile ein genuiner Prozess ist, eine Überlebensstrategie für Menschen, die als Kind verheerender Pein ausgesetzt waren. Der Streit erfasste auch Patienten: Manche zogen gegen ihre mutmaßlichen früheren Peiniger vor Gericht, andere verklagten ihre Therapeuten, weil sie sich von ihnen in groteske Biographien hineingedrängt fühlten.
Heute ist es um die Erkrankung stiller geworden. Doch unbemerkt vom öffentlichen Interesse, so Christian Schmahl vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, ist die Krankheit nach wie vor da, allerdings weniger spektakulär als Laien sich das lange vorgestellt haben.
Quälende Gefühle der Entfremdung
Fachleute nennen sie heute Dissoziative Identitätsstörung. Darunter verstehen sie allerdings in den allermeisten Fällen nicht die an Rollenspiele erinnernden Auftritte, wie Sybil sie geschildert hat. "Fälle, in denen Patienten Dutzende Persönlichkeiten mit komplett unterschiedlichem Aussehen und Gebaren präsentieren, gab und gibt es - wenn überhaupt - nur extrem selten. Da wurde früher sicher einiges übertrieben", sagt Schmahl. Dass aber Patienten das Gefühl haben, über verschiedene Persönlichkeitsanteile zu verfügen und quälende Gefühle der Entfremdung erleben, dass unterschiedliche Gedächtnisinhalte getrennt voneinander existieren, sehe man in der Praxis sehr wohl. Die therapeutische Erfahrung zeige zudem, so Schmahl, dass diese Patienten von wiederholten Traumatisierungen berichten.
Auch Harald Freyberger, Direktor der psychiatrischen Klinik der Universität Greifswald, hält die Trauma-Theorie für "ein valides Konzept". Unter extremer Belastung könne der Mensch Gefühl und Verstand voneinander trennen. Er könne Teile seines Gedächtnisses, seiner Wahrnehmung oder seines Identitätsgefühls von seinem Bewusstsein abspalten. Doch heute seien diese Symptome weniger stark ausgeprägt als früher, zum einen, weil der Umgang mit Missbrauch und Misshandlungen offener geworden ist: "Die Patienten sind eher bereit über solche Erfahrungen zu sprechen, damit gelingt die Integration der abgespaltenen Funktionen leichter." Zum anderen auch, weil Therapeuten heute mehr Erfahrungen mit dissoziativen Störungen haben.
Denn, so kommen Freyberger wie Schmahl den Kritikern ein Stück entgegen, Therapeuten können die Spaltungen verstärken, sei es aus Faszination über die seltene Erkrankung, sei es aus dem Versuch heraus, separate Persönlichkeitsteile einzeln zu therapieren. Dies passierte vor 30 Jahren häufiger als heute, sagt Freyberger, und dürfte zur Genese der spektakulären Fälle beigetragen haben.
Auch wenn die Positionen versöhnlicher und die Debatten sachlicher geworden sind, gibt es noch immer Fachleute, die gänzlich an der Existenz der Krankheit zweifeln. Komplett ausräumen kann man ihre Einwände schwerlich, denn noch immer beruhen Erkenntnisse über die Störung eher auf klinischer Erfahrung denn auf belastbarer Forschung.
Nach wie vor ist nicht einmal klar, wie verbreitet die Erkrankung überhaupt ist. "Saubere Erhebungen zur Häufigkeit gibt es nicht", sagt Freyberger. Bildgebende Untersuchungen haben in den vergangenen Jahren Hinweise auf abweichende anatomische Merkmale und Funktionsweisen im Gehirn von dissoziativ Erkrankten erbracht. Doch differieren sowohl Untersuchungsmethoden als Ergebnisse so stark, dass man kaum allgemeingültige Erkenntnisse ableiten kann.
Spekulativ bleibt auch, was die enorme Faszination an der Diagnose hervorgerufen hat. Christian Schmahl hält die damaligen psychiatrischen Erklärungsmodelle für mitverantwortlich. Betrachtet man heute auch biologische Gegebenheiten wie die Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen als Ursache für psychiatrische Leiden, fokussierte man sich Ende des vergangenen Jahrhunderts vor allem auf soziale und lebensgeschichtliche Faktoren. Unter ihnen waren Traumatisierungen besonders populär. Bei Patienten und Laien konnte so der Eindruck entstehen, dass eine schwere Symptomatik zwangsläufig schwerwiegende Ursachen haben müsse und umgekehrt und so in einen Kreislauf immer spektakulärerer Entwicklungen münden.
Debbie Nathan, die das aktuelle Buch über den Fall Sybil geschrieben hat, greift angesichts der Tatsache, dass vor allem Frauen von den Spaltungsprozessen betroffen waren, zu einem eher feministischen Erklärungsansatz: Die neuen Möglichkeiten der Familienplanung und des beruflichen Aufstiegs stürzten Frauen damals in derartige Identitätskrisen, dass sie in der gespaltenen Persönlichkeit ihre Metapher erkannten.
Sicher scheint dagegen, dass die Diagnose fortbestehen wird. Bei der aktuellen Überarbeitung des amerikanischen Diagnosekatalogs DSM IV ist vorgesehen, mehrere Krankheitsbilder aus dem Standardwerk herauszunehmen. Die Dissoziative Identitätsstörung steht nicht auf der Streichliste.