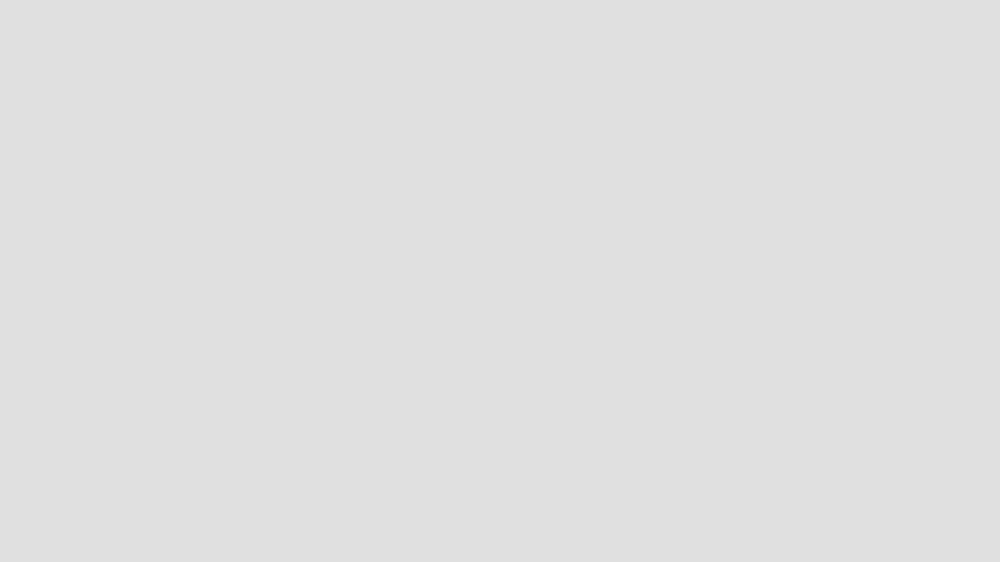Diese Wette kann man gar nicht verlieren: Redet ein hochrangiger Bank-Manager vor Publikum über seine Branche und sein Institut, wird er irgendwann - meist schon in der ersten Hälfte seiner Ausführungen - das Wort "Vertrauen" nutzen, und er wird dabei sehr ernst schauen. Vielleicht wird er nach der Passage eine kleine Kunstpause einlegen, um die Bedeutung des Gesagten zu unterstreichen, aber das ist nicht garantiert. Dass jenes Wort fällt, ist hingegen so sicher, dass man darauf unbesorgt wetten kann, zur Not auch mit geliehenem Geld.
Der Bankentag in Berlin in dieser Woche machte da keine Ausnahme; Jürgen Fitschen, Co-Chef der Deutschen Bank und Präsident des Bundesverbands deutscher Banken, erwähnte "Vertrauen" elfmal in seiner Rede und schlug damit Bundespräsident Joachim Gauck deutlich. Der hatte das Branchentreffen zuvor mit einer Ansprache eröffnet und darin das V-Wort lediglich viermal genutzt.
Der inflationäre Gebrauch des Begriffs ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt, dass es an Vertrauen mangelt. Die Banker erklären, wie wichtig Vertrauen in ihre Institute ist und dass sie es wiedergewinnen wollen. Da haben sie noch einiges vor sich: Die Wirtschaftsprüfer von EY, früher Ernst & Young, veröffentlichten zum Bankentag eine Umfrage, derzufolge vier von zehn Deutschen sagen, dass ihr Vertrauen in die Finanzkonzerne in den vergangenen zwölf Monaten weiter gesunken sei.
Manchmal ist Misstrauen gesünder
Sieben Jahre ist es schon her, dass mit der Beinahe-Pleite der Bank IKB die Finanzkrise in Deutschland ankam. In der Folge gelobte die Branche Besserung, Institute verordneten sich einen Kulturwandel - ein anderes inflationär genutztes Wort in Banker-Reden -, aber die Bürger haben den Glauben in die Banken verloren. "Vertrauen ist eine zarte Pflanze. Ist es zerstört, kommt es sobald nicht wieder", wusste schon der eiserne Kanzler Otto von Bismarck.
Es ist logisch, dass sich Bankmanager mehr Vertrauen ihrer Kunden wünschen. Eine ganz andere Frage ist, ob dies auch aus Sicht der Kunden, der Gesamt-Wirtschaft und der Politik erstrebenswert wäre. Vertrauen ist nicht immer der beste Ratgeber, manchmal ist Misstrauen gesünder. Und das süße Gerede vom Kulturwandel ist gefährlich, denn es könnte Bürger, Regierungen und Aufseher einlullen: "Seht her, wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt" - das ist die Botschaft aus den Chefetagen der gläsernen Bankentürme. "Wir haben uns geändert, wir tragen selbst dafür Sorge, dass sich so etwas wie die Finanzkrise nicht wiederholt. Man kann uns wieder vertrauen."
Doch kann man das wirklich?
Blindes Vertrauen muss man sich erst mal leisten können
Kunden sollten sich in jedem Fall ihr Misstrauen gegenüber Banken und dem hilfsbereiten Bankberater bewahren. Auch die Aufsichtsbehörden sollten Finanzkonzernen weiter mit einer guten Portion Argwohn begegnen. Denn wenn es ein erfreuliches - aber entsetzlich teuer erkauftes - Ergebnis der Finanzkrise gibt, dann jenes, dass Politik, Kontrolleure und Kunden heute Banken im Prinzip jede Schurkerei zutrauen.
Der naive Glaube vieler Deutscher, der Bankangestellte sei ein uneigennütziger Samariter der Geldanlage, einzig am Wohle seines Gegenübers interessiert, hat sich dank der Skandale der vergangenen Jahre verflüchtigt: etwa durch das Debakel mit Lehman-Zertifikaten, die vielen anderen Gerichtsverfahren wegen Falschberatung oder die Enthüllung, dass Banken über Jahre den wichtigen Libor-Zinssatz manipulierten.
Kontrolleure und Regierungen wiederum haben durch die Krise gelernt, welch zerstörerische Kraft vertrauensselig regulierte Banken entwickeln können - und wie kostspielig die Aufräumarbeiten nach dem großen Knall sind. Blindes Vertrauen muss man sich erst mal leisten können.
Kulturwandel ist nun die neue Wunderwaffe
Die Banken-Vorstände hingegen sehen den Mangel an Vertrauen als ernstes Problem an, im Manager-Sprech würde man wohl sagen: als Herausforderung. Investorenlegende Warren Buffett hat Kreditderivate, jene undurchsichtigen Wertpapiere, welche die Finanzkrise befeuerten, einmal als "Massenvernichtungswaffen" bezeichnet. Um im militärischen Jargon zu bleiben: Kulturwandel ist nun die neue Wunderwaffe, mit der Banken wieder Vertrauen schaffen wollen. Um wieder als respektable Partner im Geschäftsleben zu gelten, um gute Beziehungen zu Kunden, Aufsehern und Politikern aufzubauen.
Ob Deutsche Bank oder Commerzbank in Frankfurt, ob Barclays, Lloyds und Royal Bank of Scotland in London - die Großen der Branche kappen riskante Geschäfte und schwören die Belegschaft auf eine andere, bessere Firmenkultur ein. Statt kurzfristigem Gewinn und Provisionen sollen wieder das Wohl des Kunden und der Dienst an der Gesellschaft - sprich: die Versorgung der Wirtschaft mit Krediten - im Vordergrund stehen. Dies wird der skeptischen Öffentlichkeit gerne und oft erklärt; die Commerzbank ließ für diesen wichtigen Teil der Übung eine Hamburger Filialleiterin in teuren Werbespots durch die Stadt joggen und sich dabei selbstkritische Fragen stellen. Beim Laufen kommen einem eben manchmal die besten Ideen.
In den Jahren vor der Krise nannten sich manche internationale Top-Banker ganz unbescheiden "Masters of the Universe", nun müssen die Manager in einer Art branchenweitem Taufgelöbnis dem Teufel Gier und allen seinen Werken und seinem ganzen Wesen entsagen. Diese Reinigungsrituale sind aufwendig, bei manchen Konzernen bleibt kein Stein auf dem anderen, ganze Abteilungen werden geschlossen.
Die neue Konzernkultur wird den Beschäftigten in ausgefeilten Seminaren nahegebracht, die Royal Bank of Scotland hat sogar ein Programm aufgelegt, bei dem Mitarbeiter einen Tag bei Firmenkunden mitanpacken. Der Bankberater räumt im Supermarkt Regale ein - und bekommt so ein viel besseres Gefühl dafür, wie es dem Kunden ergeht und was seine Bedürfnisse sind. Das klingt alles ganz sympathisch - und ist doch ziemlich banal.
Vor der Krise gingen Banker, von der Gier nach Boni getrieben, riskante Deals ein, die ihr Institut und die ganze Finanzwirtschaft an den Rand des Kollaps brachten. Und nun fahren diese Konzerne jene Geschäfte herunter, verordnen sich langfristig orientierte Prämiensysteme und propagieren eine Firmenkultur ohne halsbrecherische Spekulationen. Angesichts der Erfahrungen der vergangenen Jahre ist das eine betriebswirtschaflich sinnvolle Strategie, ein Weiter-so war schlicht keine Option. Aber verdienen Banken wegen dieser Selbstverständlichkeit schon wieder einen ordentlichen Vertrauensvorschuss von Politik und Aufsehern? Wohl kaum.
Misstrauisch wie beim Gebrauchtwagen-Händler bleiben
Gleiches gilt für das Verhältnis zu den Kunden: Nach all den Klagen wegen Falschberatung schwören die Institute nun unisono, dass ihre neue Kultur das Wohl des Kunden in den Mittelpunkt stelle. Eine hübsche Ansage, aber welches Unternehmen würde nicht behaupten, dass es etwas Nützliches macht? In einer Marktwirtschaft ist das der Existenzgrund für Firmen; wer nichts bietet, was Kunden attraktiv finden, hat keine Chance.
Das ändert nichts daran, dass Unternehmen manchmal Dienste oder Waren an den Mann bringen, die nicht halten, was sie versprechen. Viele Finanzprodukte sind dummerweise recht kompliziert oder zeigen ihren Wert erst nach vielen Jahren. Deswegen sollten Kunden ihr gesundes, neues Misstrauen gegen Banken keinesfalls wegen blumiger Kulturwandel-Tiraden ablegen. Sie sollten ihrem Bankberater genauso skeptisch gegenüber stehen wie einem Gebrauchtwagen-Händler. Berater sind Verkäufer - es mag sein, dass sie ein wirklich gutes Produkt anpreisen, es kann aber genauso gut sein, dass dieses faszinierende Wertpapier vor allem den Provisionen des Angestellten dient.
Wer Finanzfachleuten blind vertraut, dem ergeht es sonst wie dem Kaiser in Faust II, jenem Drama, das Johann Wolfgang von Goethe vor fast 200 Jahren schrieb. Dort lässt Goethe Mephistopheles die Geldprobleme des klammen Regenten lösen. Mephistopheles vervielfältigt dafür eine Urkunde mit der Unterschrift des Kaisers und erfindet so die Banknoten. Der Kaiser wendet mit dem Geld den Staatsbankrott ab, Inflation zerstört allerdings das Vertrauen in die Währung und stürzt das Land ins Chaos.
Banken sind keine Wohltätigkeitsvereine
Der Grund dafür, dass Kunden Banken weiter misstrauen sollten, ist jedoch nicht, dass Bankangestellte von hause aus verworfen wären und deshalb Kulturwandel-Programme nicht fruchten. Der Grund dafür ist, dass Banken in erster Linie ihren Gewinn maximieren wollen. Es sind keine Wohltätigkeitsvereine, die selbstlos Anlagetipps geben. Das ist in einer Marktwirtschaft nichts Ungewöhnliches oder Unanständiges, aber Bürger sollten sich dem immer bewusst sein.
Bankvorstände müssen ihre Eigentümer zufriedenstellen, im Falle der Großbanken meist eine Aktionärsschar. Die wollen steigende Gewinne sehen - damit bleibt immer die Versuchung, Kunden nicht das beste, sondern nur das fünftbeste Produkt zu verkaufen, wenn das der Bank höhere Einnahmen beschert. Es bleibt immer die Versuchung, die Vorschriften der Regulierer mit trickreichen Konstrukten so zu dehnen, dass der Konzern weiterhin hoch riskante, aber sehr gewinnträchtige Geschäfte tätigen kann.
Deswegen dürfen auch Aufsichtsbehörden und Regierungen den Banken keinen Vertrauensvorschuss gewähren, sie müssen im Zweifel immer das Schlimmste vermuten. Selbst dann, wenn das Finanzinstitut beteuert, die Sache mit dem Kulturwandel so richtig, richtig ernst zu nehmen.
Staat und Aufseher schaffen Vertrauen ins System
Das ist umso wichtiger, bedenkt man, welch bedeutende Rolle Banken in der Wirtschaft erfüllen. Sie helfen Bürgern dabei, zu sparen, und sie versorgen Firmen mit Kredit. Das können sie aber nur, wenn Kunden ihnen vorher Geld anvertrauen. Die Bürger müssen dafür dem Bankensystem als solchem vertrauen - nicht jedoch der Beratungsqualität der einzelnen Bank.
Dieses Vertrauen der Kunden ins System schaffen keine Kulturwandel-Seminare. Dieses Vertrauen schaffen Staat und Aufseher, schaffen Einrichtungen wie der Einlagensicherungsfonds, der bei Pleiten für das Geld der Kunden haftet. Nach dem Zusammenbruch der Herstatt-Bank 1974 setzte Finanzminister Hans Apel dessen Gründung durch, um das "Vertrauensgefälle" wieder auszugleichen, wie er sagte.
Haben Kunden das Gefühl, dass Aufseher bei den Finanzkonzernen ganz genau hinschauen, werden sie ihr Geld weiter zu Banken tragen - und beim Beratungsgespräch hoffentlich das spezielle Anlageprodukt mit gebotenem Argwohn beäugen. Gesundes Misstrauen von Politik, Aufsehern und Kunden gegenüber der einzelnen Bank ermöglicht folglich mehr Vertrauen ins gesamte Bankensystem. Wenn Banker in ihren Reden ganz oft das V-Wort nutzen und den Vertrauensverlust in ihr Institut beklagen, ist das also ein gutes Zeichen.