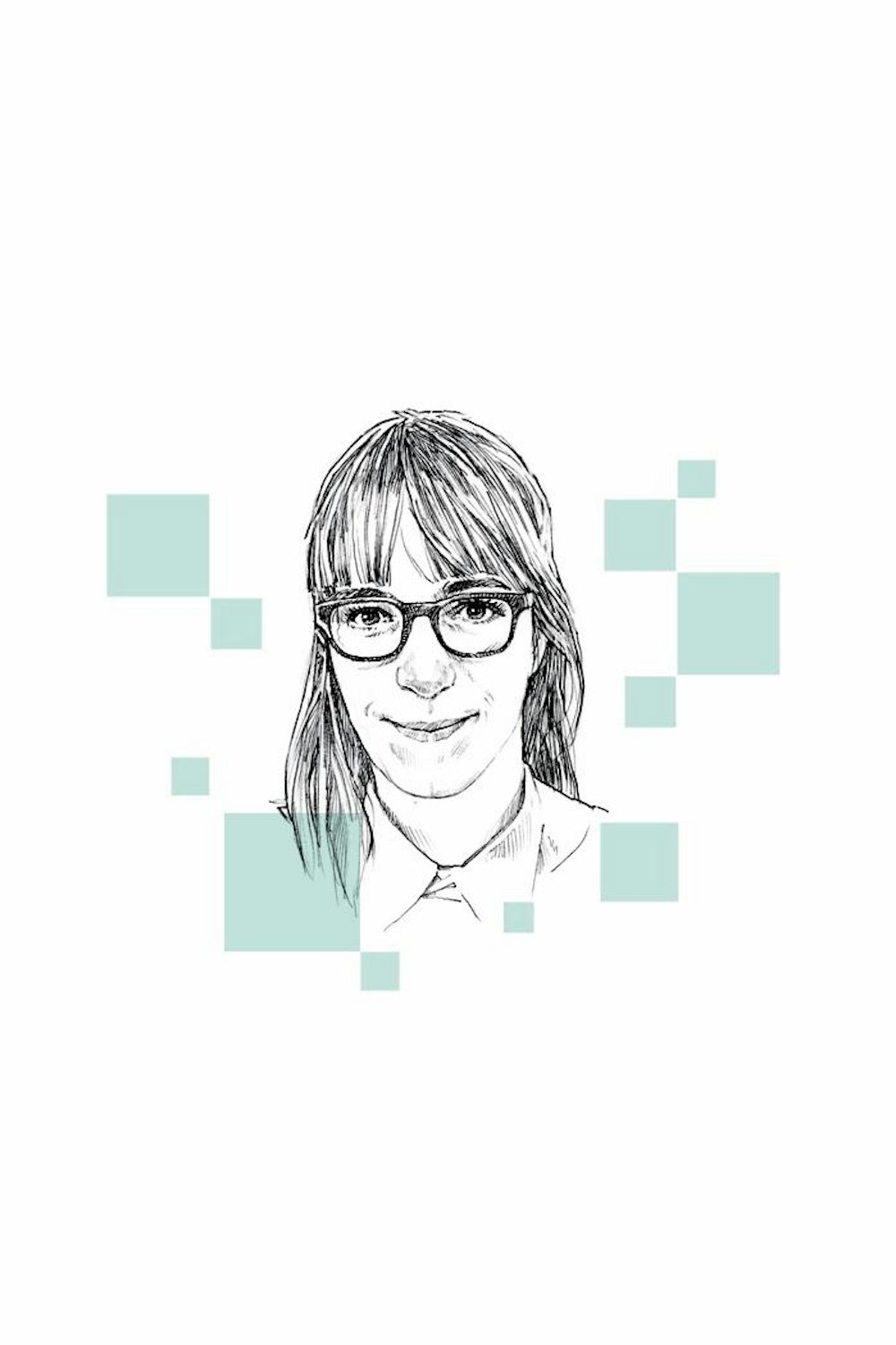Wenn an diesem Mittwoch die künftige EU-Kommission vom EU-Parlament bestätigt wird, dürfte nicht nur die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erleichtert sein, die um Zustimmung zu ihrem Kollegium ringen musste. Auch viele Abgeordnete dürften froh sein: Denn erst wenn die Kommission ihre Tätigkeit aufnimmt, kann auch die "normale" Parlamentsarbeit wieder beginnen: die Gesetzgebung.
Ein Gutes hat es aber gehabt, dass das Parlament in den vergangenen Wochen gewissermaßen sich selbst überlassen war: So ist ein "übrig gebliebenes" Gesetzesvorhaben aus der vergangenen Legislatur ein ganzes Stück weitergekommen, bei dem sich vorher lange kaum etwas bewegt hatte. Es geht um ein Gesetz, das zu Streit führen wird zwischen dem EU-Parlament, der Kommission und den Mitgliedstaaten.
Dabei dürften das Ziel der sogenannten "E-Evidence"-Verordnung alle Beteiligten gut heißen: Strafverfolger sollen schneller an Daten kommen, die im Netz von ausländischen Anbietern gespeichert werden. Straftäter hinterlassen ja nicht nur Haare auf der Auto-Rücklehne oder Fußabdrücke wie im Fernsehkrimi, sondern fast immer auch Datenspuren.
Letztlich soll mit dem Vorschlag eine Grenze aus der analogen Welt eingerissen werden, die es im Netz sowieso nie gegeben hat: So, wie Daten problemlos Grenzen überwinden, sollen auch Ermittler grenzüberschreitend Daten abfragen können, und zwar deutlich schneller als bisher. Derzeit müssen Strafverfolger dafür ein oft langwieriges Rechtshilfeverfahren anstrengen, also die Behörden des anderen Staates um Hilfe bitten, die dann wiederum beim jeweiligen Provider nach den Daten fragen. Bis die Informationen bei dem angekommen sind, der ursprünglich nach ihnen gefragt hat, ist es aber oft schon zu spät, um den Täter aufzuspüren, so die Klage von Polizisten und Staatsanwälten.
Die E-Evidence-Verordnung will dieses Stille-Post-artige System straffen, indem sie zumindest einen der Mittelsmänner ausschaltet: die Justizbehörde des Mitgliedslandes, in dem die Daten gespeichert sind. Stattdessen soll bei Straftaten, für die eine Haft von mindestens drei Jahren droht, zum Beispiel ein deutscher Staatsanwalt direkt bei einem Provider in Italien um die Daten bitten können. Er oder sie könnte Metadaten, unter strengeren Voraussetzungen auch den Inhalt von E-Mails oder Messengernachrichten abfragen - und zwar ohne dass der Staat, in dem sich der Verdächtige befindet, noch mitreden könnte. Weigern sich Anbieter, drohen Sanktionen in Höhe von bis zu zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.
Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass man mit dieser Idee einiges an Zeit gutmachen kann. Es braucht aber auch nicht viel Fantasie, um zu ahnen, dass mit so einem Instrument auch Schindluder getrieben werden könnte. Kritiker des Vorhabens warnen, dass dann etwa in Deutschland auch wegen Straftaten (elektronisch) ermittelt werden könnte, die dort gar nicht strafbar sind. Die Bundesrechtsanwaltskammer nannte in einer Stellungnahme als Beispiel "politisch motivierte Verfolgung wegen zu diesem Zweck geschaffener Delikte", andere Kritiker verweisen auf Polen: Dort ist Abtreibung meistens verboten. Außerdem: Wenn Behörden noch nicht einmal davon erfahren, wer von wem welche Daten fordert, bleibt die Entscheidung, ob diese weitergegeben werden, letztlich privaten Anbietern wie Facebook oder Google überlassen.
"Der Vorschlag nimmt Staaten die Möglichkeit, die Grundrechte ihrer Bürger zu schützen."
Die Kritik schallt dem Vorhaben von vielen Seiten entgegen. Erst vor wenigen Tagen mahnte der EU-Datenschutzbeauftragte, die Behörden im Empfängerstaat sollten "so früh wie möglich" in das Verfahren involviert werden, um zu prüfen, ob der Anfrage etwas entgegensteht; in Deutschland verfassten Ende Oktober 13 Organisationen der Zivilgesellschaft einen offenen Brief: "Der Vorschlag nimmt Staaten die Möglichkeit, die Grundrechte ihrer Bürger zu schützen", heißt es darin. Als die Sache im Rat der Mitgliedstaaten verhandelt wurde, sprach sich auch das Bundesjustizministerium, damals noch unter Katarina Barley (SPD), dagegen aus, Provider und Diensteanbieter ohne Mitwirkung der jeweiligen Justizbehörden zur Herausgabe zu verpflichten, allerdings vergeblich.
Nun hat auch die SPD-Abgeordnete Birgit Sippel, die zuständige Berichterstatterin im Europaparlament, ihren Entwurf zu dem Thema vorgelegt. Sie teilt die Kritik am Gesetzvorschlag der Kommission, und sieht in ihrem Bericht etwa eine Benachrichtigungspflicht für die lokalen Justizbehörden vor. Auch sie sei zwar für schnellere, effizientere Strafermittlungen, sagt sie. "Aber Effizienz zählt als Argument nur, wenn gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Grundrechte gewahrt werden."
Kein Wunder, dass die EU-Kommission von dem Bericht nicht begeistert ist. Der SZ liegt ein siebenseitiges Dokument der Behörde vor, in dem es heißt, dass Sippels Änderungen "erheblichen Einfluss auf die Effizienz" der neuen Ermittlungsinstrumente haben würde. Die Kommission wollte das Schreiben nicht kommentieren. Sie steht unter Druck: Solange es keine europäische Lösung gibt, wann Ermittler welche Daten abfragen können, besteht das Risiko, dass einzelne Mitgliedstaaten eben auf eigene Faust entsprechende Vereinbarungen mit den USA abschließen, wo viele der Server stehen - Großbritannien etwa hat das bereits getan. Ein bemerkenswerter Vorgang, findet der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner, der Sippels Kritikpunkte teilt, auch wenn er im Detail eigene Verbesserungsvorschläge einbringen will. Trotzdem: "Das Vorgehen Großbritanniens zeigt, warum wir für E-Evidence eine europäische Regelung brauchen", sagt er.