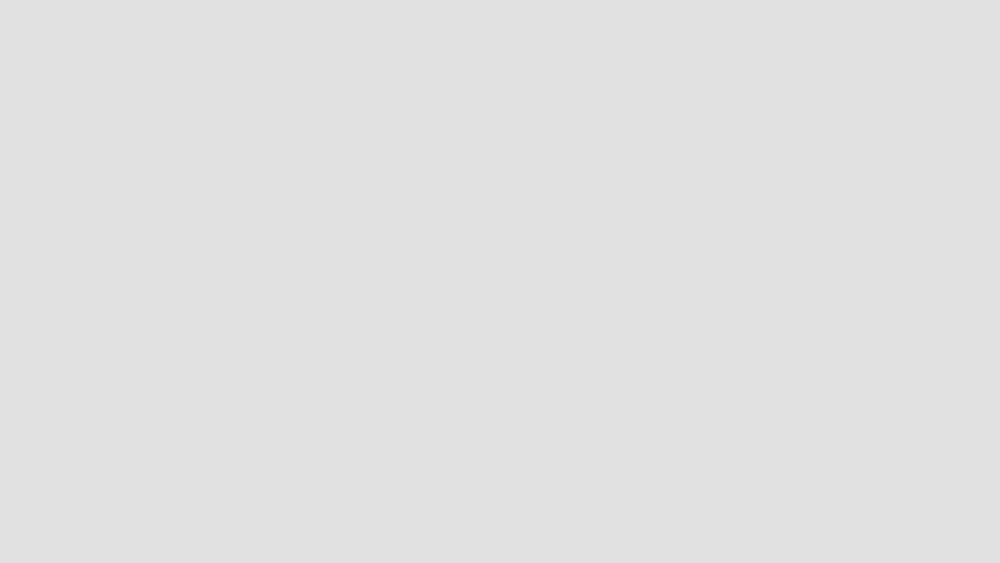Die Enttäuschung der indischen Bäuerinnen über den fairen Handel hat Dieter Overath hautnah erlebt. Vergangenes Jahr hockte der Geschäftsführer von Transfair Deutschland gemeinsam mit einigen Frauen auf dem Boden eines Hauses in Südindien und hörte ihnen aufmerksam zu. Sie sprachen von geplatzten Hoffnungen, weil sie ihre Baumwolle nicht als faire Ware verkaufen konnten, sie waren wütend, weil die Nachfrage in den reichen Industriestaaten so gering ist. Overath haben die Klagen keine Ruhe gelassen.
Ein Jahr später, in seinem Kölner Büro, erzählt er, er habe eine Lösung gefunden. Er will Unternehmen mit einem vereinfachten Verfahren locken, mehr fair produzierte Baumwolle zu verarbeiten.
Für den fairen Handel ist dies eine Revolution. Bislang beschränkt er sich fast ausschließlich auf die Zertifizierung landwirtschaftlicher Produkte, die Kleinbauern oder Plantagenarbeiter herstellen, und macht einen Bogen um die Fabrikhallen, in denen Spielzeug, Computer oder eben Bekleidung hergestellt werden. Die Vorarbeiten begannen bereits 2009. Seitdem wurden fünf Pilotprojekte unter anderem in Indien und Südafrika durchgeführt. In den nächsten drei Jahren soll darauf aufbauend ein Standard für faire Kleidung entwickelt und auf seine Praxistauglichkeit ausprobiert werden.
"Still und leise erldigt"
"Wir konzentrieren uns auf drei Aspekte", sagt Rossitza Krueger, bei der Dachorganisation Fair Trade International für Textilien zuständig: Bessere Arbeitsbedingungen, mehr Mitbestimmungsrechte für die Beschäftigten und vor allem einen Existenz sichernden Lohn. Bislang reicht der gesetzliche Mindestlohn in vielen Ländern häufig kaum zum Überleben aus.
Positive Erfahrungen in anderen Branchen gebe es durchaus, sagt Overath. Etwa im Blumenhandel. Für Einzelhändler sei es noch vor einigen Jahren "eine Art Naturgesetz" gewesen, dass ein Zehner-Bund Rosen 1,99 Euro kosten müsse. "Das hat sich still und leise erledigt", sagt Overath: Heute haben fair gehandelte Rosen in Deutschland einen Marktanteil von 25 Prozent, Tendenz steigend. Er spricht von einer Aufwärtsspirale bei den Arbeitsbedingungen in Kenia, dem wichtigsten Bezugsland für faire Rosen. Hier habe der konventionelle Blumenhandel mancherorts schon Schwierigkeiten, überhaupt noch Beschäftigte zu finden, weil diese lieber auf den fairen Farmen arbeiten würden.
Die bisherigen Erfahrungen im Textilbereich sind allerdings ernüchternd. Seit dem Jahr 2005 kümmert sich die Organisation um den Rohstoff Baumwolle. Seitdem können Verbraucher Bekleidung kaufen, die aus fairer Baumwolle besteht. Das sagt allerdings nichts über die Arbeitsbedingungen der Näherinnen aus. Zudem ist die Nachfrage von Industrie und Handel nach fair zertifizierter Baumwolle geringer als das Angebot. Viele Bauern können ihre Ware nur zu dem wesentlich geringeren Preis konventioneller Baumwolle verkaufen.
Hier will Overath Abhilfe schaffen - mit einem neuen Verfahren, das den Unternehmen ein wenig entgegenkommt und das, wie er sagt, "für Massenware tauglich" sei. Denn bislang sind die Hürden hoch: Wer als Unternehmer Waren aus fairer Baumwolle wie Kleidung oder Haushaltstextilien produziert, muss einen Nachweis erbringen, dass die Beschäftigten auf allen Stufen der Baumwollverarbeitung entsprechend der Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO behandelt werden. Dann dürfen die Hersteller ihre Waren mit dem Siegel "Fairtrade certified cotton" auszeichnen. In der Praxis bedeutet dies für einen Unternehmer, dass er die faire Baumwolle getrennt durch alle Stufen der Produktion schleusen muss.
Das ist teuer und schreckt viele ab. Hier soll die neue Variante greifen: Sie verpflichtet den Unternehmer, nur noch einen bestimmten Anteil der Produktion nachweislich aus fairer Baumwolle zu bestreiten. Anders als heute könnte er faire und konventionelle Baumwolle zusammen verarbeiten. "Das vereinfacht das Verfahren und spart Kosten", sagt Krueger. Werben dürften die Unternehmen allgemein damit, dass sie in einem bestimmten Umfang faire Baumwolle einsetzen - das Fair-Trade-Siegel dürften sie nicht aufdrucken.
"Dem Bauern ist erst einmal egal, wie die Baumwolle verarbeitet wird. Die wollen einfach mehr absetzen", sagt Overath und verweist auf die desolate Lage vieler Bauern vor Ort. Der Preis für Baumwolle ist in den vergangenen Jahren deutlich gefallen. Die Erlöse vieler Bauern reichen nicht einmal aus, um die Kosten für Saatgut und Pflanzenschutzmittel zu decken.
Das gleiche Verfahren will der faire Handel künftig auch bei anderen Rohstoffen wie Zucker und Kakao einsetzen. Damit kommt er auch der Industrie entgegen, die schon länger auf einfachere Verfahren drängt.
Beim Verbraucher könnte die Variante für mehr Durchblick sorgen. Laut Krueger gehen viele Konsumenten bei dem Siegel "Fairtrade certified cotton" fälschlicherweise nämlich davon aus, dass das ganze Kleidungsstück fair hergestellt worden ist. Dabei könnte heute theoretisch ein T-Shirt aus fair produzierter Baumwolle in einer maroden Fabrik in Bangladesch hergestellt werden.