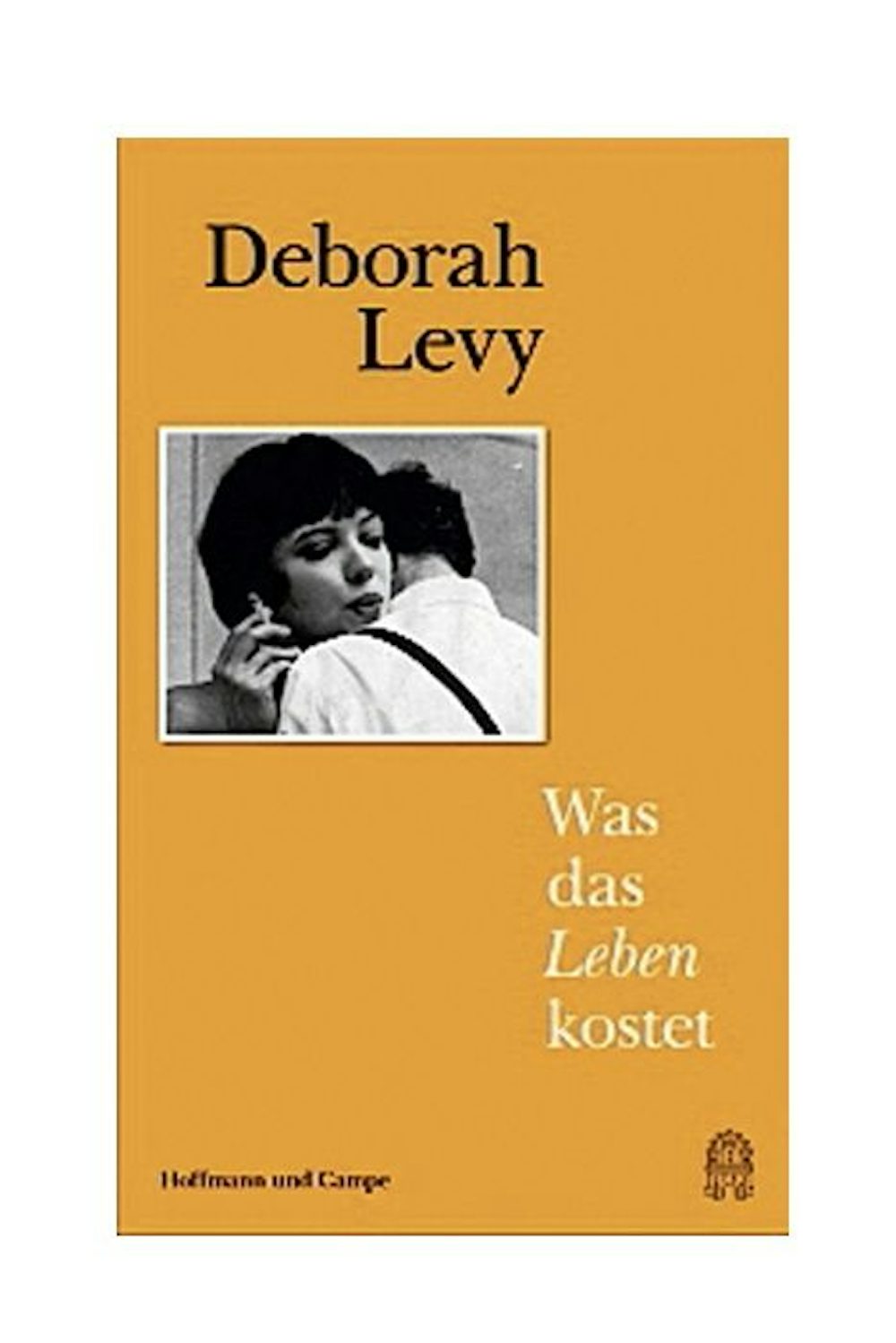Es gibt sicher bessere Voraussetzungen, sich mit dem aktuellen Buch von Deborah Levy zu beschäftigen. Gerade liegt es im Sand am Strand einer dänischen Insel. Man hat sich aus dem Yoga-Retreat geschlichen, es ging nicht länger. Jetzt ist aber genau diese Frau schon wieder da - alle diese Frauen eigentlich. Sie sind um die fünfzig. Sie sind durcheinander. Sicher ließe sich das Leben leichter aushalten, wenn es sich nicht dem Ende zuneigte; gegen die Angst vor dem Tod hilft es nicht, sich vorzustellen, dass die kommenden Jahre auch nicht besser sein werden.
Selten war man einer Autorin und ihrer Hauptfigur näher: "Als ich um die fünfzig war und mein Leben eigentlich einen Gang hätte zurückschalten, stabiler und vorhersehbarer werden sollen, wurde alles schneller, instabiler, unvorhersehbarer." Deborah Levy, die erfolgreiche, in Südafrika geborene, in London lebende Literaturprofessorin, Theaterautorin und Schriftstellerin, hat unter dem Titel "Was das Leben kostet" Notizen aus schlechten Zeiten veröffentlicht. Ihr Mann habe sie verlassen, deswegen - so schreibt sie - entgleite ihr alles. Das Familienhaus ist weg, die ältere Tochter zieht aus, das Geld reicht nicht. Dann stirbt auch noch die Mutter.
Dennoch lässt Deborah Levy ihre Leser nicht am Familientisch oder unter der nassgeheulten Bettdecke dabei sein. Die Bestandsaufnahme ist fragmentarisch gehalten und in einem eigenartigen Tonfall - als jammere sie einer entfernten Bekannten am Telefon etwas vor, die sich die näheren Umstände und Ereignisse eh nicht merken wird (in einem Tonfall, der vor allem deutlich macht, dass man erstens alles unter Kontrolle kriegt, ganz sicher, und zweitens bereit ist, sich auch unter widrigsten Umständen zu amüsieren). Ist es ihr Tagebuch, das Levy geöffnet hat? Sind es die Beobachtungen, die Autoren in ihre kleinen Notizbücher kritzeln, wenn sie - das Auto ist auch abgeschafft - auf die Tube warten?
Man möchte Mitgefühl haben mit einer Hauptfigur, die ihr Leben schlingernd durchquert
Auch wer nicht zu den Lesern und Leserinnen gehört, die Frauenliteratur schätzen, die leicht und humorvoll davon berichtet, wie andere Frauen ihr Leben meistern, möchte ja Mitgefühl haben mit einer autobiografisch angelegten Hauptfigur, die ihr Leben so schlingernd durchquert, wie sie mit ihrem neuen E-Bike zur neu angemieteten Wohnung kurvt ("Ich war bereift ... ich musste mich zusammenreißen, um nicht zu juchzen"). Doch fehlt es sonst an allem - weder haben die Töchter noch der Partner einen Vornamen, noch treten sie alle wirklich in Erscheinung. Alles ist Hintergrund.
Deborah Levy, die sonst so präzise Zeilen für ihre Theatercharaktere setzen kann, stammelt sich durch diesen Text. Und ihre Erzählerin blickt so ratlos auf das eigene Leben, wie sie aus den Fenstern der schäbigen Appartements das Panorama ihres "über alles geliebten" London sieht. Das Buch wirkt unbehaust, vorwurfsvoll, aber ziellos. Nur eine weitere, ungeschickte Variation des Genres der Verlassenheit, angereichert mit dem Wissen einer Akademikerin, die in jeder Lage lieber bei Duras nachschlägt - und darauf auch stolz ist.
Irgendwo im Internet kursieren noch alte Porträtfotos der heute 57-jährigen Deborah Levy, die sie mit fast verstörend aggressivem Ausdruck zeigen. Sie sieht aus, als würde sie aus der Einkaufstüte, in der ihr älteres Ich die einzelnen Perlen eines zerrissenen Colliers zwischen Gemüse und Sekundärliteratur verstaut, umstandslos die Schaufel ziehen, mit der sie gerade die Nachbarskatze vergraben hat. Wo es um Existenzielles geht ist die junge Deborah Levy ganz offensichtlich der Typ Frau, der eher den Griff der Schaufel in der Hand hat, statt die Metallseite auf den Kopf zu kriegen. Von dieser Autorin hätte man erwartet, dass ihre Selbstbeobachtung härter ist, dass sie zu etwas anderem führen, als Zitaten.
Man vermutet sicher nicht zu Unrecht, dass das aktuelle Elend der Deborah Levy nicht damit begann, dass sie verlassen wurde, oder dass die Ehe der Fehler war. Sie ist eine andere geworden, eine mit Perlenkette, eine, die ihr selbst nicht mehr gefällt. Ein lichter Moment des Buches ist der Auftritt von Freundin Sasha, die erzählt, "dass sie und ein paar Kolleginnen sich freitags zum Abschluss der Woche in verschiedenen Bars sinnlos volllaufen ließen, um anschließend ihre uniforme Arbeitskleidung vollzukotzen". So eine Deutlichkeit geht dem Text ansonsten ab. Es scheint, als habe die eigenwillige Autorin, die Levy einmal war, sich schon lange vor dem Trauma des Verlassenwerdens aus dem eigenen Werk geschlichen, als habe sie es verlassen.