Im Rahmen der identitätspolitischen Kontroversen der Gegenwart wurde zuletzt heftig um das gestritten, was in der Kulturwissenschaft seit den Siebzigerjahren unter die etwas unrunden Begriffe "cultural appropriation" oder "kulturelle Aneignung" fällt. Was damit gemeint ist, ist allerdings nicht schwer zu verstehen: Im weitesten Sinne bezeichnet kulturelle Aneignung die Tatsache, dass sich eine Künstlerin oder ein Künstler für seine Kunst bei Traditionen bedient, die mit dem kulturellen Umfeld, aus dem sie oder er selbst stammen, nichts zu tun haben. Aus künstlerischer Sicht ist das zunächst unproblematisch, zu allen Zeiten sorgte das Fremde für Inspiration. Problematischer wird es in dem Moment, in dem kommerzieller Erfolg ins Spiel kommt. Dann steht schnell der Vorwurf der illegitimen Ausbeutung im Raum. Das klassische Beispiel dafür im Pop ist der britische Blues der Sechzigerjahre. Damals wurde eine ganze Flut von jungen weißen Briten mit einer Musik weltberühmt, die auf der anderen Seite des Atlantiks von schwarzen Amerikanern und Amerikanerinnen erfunden worden war und tief in deren bitteren Erfahrungen von Armut und Diskriminierung wurzelte. Wirklich tiefenscharf darüber gesprochen wurde und wird jedoch selten. Und zwar auf beiden Seiten.
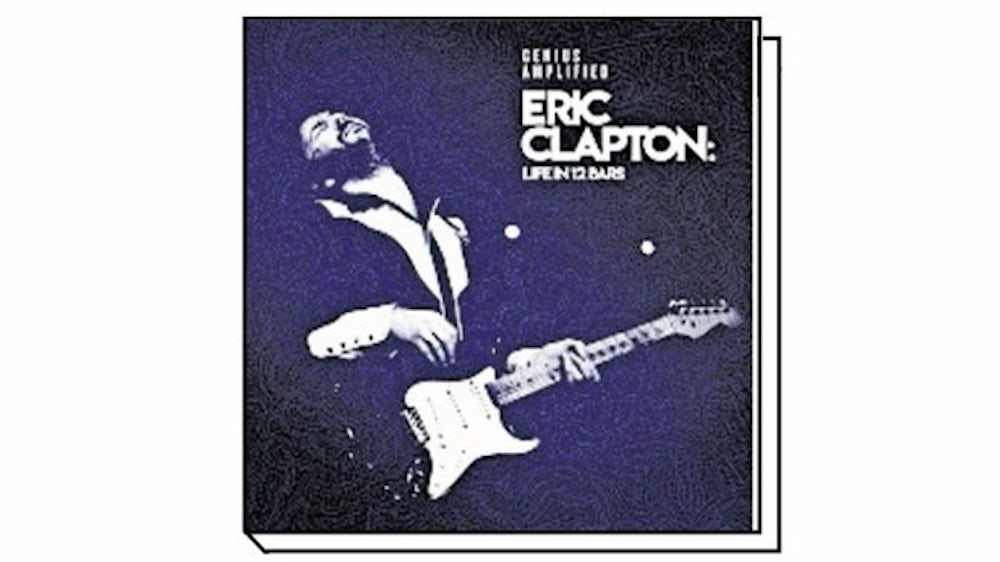
Die Kläger übersahen, wie sehr sich die Jungen für ihre Vorbilder einsetzten, und zwar schon allein dadurch, dass sie offen ihre Einflüsse sprachen oder mit ihnen auftraten und Platten aufnahmen und so bis dahin selbst in Amerika weithin Unbekannte bekannt machten. Von den Rolling Stones gibt es etwa die berühmte Geschichte, dass sie 1965 erst bereit waren, in der amerikanischen Fernsehsendung "Shindig!" zu spielen, wenn Howlin' Wolf auch auftreten dürfte. Während der Show ließ es dann der Moderator im Gespräch mit Brian Jones und Mick Jagger so aussehen, als sei es seine Idee gewesen. Jones und Jagger spielten mit und nutzten die Chance, Wolf vor einem riesigen weißen Publikum als "eines unserer größten Idole" vorzustellen, als den Mann, der "Little Red Rooster" aufgenommen habe, woraufhin der große elegante schwarze Mann in Anzug und Krawatte formvollendet auf die Bühne schritt und zu croonen begann, während das Studio-Publikum, das ausschließlich aus weißen pubertierenden Mädchen bestand, kreischte. Ein Coup.
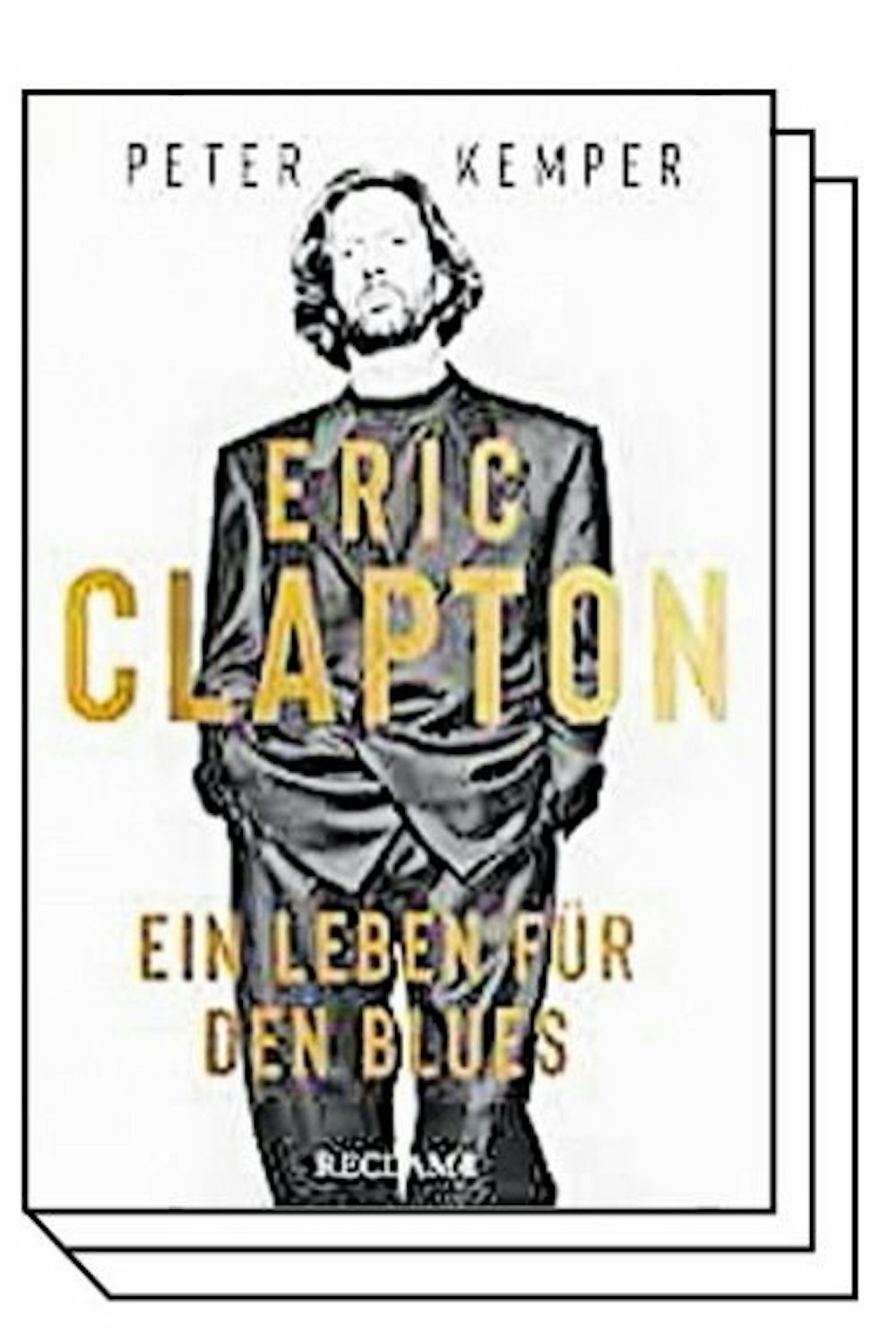
Die Verteidiger der kulturellen Aneignung im Pop wiederum vergaßen ihrerseits, dass die schwarzen Vorbilder zwar reich und berühmt wurden, aber natürlich lange nicht so reich und berühmt wie ihre jungen weißen Epigonen. Eine Ungerechtigkeit, an die Chuck Berry, der Vater des Rock 'n' Roll, Zeit seines Lebens nie vergaß zu erinnern, weshalb sich übrigens viele berühmte Verehrer immer etwas seltsam naiv an ihn als verschroben und unversöhnlich erinnern. Er hatte Gründe!

Es ist deshalb ein kaum zu überschätzendes musikjournalistisches Verdienst, dass sich Peter Kemper in seiner neuen Biografie von Eric Clapton, "Eric Clapton - Ein Leben für den Blues" ( Reclam), offen, kundig und kritisch mit den schattigeren Seiten der British Blues Invasion auseinandersetzt: "Niemals hat sich beispielsweise ein Blues-Aficionado wie Clapton die schwierigen Lebensumstände armer, schwarzer Farmpächter, Pförtner oder Fabrikarbeiter herbeigewünscht -, das wäre auch viel zu anstrengend gewesen." Die britischen Blues-Jünger hätten, trotz wiederholt geäußerten Bedauerns, nicht als Amerikaner geboren worden zu sein, "nicht wirklich schwarz sein" wollen: "Sie wünschten sich vielmehr, wie Cowboys zu agieren, und konstruierten sich deshalb den Blues-Musiker als eine Art ,schwarzen Cowboy'". Den archetypischen "Bluesmen", der sie inspirierte, imaginierten sie sich als "geborenen Verführer", als sexuelles Vorbild. Bedeutende Bluesmusikerinnen, so Kemper, wie Bessie Smith, Memphis Minnie oder Rosetta Tharpe wären "im musikalischen Weltbild der jungen Briten" zunächst gar nicht aufgetaucht.
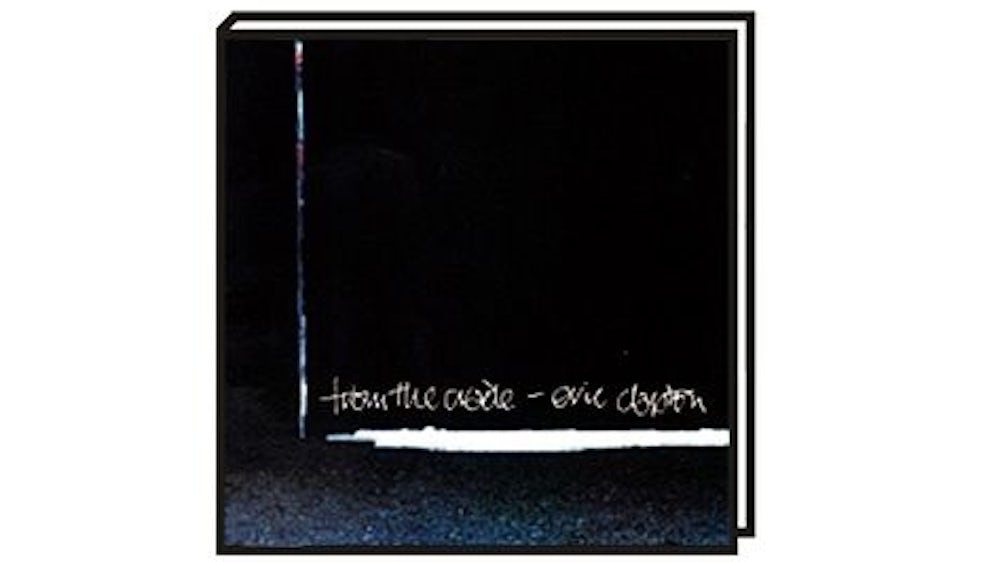
Und auch dort, wo es bei Clapton richtig düster wird, bei seiner rassistischen Tirade 1976 während eines Konzerts in Birmingham, für die er sich jahrzehntelang nicht wirklich entschuldigte (sie manchmal sogar verteidigte), gräbt Kemper trotz aller Verehrung tiefer. Ein ganzes Kapitel widmet er dem Skandal, bei dem er ihm nicht einmal seine allerjüngsten Einlassungen zum Thema aus dem Jahr 2017 ganz durchgehen lässt. Da schämte sich Clapton mit Verweis auf schwarze Freunde und seine Vergötterung der schwarzen Musik. Doch vielleicht, so Kemper, sitze Clapton hier einem Trugschluss auf: "Wer behauptet, er habe schwarze Freunde und liebe schwarze Musik, wird dadurch als Weißer noch nicht automatisch zum Antirassisten." Damit (und mit den folgenden Kapiteln zu "Blackness" und dem "Hipster") ist das Buch dann endgültig nicht mehr bloß eine gute Biografie eines Musikstars, sondern ein bedeutender aktueller Beitrag zur laufenden Debatte über strukturellen Rassismus.