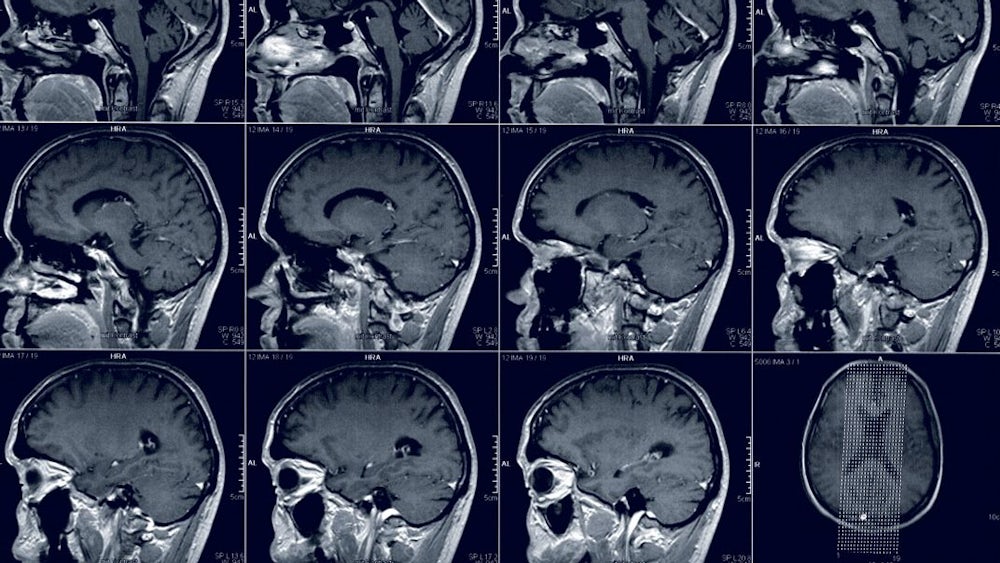Gedankenfreiheit ist das Herzstück einer demokratischen Ordnung. In Zeiten der massenhaften Überwachung physischer und virtueller Räume ist der menschliche Geist die letzte Bastion absoluter Freiheit und Privatheit. So könnte man meinen - doch auch diese Bastion scheint zu bröckeln. Denn es werden mehr und mehr Neurodaten gesammelt, also Daten zu den Abläufen im Gehirn.
Anfänglich wurden Neurodaten zu medizinischen Zwecken verwendet. Man erhoffte sich zum einen, durch bildgebende Verfahren wie der Kernspintomographie (MRT) neurologische Erkrankungen besser zu verstehen. Zum anderen entdeckte man mit der Elektroenzephalographie (EEG) - die durch das Gehirn produzierte elektrische Impulse misst -, dass Men-schen mit ein wenig Übung in der Lage waren, diese Impulse zu kontrollieren.
Daraufhin wurden Brain-Computer-Interfaces (BCIs) entwickelt. So konnten etwa Patienten mit Locked-in-Syndrom - die sich trotz vollem Bewusstsein weder bewegen noch körperlich mit ihrer Umwelt interagieren können - wieder über einen Bildschirm mit anderen kommunizieren. Ein weiteres Beispiel ist das Mindwalker-Projekt, das querschnittsgelähmte Menschen mit Hilfe eines gedankengesteuerten Exoskeletts zum Gehen befähigen soll.
Computerspiele per Gedanken steuern
Aber das Sammeln von Neurodaten beschränkt sich längst nicht mehr auf klinische Anwendungen. So gibt es Versuche, Game-Controller zu entwickeln, mit denen man Computerspiele per Gedanken steuern kann. Beim "Affective Computing" sind Neurodaten zur Erkennung der Gemütslage des Nutzers von Vorteil. Durch sie soll die Kommunikation zwischen Mensch und Computer verbessert werden.
Es gibt Firmen, die Gedankengänge von Konsumenten zu verstehen und gezielt zu beeinflussen versuchen, um ihre Produkte besser zu vermarkten. Andere Unternehmen vertreiben Lügendetektoren, die auf Basis neuronaler Bilder funktionieren. Den Kunden wird ein "objektives Verfahren zum Nachweis von Täuschungen und anderen im Gehirn gespeicherten Informationen" versprochen.
Die Fähigkeit, Neurodaten zu nutzen, ist faszinierend und wird die Entwicklung vieler neuartiger Anwendungen vorantreiben. Einige davon könnten erheblichen Nutzen für den Einzelnen und die Gesellschaft haben. Doch was ist die Kehrseite?
Das scheinbar Unmögliche kann schnell zur Normalität werden
Für die "Sammler" personenbezogener Daten liegt der Wert in den Einblicken, die sie in die Verhaltensmuster und Vorlieben des Einzelnen gewähren. Je mehr Daten, desto tiefer die Einblicke. Diese Logik steckt hinter den immer komplexeren und invasiveren Formen des Datensammelns und Profilings - oft verdeckt hinter dem Angebot einer kostenlosen, coolen und effizienteren Dienstleistung. Facebook ist nicht einfach ein soziales Netzwerk. Google ist nicht einfach eine Suchmaschine. Die NSA fischt nicht aus einer Laune heraus nach Informationen.
Warum sollte es sich mit Neurodaten in Zukunft anders verhalten? Wird der Zugang zu Informationen über neuronale Aktivitäten, gar über Gedanken und Gefühle nicht eine ganz neue Art der Beurteilung von Personen ermöglichen? Ein solches Szenario ist nach gegenwärtigem Stand zwar eher Science-Fiction. Doch die beiden letzten Jahrzehnte des Fortschritts in der Computertechnik haben uns gelehrt: Das scheinbar Unmögliche kann schnell zur Normalität werden. Wie sieht eine Welt aus, in der Firmen oder Regierungen unser Gehirn kontinuierlich überwachen könnte? Wollen wir in einer solchen Welt leben?
Eigentlich sollte uns das Recht davor schützen. Der Staat garantiert Persönlichkeitsrechte; dazu gehört auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das zwar nicht unmittelbar im Grundgesetz formuliert ist, aber 1983 vom Bundesverfassungsgericht daraus abgeleitet wurde.
Allerdings kann eine moderne Gesellschaft nicht ohne die Nutzung personenbezogener Daten auskommen; unser Datenschutzrecht hat daher das Ziel, die Bürger vor deren Missbrauch zu schützen. Es erlaubt aber die Sammlung und Verarbeitung personenbezogener Daten, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das Datenschutzrecht ist mittlerweile europäisch harmonisiert und wird zur Zeit reformiert. Ziel ist es, ein einziges, europaweit gültiges Gesetz zu schaffen: die so genannte Datenschutzgrundverordnung.
Als das europäische Datenschutzrecht entstand, steckte das Internet in den Kinderschuhen. Es gab noch keine Suchmaschinen, sozialen Netzwerke oder Smartphones. Damals waren personenbezogene Daten einfache soziale Fakten: Name, Adresse, Geburtsdatum. Die Welt hat sich seither jedoch radikal verändert. Und gerade Neurodaten sind nicht mit solchen "traditionellen" Daten vergleichbar. Bestimmte Arten von Neurodaten sind einzigartige Verkörperungen der Hirnaktivität eines Menschen, ähnlich individuell wie genetische oder biometrische Daten.
Sind Neurodaten "personenbezogen"?
Neurodaten können Informationen über Gedanken und Emotionen sowie Veranlagungen für geistige und körperliche Krankheiten oder Prädispositionen für Verhaltensmuster und Persönlichkeitstypen anzeigen, selbst wenn diese sich nie manifestieren. Neurodaten sind überdies zunächst Rohdaten. Sie erhalten erst einen Sinn, wenn sie mit wissenschaftlichen Modellen der Hirnfunktion interpretiert werden. Je nach Modell lassen sich unterschiedliche Arten von Wissen über ein Individuum gewinnen.
Das Problem ist nun: Angesichts dieser Eigenschaften von Neurodaten werden viele Aspekte des Datenschutzrechts mehr als unklar. Der Datenschutz gilt nämlich, wie gesagt, für "personenbezogene Daten". Sind Daten nicht "personenbezogen", so gelten sie als "anonym" - und das Datenschutzrecht findet keine Anwendung. Dann unterliegen die Daten aber auch keinem besonderen Schutz, und Dritte können sie nach Belieben sammeln, verarbeiten und weitergeben.
Bei Neurodaten sind viele Messfehler möglich
Dem herkömmlichen Datenschutzrecht genügt die Vorstellung von der Trennung von Daten und bürgerlicher Identität, um jene als anonym zu betrachten. Wenn aber Neurodaten individuell einzigartig sind, dann bleiben sie auch dann "personenbezogen", wenn alle offensichtlichen Verbindungen zu einer bürgerlichen Identität entfernt wurden.
Des Weiteren verlangt das heutige Datenschutzrecht, dass Daten stets "genau und aktuell" sein müssen. Dies ist unerlässlich, damit der Einzelne Daten überprüfen, gegebenenfalls korrigieren und die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung kontrollieren kann. Doch bei der Sammlung von Neurodaten ist erstens eine Vielzahl von Messfehlern möglich, zweitens haben Neurodaten immer nur im Zusammenhang mit dem verwendeten Modell der Funktionsweise eines Gehirns eine Bedeutung. Ihre "Genauigkeit" hängt daher immer davon ab, inwieweit das verwendete Modell auf den individuellen Fall anwendbar ist.
Außerdem können Neurodaten spezifisch für den Kontext sein, in dem sie gesammelt wurden. Gehirnwellenmuster können sich aufgrund von Umweltbedingungen, der Stimmung der Person und im Laufe des Lebens eines Einzelnen verändern. Was in der einen Situation "genau" sein mag, kann in einer anderen ganz anders aussehen. Und wie könnte jemand das Recht in Anspruch nehmen, seine auf Näherungswerten basierenden Daten einzusehen und zu korrigieren - wenn die Erzeugung der Daten komplexes wissenschaftliches und technisches Fachwissen voraussetzt? Und um das Ganze noch verwirrender zu machen: Wie kann ein Mensch die Genauigkeit von Daten in Frage stellen, wenn sich diese auf Aspekte seiner Person beziehen, die ihm unbewusst sind?
Bestimmte Formen von Daten sind besonders anfällig für Diskriminierung und andere Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das derzeitige Datenschutzrecht berücksichtigt dies und definiert besondere Arten von Daten wie etwa Gesundheitsdaten als "sensibel"'. Es gibt strengere Vorschriften zu deren Verarbeitung, die zudem im Voraus von einer Aufsichtsbehörde auf ihre Verhältnismäßigkeit hin geprüft werden muss. Auf der einen Seite scheint es offensichtlich, dass Neurodaten - insbesondere solche zu Gedanken und Gefühlen - von sehr privater Beschaffenheit sind und daher als "sensibel" betrachtet werden müssen. Die Liste der sensiblen Daten ist jedoch sehr exklusiv, und Neurodaten gehören bislang noch nicht dazu. Nach derzeit geltendem Recht unterlägen Neurodaten den gleichen Vorschriften wie Schuhgrößenmessungen.
Könnte man den Mangel also dadurch beheben, dass man die Liste der sensiblen Daten um Neurodaten erweitert? Nein, so einfach ist es leider nicht. Wie erwähnt, hat das Datenschutzrecht nicht nur den Schutz des Individuums, sondern gleichzeitig auch die Legalisierung der Verarbeitung personenbezogener Daten unter bestimmten Voraussetzungen zum Ziel. Dabei geht es um einen Ausgleich von Interessen bei der Datenverarbeitung. Gibt es womöglich Fälle, in denen ein solcher Ausgleich prinzipiell nicht möglich ist?
Die Verarbeitung von Neurodaten ist höchst problematisch
In der UN-Menschenrechtscharta und der Europäischen Menschenrechtskonvention werden der Geist und damit verbundene Begriffe wie etwa persönliche Gedanken, Gefühle und emotionale Zustände als Kern der Privatsphäre eines jeden verstanden. Dieses sogenannte forum internum ist untrennbar verbunden mit der Würde, Persönlichkeit und Autonomie des Menschen. Während das Datenschutzrecht bei einem "berechtigten Grund" jedwede Verarbeitung personenbezogener Daten legalisiert, sollte aber das forum internum - die innere geistige Welt des Einzelnen - bedingungslos geschützt bleiben.
Die Freiheit der Gedanken hat absolute Gültigkeit. Falls es einen physiologischen Bezugspunkt für den Geist gibt, dann ist dies das Gehirn. Falls Gedanken eine physische, messbare Existenz haben sollten, dann sind wir mit dem Aufzeichnen von Neurodaten wohl so nah wie nie zuvor an diese herangekommen. So betrachtet, ist die Verarbeitung von Neurodaten höchst problematisch.
Aber was genau sind eigentlich Gedanken? Und wie werden diese durch Neurodaten reflektiert? Der Rechtswissenschaftler Jan-Christoph Bublitz beschreibt den aktuellen Zustand so: "Ich vermute, dass Rechtsgelehrte und Gerichte nicht übermäßig ambitioniert sind, sich mit diesen Fragen zu befassen, und sich lieber an den Glauben klammern, dass die Freiheit der Gedanken nicht nur juristisch, sondern tatsächlich unantastbar ist, da Gedanken und der Geist (. . .) jenseits der Reichweite von Interventionen sind." Aber was ist, wenn Neurodaten in Verbindung mit bestimmten Anwendungen tatsächlich einen Übergriff auf das forum internum darstellen? Kann es dann legitim sein, ihre Verarbeitung zu verbieten?
Neue Technologien berühren unsere Grundrechte
Noch sind neurodatenverabeitende Technologien kaum verbreitet. Aber schon jetzt muss man in den Blick nehmen, dass wir es in Zukunft überall mit einer neuen Qualität von Daten zu tun haben werden - sei dies durch die schiere Quantität und Kopplung von großen Datensätzen (Big Data) oder durch neue Formen wie Biometrie-, Gen- oder eben Neurodaten bedingt. Das klassische Datenschutzrecht - mit seiner Logik von einfachen und besonderen Arten personenbezogener Daten - greift hier zu kurz und wird den neuen Herausforderungen nicht mehr gerecht. Hinzu kommt, dass Neurodaten auch als Grundlage für Statistiken und darauf aufbauende Annahmen und Modelle dienen werden. Diese Wissensgenerierung betrifft dann nicht mehr nur den Datenschutz, sondern auch ganz allgemein die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre.
Problematische neue Technologien und Überwachung berühren unsere Grundrechte. Zwar stehen Persönlichkeitsrechte immer auch im Spannungsverhältnis zu anderen gesellschaftlichen Zielen. Aber bei der künftigen Nutzung von bestimmten Neurodaten darf es keinen Ausgleich mit anderen Interessen geben, wie ihn das geltende Datenschutzrecht durch eine Vielzahl von Ausnahmen häufig vorsieht. Grundrechte wie die Menschenwürde oder eben jene Gedankenfreiheit sind unveräußerlich und gelten absolut. In einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen sie nicht für den Staat oder für Unternehmen zur Disposition.
Dara Hallinan, Philip Schütz und Michael Friedewald arbeiten am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Paul de Hert an der Vrije-Universität Brüssel .